... newer stories
Sonntag, 17. Juli 2016
Rückreise - September 2015
atimos, 14:56h
Es war so weit. Nach vier Ländern (sieben, wenn man die zwei Umstiege und Nordkorea mitzählt), 20 Unterkünften, 25 Städten (ja gut, sagen wir besser „Ortschaften“, denn es gab auch Arthur’s Pass und Co.), 24* Betten, ca. 4.250 Kilometern auf dem Land- und Seeweg sowie grob geschätzt 32.720 Kilometern in der Luft brachen wir zur letzten Etappe dieses Abenteuers auf: dem Heimweg.
Wir stolperten in die vierte Etage des Hostels, packten unsere Rucksäcke, verabschiedeten uns vom Personal und brachen Richtung Flughafen auf. Die Anbindung hatten wir schon Tage zuvor herausgesucht (bei der Ankunft, um genau zu sein) und planten heute genug Zeit ein, um auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein. Es trafen keine ein, alles lief reibungslos, man ließ uns anstandslos das Land verlassen. So saßen wir mal wieder an einem Flughafen, gaben unsere Gepäck zum – vorerst – letzten Mal auf und begaben uns zu unserem Gate. Dieses Mal allerdings war etwas anders: Wir hatten Spaß. Es war diese Art von Spaß, die man hat, wenn man eine phantastische Zeit verbrachte, sich darüber im Klaren ist, dass man bald wieder in einen weniger abenteuerlichen Alltag zurückkehrt, und daher die letzten Momente noch auskosten will. Außerdem hatte Korea einen bleibenden Eindruck hinterlassen und saß uns immer noch in den Knochen. Um dies gebührend offenzulegen, feierten wir unsere Zeit mit vielen sinnlosen Fotos.
Da unser Flug recht spät startete, stellte ich mich mental auf einen langen, jedoch unruhigen Schlaf ein. Unsere Fluggesellschaft war mal wieder Emirates, so dass ich mir zumindest vom Essen viel versprach. Wenn man von meiner Erwartungshaltung ausgeht, wurde ich bitter enttäuscht. Tatsächlich war ich jedoch erleichtert. Nach einem Mitternachtssnack schickten sich die meisten Fluggäste zur Nachtruhe, mich eingeschlossen. Das Beste daran war die Anzahl der Passagiere: Obwohl es eine vergleichsweise kleine Maschine war, gab es nicht viel Gäste, wodurch teilweise ganze Sitzreihen leer waren. Selbstverständlich nutzte ich diese Gelegenheit schamlos aus und legte mich zum Schlafen hin. Dank des richtigen Aufklebers wurde ich rechtzeitig zu allen Mahlzeiten geweckt. Auch wenn es ein unruhiger Schlaf war, hatte ich mehr davon als auf den vergangenen Flügen und war tatsächlich ein bisschen erholt.
Dann kamen wir – erneut – in Dubai an und hatten – erneut – mehrere Stunden totzuschlagen. Dieses Mal hatten wir allerdings den Vorteil, dass wir uns bereits auskannten und darüber hinaus wacher als beim vorhergehenden Aufenthalt waren, was zugegebenermaßen keine Herausforderung war. Außerdem beinhaltete unser Flugticket heute einen Essensgutschein für einen kostenlosen Snack inklusive Getränk bei Costa Coffee (oder einen anderen Anbieter einer überschaubaren Liste), was wir uns nicht entgehen ließen. Es sah so aus, dass andere Leute ebenfalls diesen Gutschein erhalten hatten, wodurch die Schlange bei Costa Coffee länger als gewöhnlich war. Aber wir hatten sonst nicht viel zu tun. Wir fragten zuerst, was wir mit diesem Gutschein überhaupt erwerben durften, weil die Formulierung recht vage gehalten wurde.
Für meine Reisebegleitung entstand das Problem, dass alle Sandwiches, aus denen wir aussuchen konnten, eine Zutat enthielten, die ihren Gaumen ganz und gar nicht erfreute: Tomaten. Da alles Essen abgepackt war und im besten Fall nur kurz in einem kleinen Elektrogrill erwärmt wurde, gab es keine Möglichkeit der Sonderwünsche. Wir einigten uns schlicht darauf, dass sie die Tomaten weglassen musste.
So sah unser Frühstück in Dubai aus:


Es war gar nicht schlecht. Für den Preis sogar erstaunlich gut. Also alles in allem genau das, was man in Dubai erwarten würde. Außerdem half es uns dabei, ein bisschen Zeit rum zu bekommen.
Aufgrund des hohen Andrangs bei Costa Coffee wollten wir die Plätze nicht länger als nötig belegen, so dass wir zügig aßen und uns wieder auf den Weg durch den Flughafen von Dubai machten. Ich spazierte erneut durch dieses riesige Gebäude mit exotischem und teurem Dekor, machte Fotos (von denen ich nicht weiß, ob ich sie online stellen darf), verschickte eine Postkarte (die tatsächlich ankam – im Gegensatz zu jener aus Indonesien) und wartete auf unseren letzten Flug. Es war keine besonders spannende Zeit.
Beim Boarding gab es dann doch eine Überraschung. Zwischen unserem Flugticketkauf und unserem Rückflug aus Dubai war fast ein Jahr ins Land gezogen. In dieser Zeit hatte Emirates zwei Flüge zusammengelegt und sich einige Flugzeuge des Typs Airbus A380 besorgt, was für uns zur Folge hatte, dass unsere Sitzplatzwünsche überhaupt keine Berücksichtigung gefunden hatten. Anstatt also am Gang und einen daneben, bekamen wir den Fensterplatz und einen daneben. Der arme Tropf, der jetzt zwischen uns und dem Gang saß, tat mir beinahe leid. Das verging allerdings schon bald.
Entweder war dieser Flug nur für Deutsche reserviert oder aber wir saßen in dem Teil mit der größten Konzentration dieser Nationalität. Wie dem auch sei, wir wussten schon von Anfang an, wohin die Reise ging. Alle Leute um uns herum waren gereizt, meckerten, beschwerten sich und hatten es eilig. Der Urlaub war offensichtlich vorbei.
Zu allem Überfluss hatten wir auch noch eine reizende Flugbegleiterin. Reizend in dem Sinn, dass sie mich reizte. Schon von weitem fiel sie durch einen Teint auf, der zwischen brathähnchengold und orange lag. Ihr Lächeln war eine verzerrte Grimasse, die aus einem Tim Burton Film zu stammen schien. Alternativ dazu fletschte sie ab und an die Zähne, als wollte sie ihr Revier gegen mögliche Eindringlinge verteidigen. Das Make-Up dieser Stewardess erinnerte mich an eine Dreizehnjährige, die mit Hilfe ihrer Buntstifte zu einer Barbie mutieren wollte. Ihr Verhalten den Fluggästen gegenüber war im besten Fall taktlos, im schlimmsten unverschämt. Irgendetwas an dieser Person strahlte etwas Vertrautes aus. Wir hegten unsere Theorien, tuschelten miteinander und waren entsetzt, als sie sich als wahr herausstellten: Die Dame war Deutsche.
Um nur einige Beispiele für ihr unangebrachtes Verhalten zu nennen: Es begann damit, dass ein Fluggast neben von uns nach einer zusätzlichen Decke fragte, weil er die Klimatisierung von Flugzeugen generell zu kühl fand. Sie wimmelte ihn damit ab, dass sie im Moment keine Zeit hätte, sich darum zu kümmern. Vielleicht würde sie im Laufe des Fluges nachsehen können, aber er sollte sich keine allzu großen Chancen ausrechnen. Es ging damit weiter, dass sie – nach dem Start – mit einem weiteren Passagier klönte und dabei kein gutes Haar an ihrem derzeitigen Arbeitgeber ließ. Solch ein Verhalten finde ich unprofessionell und unnötig. Als wir dann unsere Mahlzeiten bekamen, verzichtete Franziska auf ihre Portion, weil sei immer noch satt war. Allerdings wünschte sie etwas zu trinken. Da sie kein Tablett mit Geschirr bekommen hatte, war sie derzeit auch nicht im Besitz eines Bechers, was zu folgendem Dialog führte:
F: „I’d like some tea, please.“ („Ich hätte gerne Tee.“)
S: „Where is you cup?“ („Wo ist Ihr Becher?“)
F: „I didn’t eat.“ („Ich habe nicht gegessen.“)
S: „So you don't have a cup.“ („Also haben Sie keinen Becher!“)
F: „Then you have to fetch one!“ („Dann müssen Sie einen holen!“)
Die Entrüstung ob der Tatsache, dass wir von dieser Dame tatsächlich verlangten, ihren Job zu machen, war schockierend. Wir waren erst einmal baff. Ab diesem Moment stand für uns fest, dass wir, obwohl der deutschen Sprache mächtig, uns mit dieser Stewardess ausschließlich auf Englisch unterhalten würden. Sie fand im Laufe der sechs Flugstunden heraus, dass wir aus Deutschland stammen, doch selbst als sie uns in dieser Sprache ansprach, antworteten wir auf Englisch. Es war uns einfach zu peinlich, diesen nationalen Zusammenhang zuzugeben.
Das Essen war jedenfalls lecker, wie ich es von Emirates mittlerweile nicht mehr anders erwarte:

Wieder in Deutschland (das waren noch einmal insgesamt 12.923 Kilometer Flugstrecke mehr) stellten wir fest, traf uns der Kulturschock dann doch unvorbereitet. Die Annahme, dass Japan eine Linderung verschaffen könnte, stellte sich als falsch heraus. Was im Flugzeug angefangen hatte, ging im Terminal weiter. Leute drängelten und schubsten, wollten überall zuerst sein. Jeder hatte es eilig.
Eilig sich in einer Schlange anzustellen, um durch die Passkontrolle zu gelangen. Zum ersten Mal seit Monaten durften wir uns in die Schlange mit „nicht ausländischem“ Pass einreihen. In unserem üblichen Tempo, das nun wirklich nicht als zögerlich zu bezeichnen war, stapften wir zum Schalter, der in zwei Reihen geteilt war. Plötzlich tauchte ein Mann rechts von uns auf, zog einen halben Schritt schneller an uns vorbei, gab uns einen Blick zwischen Schreck und Verachtung und stellte sich einen fußbreit vor uns in die Schlange. Nun, er stand mehr neben als vor uns, ignorierte uns aber so offensichtlich, dass es schon peinlich war. Wir sahen uns verwirrt an. Wahrscheinlich hatte er dringende Termine. Parallel zu uns wuchs eine zweite Schlange. Wir fanden es seltsam, dass die Leute sich nicht einfach in eine Schlange stellten, um dann an den nächsten freien Schalter vorzutreten.
Eilig zum Gepäckband zu kommen, obwohl noch gar kein Gepäck drauf war. Als ich unser Gepäck holen wollte, weil ich es ankommen sah, hatte ich Probleme durch die wartende Menschenmenge durchzukommen, die offensichtlich nur dastand. Anscheinend waren ihre Sachen noch nicht da, aber das hieß nicht, dass sie einen Schritt vom Förderband zurücktreten würden. Vielleicht glaubten die Leute, ich würde ihnen ihren Platz am Band wegnehmen oder so ähnlich. Selbst als ich mit zwei Rucksäcken beladen zurück durch die Menge wollte, machte man mir nur widerwillig Platz. Jemand, der mir mit dem Gepäckwagen vors Schienenbein fuhr, weil er mit seinem Handy spielen musste, entschuldigte sich nicht einmal. Es war erschreckend. Ein Hauen und Stechen als stünde der Jüngste Tag vor der Tür.
Wir fragten uns, wann der nächste Flug nach Seoul ging. Schließlich hatten wir all unsere Habe, seufzten traurig und begaben uns zum Ausgang.
Und dann… waren wir wieder zu Hause. So langsam dämmerte uns, dass diese sieben Monate währende Reise tatsächlich zu ihrem Ende gekommen war. Vorerst würden wir hier bleiben…
Vielen Dank an alle meine Leser. Bei meiner nächsten Reise in die Ferne werde ich den Blog einfach fortsetzen.
Zum Abschluss noch ein schönes Foto von Europa aus dem Flugzeug.

* (Bei dieser Statistik griff ich auf das FIN [Franziska’s Institute of Numbers] zurück und bedanke mich für die Kooperation.)
Wir stolperten in die vierte Etage des Hostels, packten unsere Rucksäcke, verabschiedeten uns vom Personal und brachen Richtung Flughafen auf. Die Anbindung hatten wir schon Tage zuvor herausgesucht (bei der Ankunft, um genau zu sein) und planten heute genug Zeit ein, um auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein. Es trafen keine ein, alles lief reibungslos, man ließ uns anstandslos das Land verlassen. So saßen wir mal wieder an einem Flughafen, gaben unsere Gepäck zum – vorerst – letzten Mal auf und begaben uns zu unserem Gate. Dieses Mal allerdings war etwas anders: Wir hatten Spaß. Es war diese Art von Spaß, die man hat, wenn man eine phantastische Zeit verbrachte, sich darüber im Klaren ist, dass man bald wieder in einen weniger abenteuerlichen Alltag zurückkehrt, und daher die letzten Momente noch auskosten will. Außerdem hatte Korea einen bleibenden Eindruck hinterlassen und saß uns immer noch in den Knochen. Um dies gebührend offenzulegen, feierten wir unsere Zeit mit vielen sinnlosen Fotos.
Da unser Flug recht spät startete, stellte ich mich mental auf einen langen, jedoch unruhigen Schlaf ein. Unsere Fluggesellschaft war mal wieder Emirates, so dass ich mir zumindest vom Essen viel versprach. Wenn man von meiner Erwartungshaltung ausgeht, wurde ich bitter enttäuscht. Tatsächlich war ich jedoch erleichtert. Nach einem Mitternachtssnack schickten sich die meisten Fluggäste zur Nachtruhe, mich eingeschlossen. Das Beste daran war die Anzahl der Passagiere: Obwohl es eine vergleichsweise kleine Maschine war, gab es nicht viel Gäste, wodurch teilweise ganze Sitzreihen leer waren. Selbstverständlich nutzte ich diese Gelegenheit schamlos aus und legte mich zum Schlafen hin. Dank des richtigen Aufklebers wurde ich rechtzeitig zu allen Mahlzeiten geweckt. Auch wenn es ein unruhiger Schlaf war, hatte ich mehr davon als auf den vergangenen Flügen und war tatsächlich ein bisschen erholt.
Dann kamen wir – erneut – in Dubai an und hatten – erneut – mehrere Stunden totzuschlagen. Dieses Mal hatten wir allerdings den Vorteil, dass wir uns bereits auskannten und darüber hinaus wacher als beim vorhergehenden Aufenthalt waren, was zugegebenermaßen keine Herausforderung war. Außerdem beinhaltete unser Flugticket heute einen Essensgutschein für einen kostenlosen Snack inklusive Getränk bei Costa Coffee (oder einen anderen Anbieter einer überschaubaren Liste), was wir uns nicht entgehen ließen. Es sah so aus, dass andere Leute ebenfalls diesen Gutschein erhalten hatten, wodurch die Schlange bei Costa Coffee länger als gewöhnlich war. Aber wir hatten sonst nicht viel zu tun. Wir fragten zuerst, was wir mit diesem Gutschein überhaupt erwerben durften, weil die Formulierung recht vage gehalten wurde.
Für meine Reisebegleitung entstand das Problem, dass alle Sandwiches, aus denen wir aussuchen konnten, eine Zutat enthielten, die ihren Gaumen ganz und gar nicht erfreute: Tomaten. Da alles Essen abgepackt war und im besten Fall nur kurz in einem kleinen Elektrogrill erwärmt wurde, gab es keine Möglichkeit der Sonderwünsche. Wir einigten uns schlicht darauf, dass sie die Tomaten weglassen musste.
So sah unser Frühstück in Dubai aus:


Es war gar nicht schlecht. Für den Preis sogar erstaunlich gut. Also alles in allem genau das, was man in Dubai erwarten würde. Außerdem half es uns dabei, ein bisschen Zeit rum zu bekommen.
Aufgrund des hohen Andrangs bei Costa Coffee wollten wir die Plätze nicht länger als nötig belegen, so dass wir zügig aßen und uns wieder auf den Weg durch den Flughafen von Dubai machten. Ich spazierte erneut durch dieses riesige Gebäude mit exotischem und teurem Dekor, machte Fotos (von denen ich nicht weiß, ob ich sie online stellen darf), verschickte eine Postkarte (die tatsächlich ankam – im Gegensatz zu jener aus Indonesien) und wartete auf unseren letzten Flug. Es war keine besonders spannende Zeit.
Beim Boarding gab es dann doch eine Überraschung. Zwischen unserem Flugticketkauf und unserem Rückflug aus Dubai war fast ein Jahr ins Land gezogen. In dieser Zeit hatte Emirates zwei Flüge zusammengelegt und sich einige Flugzeuge des Typs Airbus A380 besorgt, was für uns zur Folge hatte, dass unsere Sitzplatzwünsche überhaupt keine Berücksichtigung gefunden hatten. Anstatt also am Gang und einen daneben, bekamen wir den Fensterplatz und einen daneben. Der arme Tropf, der jetzt zwischen uns und dem Gang saß, tat mir beinahe leid. Das verging allerdings schon bald.
Entweder war dieser Flug nur für Deutsche reserviert oder aber wir saßen in dem Teil mit der größten Konzentration dieser Nationalität. Wie dem auch sei, wir wussten schon von Anfang an, wohin die Reise ging. Alle Leute um uns herum waren gereizt, meckerten, beschwerten sich und hatten es eilig. Der Urlaub war offensichtlich vorbei.
Zu allem Überfluss hatten wir auch noch eine reizende Flugbegleiterin. Reizend in dem Sinn, dass sie mich reizte. Schon von weitem fiel sie durch einen Teint auf, der zwischen brathähnchengold und orange lag. Ihr Lächeln war eine verzerrte Grimasse, die aus einem Tim Burton Film zu stammen schien. Alternativ dazu fletschte sie ab und an die Zähne, als wollte sie ihr Revier gegen mögliche Eindringlinge verteidigen. Das Make-Up dieser Stewardess erinnerte mich an eine Dreizehnjährige, die mit Hilfe ihrer Buntstifte zu einer Barbie mutieren wollte. Ihr Verhalten den Fluggästen gegenüber war im besten Fall taktlos, im schlimmsten unverschämt. Irgendetwas an dieser Person strahlte etwas Vertrautes aus. Wir hegten unsere Theorien, tuschelten miteinander und waren entsetzt, als sie sich als wahr herausstellten: Die Dame war Deutsche.
Um nur einige Beispiele für ihr unangebrachtes Verhalten zu nennen: Es begann damit, dass ein Fluggast neben von uns nach einer zusätzlichen Decke fragte, weil er die Klimatisierung von Flugzeugen generell zu kühl fand. Sie wimmelte ihn damit ab, dass sie im Moment keine Zeit hätte, sich darum zu kümmern. Vielleicht würde sie im Laufe des Fluges nachsehen können, aber er sollte sich keine allzu großen Chancen ausrechnen. Es ging damit weiter, dass sie – nach dem Start – mit einem weiteren Passagier klönte und dabei kein gutes Haar an ihrem derzeitigen Arbeitgeber ließ. Solch ein Verhalten finde ich unprofessionell und unnötig. Als wir dann unsere Mahlzeiten bekamen, verzichtete Franziska auf ihre Portion, weil sei immer noch satt war. Allerdings wünschte sie etwas zu trinken. Da sie kein Tablett mit Geschirr bekommen hatte, war sie derzeit auch nicht im Besitz eines Bechers, was zu folgendem Dialog führte:
F: „I’d like some tea, please.“ („Ich hätte gerne Tee.“)
S: „Where is you cup?“ („Wo ist Ihr Becher?“)
F: „I didn’t eat.“ („Ich habe nicht gegessen.“)
S: „So you don't have a cup.“ („Also haben Sie keinen Becher!“)
F: „Then you have to fetch one!“ („Dann müssen Sie einen holen!“)
Die Entrüstung ob der Tatsache, dass wir von dieser Dame tatsächlich verlangten, ihren Job zu machen, war schockierend. Wir waren erst einmal baff. Ab diesem Moment stand für uns fest, dass wir, obwohl der deutschen Sprache mächtig, uns mit dieser Stewardess ausschließlich auf Englisch unterhalten würden. Sie fand im Laufe der sechs Flugstunden heraus, dass wir aus Deutschland stammen, doch selbst als sie uns in dieser Sprache ansprach, antworteten wir auf Englisch. Es war uns einfach zu peinlich, diesen nationalen Zusammenhang zuzugeben.
Das Essen war jedenfalls lecker, wie ich es von Emirates mittlerweile nicht mehr anders erwarte:

Wieder in Deutschland (das waren noch einmal insgesamt 12.923 Kilometer Flugstrecke mehr) stellten wir fest, traf uns der Kulturschock dann doch unvorbereitet. Die Annahme, dass Japan eine Linderung verschaffen könnte, stellte sich als falsch heraus. Was im Flugzeug angefangen hatte, ging im Terminal weiter. Leute drängelten und schubsten, wollten überall zuerst sein. Jeder hatte es eilig.
Eilig sich in einer Schlange anzustellen, um durch die Passkontrolle zu gelangen. Zum ersten Mal seit Monaten durften wir uns in die Schlange mit „nicht ausländischem“ Pass einreihen. In unserem üblichen Tempo, das nun wirklich nicht als zögerlich zu bezeichnen war, stapften wir zum Schalter, der in zwei Reihen geteilt war. Plötzlich tauchte ein Mann rechts von uns auf, zog einen halben Schritt schneller an uns vorbei, gab uns einen Blick zwischen Schreck und Verachtung und stellte sich einen fußbreit vor uns in die Schlange. Nun, er stand mehr neben als vor uns, ignorierte uns aber so offensichtlich, dass es schon peinlich war. Wir sahen uns verwirrt an. Wahrscheinlich hatte er dringende Termine. Parallel zu uns wuchs eine zweite Schlange. Wir fanden es seltsam, dass die Leute sich nicht einfach in eine Schlange stellten, um dann an den nächsten freien Schalter vorzutreten.
Eilig zum Gepäckband zu kommen, obwohl noch gar kein Gepäck drauf war. Als ich unser Gepäck holen wollte, weil ich es ankommen sah, hatte ich Probleme durch die wartende Menschenmenge durchzukommen, die offensichtlich nur dastand. Anscheinend waren ihre Sachen noch nicht da, aber das hieß nicht, dass sie einen Schritt vom Förderband zurücktreten würden. Vielleicht glaubten die Leute, ich würde ihnen ihren Platz am Band wegnehmen oder so ähnlich. Selbst als ich mit zwei Rucksäcken beladen zurück durch die Menge wollte, machte man mir nur widerwillig Platz. Jemand, der mir mit dem Gepäckwagen vors Schienenbein fuhr, weil er mit seinem Handy spielen musste, entschuldigte sich nicht einmal. Es war erschreckend. Ein Hauen und Stechen als stünde der Jüngste Tag vor der Tür.
Wir fragten uns, wann der nächste Flug nach Seoul ging. Schließlich hatten wir all unsere Habe, seufzten traurig und begaben uns zum Ausgang.
Und dann… waren wir wieder zu Hause. So langsam dämmerte uns, dass diese sieben Monate währende Reise tatsächlich zu ihrem Ende gekommen war. Vorerst würden wir hier bleiben…
Vielen Dank an alle meine Leser. Bei meiner nächsten Reise in die Ferne werde ich den Blog einfach fortsetzen.
Zum Abschluss noch ein schönes Foto von Europa aus dem Flugzeug.

* (Bei dieser Statistik griff ich auf das FIN [Franziska’s Institute of Numbers] zurück und bedanke mich für die Kooperation.)
... link (1 Kommentar) ... comment
Sonntag, 26. Juni 2016
Tokyo – August-September 2015
atimos, 23:19h
Am Morgen unserer Abreise aus Kyoto standen wir zeitig auf, aßen ein einfaches Frühstück, verabschiedeten uns von den Inhabern (sie bestanden auf ein Abschiedsfoto) und zogen los Richtung Kyoto Hauptbahnhof, um von dort unseren Bus nach Tokyo zu nehmen. Die wenigen Haltestellen mit der U-Bahn vergingen schnell, so dass wir uns innerhalb weniger Minugen in dem riesigen Komplex Kyoto Hauptbahnhof befanden. Um diese Uhrzeit waren die meisten Geschäfte und Schalter noch geschlossen, wodurch man beinahe den Eindruck einer postapokalyptischen Landschaft bekommen konnte. Es war nur zu sauber und ordentlich. Andrerseits, es war Japan, da konnte ich mir schon vorstellen, dass es nach der Apokalypse weiterhin so sauber war.
Dank präziser Beschreibung des Haltestellenstandpunktes wussten wir unser Ziel einzuschätzen: gegenüber des Bahnhofs vor dem Ibis-Hotel. Wir wussten zwar, wo sich die Haltestelle befand, nicht aber wie wir unseren Weg dorthin finden würden. Sinnvolle Wegweiser gab es nicht. Ich wage mittlerweile zu behaupten, dass der Hauptbahnhof in Kyoto meine neue Nemisis geworden ist und Kaufhäuser damit abgelöst hat. Selbst im Lotte Department Store fühlte ich mich niemals so verloren.
Zu unserem Bedauern gab es zu dieser frühen Stunde auch niemanden, den wir um Hilfe hätten bitten können. Die wenigen Gestalten, die außer uns durch den Bahnhof huschten, gaben sich große Mühe uns nicht zu nahe zu kommen. Wir stapften also drauf los, hielten an einem Umgebungsplan, lasen Schilder, sahen uns um, stapften weiter, fanden jemanden, den wir fragen konnten – erfolglos – gingen raus, sahen uns um, stellten fest, dass es in Strömen regnete, fanden das Hotel, sahen eine Baustelle, die uns von diesem trennte, folgten den Umleitungsschildern für Fußgänger, erinnerten uns an den Linksverkehr in Japan, übersahen beinahe die Ampel, wurden klatschnass, weil wir keine Regenschirme hatten, überquerten die Straße und stellten uns am Hotel schließlich unter. Wir hatten es geschafft!
Von der U-Bahn- bis zur Bushaltestelle brauchten wir 25 Minuten. Da wir ein solches Szenario an diesem Bahnhof erwartet hatten, waren wir sehr früh aufgebrochen, wodurch wir nun immer noch eine beachtliche Wartezeit hatten. Außerdem fuhr die U-Bahn um die Uhrzeit noch nicht in so dichtem Takt. Wir wollten kein Risiko eingehen.
Deutsch-pünktlich (also fünf Minuten vor der eigentlichen Uhrzeit) fuhr der Willer Expressbus Richtung Tokyo an unserer Haltestelle ein. Der Fahrer überprüfte unsere Namen und Fahrkarten, half uns beim Einladen des Gepäcks, gab uns unsere Sitznummern und wir nahmen die längste Busreise seit Beginn dieses Abenteuers auf uns. Neun Stunden waren hierfür angesetzt. Für diese lange Fahrt hatte man für die Gäste eine Erholungshilfe in Form von Schlafhauben eingebaut. Jeder Sitz verfüge über solch eine Vorrichtung. Egal, wie hell es im Bus oder draußen war, man hatte seine eigene, private, kleine, dunkle Nische, wenn man schlafen wollte.

Es dauerte nicht lange, da stellte sich bei uns der Fernreisetrott ein. Wir starrten aus dem Fenster, unterhielten uns, nickten weg, betrachteten die verregnete Landschaft und staunten immer wieder darüber, wie wenige Autos auf den Straßen zwischen den Städten unterwegs waren. Stellenweise fühlte ich mich an Franz Josef erinnert.

Wie wir feststellten, waren die Fernbusfahrer in Japan äußerst verantwortungsbewusst, was dazu führte, dass wir mehrere Gelegenheiten zu einer ausgiebigen Pause hatten. Auf diese Weise lernten wir japanische Rasthöfe kennen. Es war ein spannendes und nennenswertes Erlebnis. Es begann damit, dass wir auf Rastplätzen verschiedener Größen hielten. Nichtsdestotrotz war ein jeder von ihnen gepflegt, bot Toiletten in ausreichender Anzahl und immer auch eine Möglichkeit sich etwas Essbares zu kaufen. Wahrscheinlich plante der Fahrer – oder sein Unternehmen – die Pausen so, damit genau diese Kriterien erfüllt waren.
Was uns beide faszinierte, waren die Toiletten. Obwohl mitten im Nirgendwo gelegen, waren es stellenweise High-Tech-Anlagen mit Optionen, von denen ich in Deutschland nicht einmal zu träumen wagen würden. Es fing recht harmlos an mit einem belegt/frei-System, das an ein modernes Parkhaus erinnerte.

Dann fanden wir Alters- und Größengerechte Waschbecken sowie Schminktische. Kindgerecht, altersgerecht, benutzerfreundlich. Es war alles auch sehr stylisch aufgebaut.

Lustiger wurde es, als wir in den Kabinen Instruktionen fanden. Dabei ging es nicht nur um den Gebrauch des High-Tech-Toilettensitzes mit diversen Funktionen, sondern auch um den japanisch korrekten Gebrauch der Toilette an sich.

(Da man die Beschriftungen auf diesem Foto nicht lesen kann, fasse ich das Nennenswerte hier zusammen: Bitte abspülen (zweimal); Bitte das Toilettenpapier nur in dieser Kabine benutzen und nicht in eine andere mitnehmen)
Das beste Feature war allerdings ein Bildschirm, den wir am Eingang einer Einrichtung vorfanden:

Er zeigte den Besuchern nicht nur an, wo welche Kabine gerade frei war, nein, er informierte einen auch über die Ausstattung selbiger. Es gab westliche und japanische Toiletten, behindertengerechte und solche mit Kindersitz für Eltern, die ihre Kleinen nicht in jemandes Obhut lassen konnten oder wollten. Brillante Idee.
Nach viel zu vielen Stunden endlich in Tokyo, Shinjuku, angekommen, standen wir erneute vor der Aufgabe, mit der Bahn zu fahren. Immerhin war unser Ziel Asakusabashi – also fast das andere Ende der Stadt. Wir versuchten es gar nicht erst irgendwie selbst herauszufinden, sondern fragten gleich den nächsten Mitarbeiter am Schalter. Es war spät, wir waren müde und hatten Gepäck dabei. Ein freundlicher Mitarbeiter sagte uns sowohl welche Bahn wir nehmen mussten, als auch wo wir das Ticket dafür erstehen konnten. Mit diesen Informationen war es ein Kinderspiel.
Glücklicherweise war es von der Haltestelle Asakusabashi bis zu unserer Herberge nicht weit. In wenigen Minuten standen wir vor dem Gebäude, in dem sich das Anne Hostel Asukasabashi befand, gingen rein und wunderten uns, dass niemand an der Rezeption saß. Ein Schild setzte uns darüber in Kenntnis, dass die eigentliche Rezeption sich im vierten Stock befand und wir gerne dafür den Aufzug nutzen durften. Dieser war allerdings so klein, dass wir gerade so zu zweit mit Gepäck hinein passten. Als wir auf besagter Etage ankamen, musste ich rückwärts rausgehen, weil der Platz zum Drehen nicht reichte. Egal, wir waren sicher angekommen.
In einem viel zu kleinen Kämmerlein störten wir gerade eine Person beim Essen.

Es war ein junger Mann, der uns trotz vollem Munde freundlich begrüßte. Er stellte die üblichen Fragen, wer seid ihr, woher kommt ihr, wo ward ihr, etc., während er unsere Reservierung prüfte. Allerdings brachte dieser Mitarbeiter sich selbst in eine moralische Schieflage, als er an den Grundfesten seines Weltbilds rüttelte, indem er uns die Frage stellte, wo es uns am besten gefallen hatte. Wahrheitsgemäß antworteten wir, dass Korea uns im Sturm erobert hatte, was dazu führte, dass der junge Mann sich beinahe an seinem Essen verschluckte. Ungläubig fragte er uns, warum dem so war. Die Antwort schien ihm auch nicht sonderlich zu gefallen. Wir hatten keinen guten ersten Eindruck hinterlassen. Doch professionell, wie er war, geleitete er uns zu unserem Zimmer und erklärte uns die Regeln der Herberge.
Am Eingang zu jeder Etage gab es eine Grenze, an der man seine Schuhe zurücklassen musste. Die Schlappen auf dem Schuhregal dienten auch nur dazu, um schnell zwischen den Etagen hin und her zu laufen, denn die eigenen Schuhe durfte man dort nicht abstellen. Stattdessen musste man sie in den Schließfächern vor den Zimmern unterbringen. Besagte Schließfächer rochen dementsprechend. Nachdem uns der Schlüssel übergeben wurde, machten wir es uns in unseren Betten so gemütlich wie es nur ging. Das war in Anbetracht der Umstände schon eine gewisse Herausforderung, da wir nicht mehr Platz als in OKI’s Inn hatten. Vier Betten in einem Zimmer, das für höchstens zwei ausgelegt war.

Aber man hatte sich beholfen, indem man in jedem Bett ein Regal am Fußende eingebaut hatte. Natürlich konnte man das auch als Tisch nutzen. Immerhin waren die Betten breit genug, um gemütlich drin zu schlafen. Allerdings hatten die Japaner das Prinzip von Kissen noch nicht so ganz verstanden. Während ich noch eine zwei Finger dicke Unterlage hatte, war Franziskas Exemplar von seltsamem Format. Zwar waren die Außenseiten rund zwei Finger dick, aber in der Mitte war ein Loch. Es schien einfach durchgelegen. Als Franziska nach Ersatz fragte, weil dieses Kissen nur Spott und Hohn war, guckte man sie an der Rezeption groß an und erklärte ihr, dass alle Kissen so seien. Wir hatten unsere Zweifel, das zu glauben. Es dauerte einige Zeit, bis man Ersatz gefunden hatte, und wir wurden eines Besseren belehrt: Auch dieses Kissen hatte ein Loch in der Mitte. Letzten Endes diente es nur den Schein zu wahren.
Lange blieben wir nicht auf unserem Zimmer. Denn die Reise hatte mich hungrig hinterlassen, wodurch wir uns erdreisteten, den jungen Mann erneut zu behelligen und ihn mit Fragen bezüglich der Umgebung, insbesondere Essensmöglichkeiten zu malträtieren. Mir tat der Mensch, der nicht in Ruhe essen konnte, beinahe leid. Doch er erfüllte seine Aufgabe hervorragend, sagte uns, wo es Restaurants gab, wies aber auch darauf hin, dass sie womöglich geschlossen waren. So langsam gewöhnte ich mich an den Gedanken, auch wenn er mir einen kalten Schauer über den Rücken jagte. Wir brachen auf.
Der Einfachheit halber fasse ich nun alles Essen in Tokyo in einem Block zusammen.
Nichtsdestotrotz wagten wir uns in die dunkle Wildnis der Tokyoer Innenstadt, um ein warmes Mahl zu ergattern. Zuerst gingen wir auf die Hauptverkehrsstraße zu. Dann sahen wir uns um. Es war recht düster und bedrückend, was ausschließlich daran lag, dass so wenig Licht vorhanden war. Außerdem gingen nur wenige Leute die nasse Straße entlang. Nach einigem hin und her und Suchen fanden wir schließlich ein ansprechendes und geöffnetes Restaurant im ersten Stockwerk, in das wir sogleich einkehrten.
Als wir eintraten, begrüßte uns schon ein Kellner, der uns schnell einen Tisch zuwies. Es gab einige Kleinigkeiten, die uns ins Auge fielen: am Tisch gab es einen Klingelknopf, mit dem man den Keller rufen konnte; sehr viele Leute saßen alleine an Einzeltischen; eine Anzeige über der Kasse zeigte an, welcher Tisch als nächstes bedient werden würde.
Nach kurzer Betrachtung der Speisekarte entschieden wir uns für zwei unterschiedliche Gerichte, damit wir möglichst viel probieren konnten. Während Franziska sich für eine vegetarische Variante entschied, nahm ich Katsu Don.


Das Essen war zwar gut, die Portion für mich allerdings entschieden zu klein, was meine Reisebegleitung aufzubessern versuchten, indem sie mir ihre Miso-Suppe gab. Gleichwohl war es schon bald Zeit, das Mahl zu beenden und uns auf den Weg zurück zur Herberge zu machen. Für den kleinen Hunger zwischendurch gab es unterwegs noch einen 7/11-Supermarkt. (Ja, es war auch unsere bevorzugte Bank.)
Ich genoss das Frühstück in unserer Herberge sehr. Es gab ein All-you-can-eat-Buffet mit Tee, Toast, Eiern und verschiedenen Sorten Marmelade. Was mir besonders daran gefiel, war der All-you-can-eat-Aspekt. Keine Einschränkungen, keine Überwachung, keine Restriktionen. Man kam morgens in den Aufenthaltsraum, nahm sich Teller und Lebensmittel, setzte sich und stand auf, wenn man fertig war. Sie baten darum, dass man sein Geschirr selbst spülte, aber das war nun wirklich kein Aufwand für diesen Service.

Da wir schon einmal in dem Heimatland von Tenpura waren, bestanden wir beide darauf, dieses köstliche Gericht in seinem Original zu probieren. Ich möchte hier anmerken, dass die japanischen Restaurants in meiner Heimatstadt Düsseldorf auch mitunter hervorragend sind, weil wir eine der größten japanischen Gemeinden außerhalb Japans haben, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass wir zum Ursprung zurückkehren wollten. Die weitberühmte Touristenmeile Asakusa war nur zwei Haltestellen entfernt, was es uns einfach machte einen Ausflug mit einem schmackhaften Mittagessen zu verbinden. Es gab verschiedene Varianten von Tenpura auf Nudeln, wobei wir uns für – wie gewohnt – verschiedene Menüs entschieden, um uns austauschen zu können. Es war hervorragend.

An unserem vorletzten Tag in Tokyo suchten wir händeringend nach einem geeigneten Lokal für unser Mittagessen. Noch bevor wir einen Fuß in die Hauptstad Japans gesetzt hatten, war es beschlossene Sache, dass wir nicht kochen würden – aus Prinzip. Leider erwies sich das aufgrund mangelnder Lokalitäten immer wieder als Problem, zumal ich kalten Reis nicht mehr sehen konnte. Doch an einem der unwahrscheinlichsten Orte fanden wir dann doch ein noch unwahrscheinlicheres Restaurant: Im inneren Bereich der riesigen Haltestelle Ueno, also hinter den Ticketkontrollen, betraten wir ein indisches Restaurant, das auf schnellen Durchgangsverkehr eingestellt war. Wir entschieden uns für ein großes Fladenbrot mit unterschiedlichen Saucen und gemischtem Krautsalat. Das Ganze wurde auf einer Cafeteria-Platte aus Edelstahl serviert. Es war sehr schmackhaft, aber für mich dann doch zu wenig, weshalb ich mir mit einem großen Nachtisch half.

Auch in Tokyo ergab sich für uns die Möglichkeit bei CoCoCurry einzukehren.

Die Größe der Reisportion verriet für gewöhnlich, wer welches Menü bestellte.
Damit war unsere kulinarische Reise in Tokyo auch schon abgeschlossen. Immerhin verbachten wir nur drei Tage in der Hauptstadt, was vor allem durch die lange Reise verschuldet war. Es war dennoch ein lohnenswerter Ausflug.
Während wir in Tokyo waren, ergab sich die Gelegenheit ein Volleyballspiel zu sehen. Der Fernseher im Aufenthaltsraum lief die ganze Zeit und wir waren gerade im Begriff unseren sozialen Verpflichtungen nachzukommen. Der einzige Grund, warum es uns nur ansatzweise interessierte, war, dass das Match zwischen Japan und Korea ausgetragen wurde. Die weiblichen Vertreter spielten gegeneinander. Wir beschlossen, uns diesen Spaß anzusehen.
Mit uns im Raum saß ein französischer Tourist, der seine Loyalität offen zur Schau trug. Eine große japanische Flagge war um seine Schultern geschlungen. Als wir ins Gespräch kamen und ihm offenbarten, dass wir für das koreanische Team waren, sprudelte pure Entrüstung aus ihm heraus, die er aufgrund seines schieren Unglaubens nur stotternd hervorbringen konnte. Seine Argumentationsweise hingegen war fadenscheinig. Er meinte, weil er gerade in diesem Land sei, Japan, wäre es nur natürlich für die japanische Mannschaft zu sein. Ich fragte mich, ob er nicht zugeben wollte, dass Manga und Anime sein Herz erfüllten, oder ob er sich einfach nur bei den Einheimischen einschleimen wollte. Wie dem auch sei, eine gespannte Stimmung entbrannte in dem kleinen Raum. Obwohl wir die meiste Zeit nur zu dritt waren, konnte man die Spannung fast schon greifen. Ich übertreibe. Nichtsdestotrotz wurde aus seiner Prophezeiung, dass dies eine einfache Partie für Japan werden würde, nichts. Die Koreanerinnen schlugen sich mitunter sehr gut, ließen zum Schluss allerdings nach. Ich holte zwischendurch Abendessen, so dass wir mit Snacks das Spiel genießen konnten. Dank unseres Nachbarn wurde es äußerst unterhaltsam. Als es vorbei war, ließ es sich der junge Mann nicht nehmen, seine Freude ob des japanischen Sieges offen zur Schau zu tragen. Wir schmunzelten.
Asakusa
Natürlich führte kein Weg an Asakusa vorbei, wenn wir uns wie richtige Touristen benehmen wollten. Da Franziska diese Touristenmeile noch nicht kannte, stand sie ganz oben auf unserer Liste. So brauchen wir eines Tages auf, uns ins Getümmel zu stürzen und diesen Ort auf uns wirken zu lassen. Für all jene, denen Asakusa kein Begriff ist, versuche ich die Umgebung in Worte zu fassen.
Es war ein Teil der Stadt, in dem traditionell gebaute Gebäude auf den Konsumdrang unserer Generation trafen. Das riesige Eingangstor war mehr Zierde denn funktioneller Natur.

Menschenmassen umströmten diesen Koloss, gingen hindurch und daran vorbei, blieben stehen, um Fotos zu machen (so wie wir), wuselten sich durch die Menge, zu der sie selbst gehörten. Trotzdem war es nicht ganz so voll, weil die Saison sich gerade ihrem Ende neigte.
Hinter diesem Tor breitet sich eine breite Straße aus, die links und rechts von kleinen Hütten gesäumt wurde.

Diese Hütten beherbergten Verkaufsstände und Geschäfte jeglicher Art. Man konnte hier allerlei Souvenirs kaufen, denn es war für jeden Geschmack etwas dabei. Von wirklich nützlich und schick hin zu Blödsinn, den man bestenfalls an die fünfjährige Nichte mit Glittermanie weitergeben konnte. Wie beispielsweise wunderbar verzierte Stäbchen. Daneben fand sich Krimskram, den wirklich kein Mensch braucht, wie beispielsweise Miniquietschkatanas.
Hatte man einmal diesen Verkaufswahnsinn hinter sich gebracht, kam man durch ein zweites Tor auf einen Vorhof, an dem nur noch spirituelle Kleinigkeiten erworben werden konnten. Am Ende dieses Hofes stand ein großer Tempel.

Wir drehten einen Runde, betrachteten alles, inklusive Nebenstraßen, machten Pausen, machten Fotos und kauften einige Kleinigkeiten. Franziska fand einige Accessoires für ihr Bento; auf mich warteten einige Flaggen, die ich an meinen Globetrotterhut nähen konnte.
An dieser Stelle möchte ich noch erwähnen, dass Asakusa nicht aus bloß dieser einen weitberühmten Einkaufspassage bestand. Es gab zahlreiche Straßen und Gässchen drum herum, die uns ein vielfältiges Angebot boten. Es gab eine Mischung aus alt aussehenden und neueren Gebäuden, die in teils kuriosen Arrangements nebeneinander standen.

Wenn man sich ein bisschen Zeit nahm und die Gegend um dies eine Straße herum erkundete, konnte man interessante Sachen finden. Daher rate ich jedem Interessenten, sich für einige Zeit von den Massen abzukapseln und eigene Wege zu gehen. Alternativ kann man auch eine Rikscharundfahrt machen. Wir waren zu Fuß allerdings gut unterwegs und erledigten alles auf unsere Weise, bevor wir wieder weiterzogen.
Unsere Abenteuer mit dem Schienennetz nahm einfach kein Ende. Wir wollten von Asakusabashi nach Tokyo Station fahren. In der U-Bahnhaltestelle fand sich auch ein schöner Plan, den ich sogar lesen konnte. Auf diesem stand geschrieben, dass wir zweimal umsteigen und insgesamt 280 Yen pro Person bezahlen müssten. Leider spuckte der Automat keine Fahrkarten mit diesem Betrag aus, so dass wir uns gezwungen sahen, einen Bahnangestellten zu behelligen. Dieser klärte uns darüber auf, dass wir nicht, wie geplant, mit der U-Bahn fahren konnten, sondern die JR nehmen mussten. Die Haltestelle dieses Verkehrsunternehmens befand sich außerhalb des Gebäudes. Er wies uns den Weg und ließ uns von dannen ziehen.
Der Fahrplan in der JR-Haltestelle war alles andere als leserlich, da keiner von uns Kanji verstand, was dazu führte, dass wir den nächsten Angestellten behelligen mussten, um zu erfahren, wie wir zu unserem Ziel gelangen könnten. Dafür mussten wir uns erst einmal in eine Schlange stellen. (Schlangestehen scheint Nationalsport in Japan zu sein, denn die Japaner machen es bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Es erinnerte mich ein bisschen an den Kommunismus in Polen, als die Leute sich sofort in eine Schlange stellten, als sie daran vorbei gingen, weil gerade etwas Nützliches hätte geliefert werden können. Wie dem auch sei.) Der Herr hinter der Glasscheibe erklärte uns nicht nur, welches Ticket wir brauchten, sondern er stellte es aus und wies uns den Weg inklusive der Haltestelle, an der wir umsteigen mussten. Das fanden wir äußerst freundlich und hilfreich.
Was in Tokyo Station und an anderen Plätzen geschah, wird gesondert behandelt, ich möchte mich in diesem Abschnitt nur auf die Fahrerei mit den öffentlichen Verkehrsmitteln konzentrieren.
Die Fahrt von Tokyo Station nach Ueno war fast schon ein Kinderspiel. Die größte Schwierigkeit bestand im Kauf einer Fahrkarte, weil der Liniennetzplan mal wieder nicht in europäischen Buchstaben dargestellt war. Ich frage mich langsam, wie ein Land mit so vielen Touristen pro Jahr es sich überhaupt erlauben konnte, so nachlässig zu sein. Das ist doch Spott und Hohn den Besuchern gegenüber. Niemand soll mir noch einmal mit Servicewüste Deutschland kommen – die Japaner machen uns da enorme Konkurrenz.
Wir fragten die nächste Bahnangestellte, welches Ticket wir brauchten, und kamen nur auf diese Weise an unserem Ziel an.
In der Nähe von Ueno gab es die U-Bahnhaltestellte Ueno -okachimachi, die eine bessere Verbindung mit weniger Umsteigen nach Asakusabashi gewährleistete. Wir fanden die Haltestelle, fanden das richtige Ticket, fanden die Haltestelle zum Umsteigen und fuhren los. Als wir dann in die andere Bahn steigen wollten, stellten wir fest, dass wir dafür die U-Bahn verlassen mussten, 200 Meter oberirdisch einem ausgeschilderten Pfad zu folgen hatten, um dann wieder in das U-Bahnnetz einzutauchen. Dies war aber nicht so einfach, weil man den richtigen Eingang nehmen musste, um am richtigen Gleis anzukommen. Natürlich schafften wir dies nicht auf Anhieb – und fragten somit den nächsten Mitarbeiter, der uns zu unserem Gleis lotste. Dafür mussten wir durch die Kontrolle, bis zum Ende dieses Gleises, dort die Treppe runter, durch die Unterführung und auf der anderen Seite wieder hoch.
Ich fing langsam an die Deutsche Bahn zu vermissen, weil ich dort wenigstens die Beschilderung lesen und die unfreundlichen Mitarbeiter anpflaumen konnte. Glücklicherweise war das System so intelligent, dass wir bei dieser Aktion nicht noch zuzahlen mussten.
Zurück zu Tokyo Station
Ein weiteres Ausflugsziel war der Bahnhof Tokyo. Da wir schon unfreiwilligerweise das Ungetüm in Kyoto hinter uns gebracht hatten, dachten wir uns, dass wir auch einen Blick in das Pendant der Hauptstadt werfen sollten, zumal es als Sehenswürdigkeit angepriesen wurde. Unweit dieses Bahnhofs versprach die Kitte-Mall Einkaufsvergnügen für jedermann. Aus diesem Grund planten wir dort unser Mittagsmahl einzunehmen. In solch einem groß umworbenen Komplex würde sich mit Sicherheit etwas zu essen auftreiben lassen.
Kaum waren wir an der Tokyo Station angekommen, wuselten wir uns durch die Menschenmassen zum richtigen Ausgang, um möglichst zügig an unserem Ziel anzukommen. Wir erwarteten, dass wir noch einige Minuten zu Fuß gehen mussten, doch dem war überraschenderweise nicht so. Kaum waren wir aus dem Bahnhofsgebäude raus, standen wir vor der Mall. Ich blinzelte verwundert. Auf der Stadtkarte sah es weiter weg aus. Wir zuckten die Schultern, überquerten die einzige Straße und tauchten ins Einkaufsvergnügen ein.
Oder auch nicht. Die Kitte-Mall war… ernüchternd.

Es erinnerte mich stark an die Arkaden zu Hause, in Deutschland. Funktional, schmucklos, mittlerweile wenigstens hell, wahrscheinlich mit einem Designer-Stempel irgendwo drauf, aber trotzdem nichts fürs Auge dabei. Ein überdachter Hof, dessen Wände mit Galerien versehen waren, um Geschäfte unterzubringen, lag vor uns. An Stelle von Geländern hinderten gläserne Fassaden die Menschen vor dem Sturz in die Tiefe.
Im Grunde war es ein ausgehöhltes Dreieck, das mit viel Glas und Marmor auf Hochglanz poliert worden war, dabei aber jeglichen Inhalts entbehrte. Es war langweilig und steril. Es mit der Lotte Mall in Busan vergleichen zu wollen, hieße Te Papa mit dem Senkenbergmuseum in Frankfurt zu vergleichen – und das kann ich nicht reinen Gewissens über mich bringen.
Obwohl wir einen Lageplan inklusive Gourmet guide hatten, fiel es uns schwer ein passendes Lokal zu finden, in dem wir hätten essen können. Das lag einfach daran, dass die lecker aussehenden Sachen nicht in unserer Preiskategorie lagen. Aus diesem Grund entschlossen wir uns spontan dafür, irgendwo anders einzukehren, auch wenn wir uns darüber im Klaren waren, dass die Suche noch ein wenig Zeit in Anspruch nehmen könnte. Statt zu speisen erkundigten wir diese Arkaden von oben bis unten.
Immerhin hatten sie versucht, das Dach dieser trostlosen Einrichtung ein bisschen aufzupeppen, indem sie ein bisschen Grün hinstreuten. Dieses Bisschen war aber eine große Fläche, die ausschließlich aus Rasen bestand und nicht betreten werden durfte.

Ich gebe ihnen Punkte für den bloßen Versuch.
Die Aussicht war allerdings nennenswert. Wir hatten von dort oben eine herrliche Sicht auf die Ausmaße des Bahnhofs Tokyo. Er war riesig, pompös und erinnerte an ein längst vergangenes Jahrhundert, obwohl er gerade erst 1914 eröffnet worden war. Beeindruckend war er auf jeden Fall. Die rot-weiße Fassade mit dem schwarzen Dach, das an mehreren Stellen in wuchtigen Kuppeln aufgebäumt war, erweckte den Eindruck eins überragenden Selbstbewusstseins. Um dieses Bauwerk versammelten sich die Hochhäuser des Glas-Beton-Zeitalters. Ich bin mir sicher, dass dieser Prachtbau noch imposanter gewirkt hatte, als die neueren Ungetüme noch nicht darüber thronten. Letztlich war sogar die Kitte-Mall ihren gerade einmal sechs Stockwerken höher.

Nach einiger Verweildauer und einem gründlichen Rundumblick war es für uns Zeit aufzubrechen und weiterzuziehen. Die Zeit drängte, denn wir hatten nur wenige Tage in dieser Metropole zu unserer Verfügung. Wir gingen wieder in den Bahnhof, kauften einen Fahrschein und hofften, in dem riesigen Bereich hinter den Schranken ein Restaurant zu finden. Doch außer einigen To-Go-Schaltern gab es nichts Nennenswertes, weshalb wir uns für die Weiterreise entscheiden. Jedenfalls fanden wir nichts mit Sitzgelegenheiten. Wir nahmen also den nächstbesten Zug Richtung Ueno.
Es ereignete sich etwas, womit ich zu Lebzeiten nicht gerechnet hätte. Der Zug fuhr einfach nicht ab. Wir standen in der Bahn und warteten... und warteten… und warteten. Nach kurzer Zeit kam eine Durchsage, die wir natürlich nicht verstanden, doch die Bahn fuhr immer noch nicht weiter. Wir hatten tatsächlich mehrere Minuten Verspätung! Im Nachhinein erfuhren wir etwas von Personen auf den Gleisen. Selbstverständlich hatte ich Verständnis für den Stillstand des Zuges, aber es war dennoch überraschend.
In Ueno angekommen, standen wir nun wieder in diesem Bereich hinter den Schranken, der erstaunlicherweise entschieden größer war als Tokyo Station. Es gab sogar ein Pfahl mit Richtungsweisern, damit die Leute sich nicht verliefen.

Geschäfte mit allen möglichen Waren gaben sich hier die Hand noch bevor man in die belebte Einkaufszone in Ueno eintauchte. Doch wir schafften es, uns loszureißen und die Straße draußen in Angriff zu nehmen.
Wenn man den richtigen Ausgang an der Haltestelle Ueno nahm – was wir taten –, musste man nur eine Straße überqueren, um in eine Fußgängerzone voller Geschäfte zu gelangen. Ähnlich wie in Asakusa gab es hier Traditionelles neben Modernem. Andres als in Asakusa zählte kein riesiger Tempel mit dazugehöriger Pagode zu den Hauptsehenswürdigkeiten. Es ging einfach nur ums Einkaufen. Hier verrichteten die Japaner ihre täglichen Einkäufe: Lebensmittel, Einrichtungsgegenstände, Bekleidung, etc. Es war ein natürlich gewachsener Straßenzug ohne künstlerisches Tamtam.

Ich erinnerte mich daran, dass ich auf dieser Straße vor Jahren mal eine schöne Teedose gekauft hatte, weshalb wir die Fußgängerzone auf und ab liefen, um diesen kleinen Laden wiederzufinden. Leider erfolglos. Immerhin fand Franziska ein Kleidungsstück, das ihr gefiel. Allgemein sprach uns nicht viel an, obwohl es ein großes Angebot gab. Kleine Einkaufsbuden kuschelten sich an größere Häuser, die wiederum an große Einkaufszentren grenzten. Nach einiger Zeit des Schlenderns und Schauens machten wir uns wieder auf den Weg in die Herberge.
Flussufer in der Nähe des Hostels
Ein kleines Ausflugsziel, das kaum der Rede wert scheint, aber uns dennoch gut gefiel, war die Fußgängerpromenade am Flussufer nicht weit Anne’s Hostel. Hier hatten wir einen schönen Ausblick auf das gegenüberliegende Flussufer mit dem Tokyo Skytree, der dann doch ein bisschen karg und traurig aussah, was vermutlich vom Wetter mit beeinflusst wurde.

Da es gerade zu regnen begann, machten wir uns nicht die Mühe die Promenade noch entlang zu flanieren. Zum Flanieren waren außerdem zu wenige Leute da. Aber der Blick auf die wohlbeschaffene Promenade links und rechts von uns, mit genügend Platz für zahlreiche Passanten und Auflockerungen durch grüne Pflanzeninseln, verschaffte uns ein Gefühl davon, wie es hier wohl an einem sonnigen Samstagnachmittag aussehen könnte.
Kurz vor unserer Abreise aus Tokyo stellten wir fest, dass wir nicht genug Geld hatten, um die letzten Tage zu überstehen. Gleichzeitig wollten wir nicht an einem 7/11-Automaten abheben, weil 100 €, selbst für uns beide zusammen, zu viel gewesen wären. Wir brauchten nur noch ein bisschen Taschengeld, um für die letzten Mahlzeiten und einen eventuellen Notfall aufzukommen. Also kamen wir auf die glorreiche Idee, Geld umzutauschen. Schließlich hatten wir genug Bares dabei – in neuseeländischer Währung jedenfalls. Aus diesem Grund stürzten wir wieder mal an die Rezeption unseres Hostels und behelligten die freundliche Mitarbeiterin, um zu erfahren, wo es die nächstbeste Bank gäbe.
Wir hatten Glück, denn auf dem Weg zur Metrohaltestelle fand sich schon ein Geldinstitut, das unsere Bedürfnisse zu decken vermochte. So spazierten wir ebenso selbstsicher wie verwirrt in die Lobby dieses Gebäudes, sahen uns um und wussten nicht weiter. Das war aber überhaupt kein Problem, denn nach kurzer Zeit fanden wir einen Automaten vor, an dem wir eine Nummer ziehen konnten, um zum Schalter vorgelassen zu werden. Gesagt, getan. So warteten wir seelenruhig, bis wir an der Reihe waren, gingen zum Schalter, legten unseren Fall vor, woraufhin wir erneute eine Nummer ausgehändigt bekamen, mit der wir uns bitte in den ersten Stock begeben sollten, wo solche Anliegen behandelt wurden.
An diesem Punkt fing es an, interessant zu werden. Aus Mangel an Alternativen folgten wir dem Prozedere. Oben angekommen begrüßte uns eine weitere, äußerst freundliche Mitarbeiterin. Sie nahm unsere Nummer entgegen, nickte freundlich und händigte uns ein weiteres Stück Papier mit einer Nummer drauf aus, während sie zu ihrer Linken deutete, wo der nächste Schalter uns erwartete. Ich versuchte mich damit zu trösten, dass wir wenigstens im Trockenen waren und unser triefender Regenschirm lustige Muster auf dem Fußboden hinterließ.
Bei der mittlerweile dritten Bankmitarbeiterin kamen wir mit unserem Anliegen wenigstens weiter. Sie erklärte uns in gutem Englisch, dass der Umtausch von neuseeländischen Dollarn nicht das geringste Problem darstellte, wir allerdings eine Gebühr zu entrichten hatten. Das war halb so wild, schließlich hatten wir damit gerechnet. Wir entschieden uns für einen gemeinsamen Umtausch, damit wir die Gebühr nicht zweimal zahlen mussten. Daraufhin reichte sie uns einen Antrag, den wir auszufüllen hatten, was sich allerdings recht schwierig gestaltete, weil wir weder eine Anschrift noch eine Telefonnummer in Japan hatten. Die Bankangestellte half uns freundlich weiter, musste dafür dann aber doch eine Kollegin zu Rate ziehen. Als all der Papierkram zur Zufriedenheit aller Anwesenden erledigt war, nahm die Dame unser Geld sowie die Dokumente und tauschte diese gegen eine Bearbeitungsnummer ein. Nun durften wir uns auf eine bereitstehende Bank setzen und darauf warten bis unsere Nummer aufgerufen wurde, um zu signalisieren, dass unser Antrage bearbeitet worden war und das Geldinstitut bereit zur Auszahlung war. Es ist lohnenswert zu erwähnen, dass wir zu dieser Zeit die einzigen Kunden auf dieser Etage waren. Die Bearbeitung ging eher zügig vonstatten (es sah so aus, als würden sie die neuseeländischen Geldscheine einfach nur auf Echtheit prüfen), so dass wir nach kurzem Warten wieder zurückgerufen wurden und einige japanische Banknoten in Empfang nehmen durften.
Es war zwar ein äußerst komplizierter Vorgang, dessen minutiöse Ausführung in Anbetracht der Umstände an Besessenheit grenzte. Nichtsdestotrotz erhielten wir am Ende das, was wir wollten, und hatten keinerlei Probleme mit der Bank. Finanziell frisch gewappnet zogen wir wieder in die Wildheit dieser Millionenmetropole.
Mittlerweile bin ich davon überzeugt, dass der Weltuntergang in Japan äußerst unspektakulär wäre und die Leute einen Tag danach trotz widriger Umstände pünktlich zur Arbeit eschreinen würden.
Shibuya
Für unseren letzten Aufenthaltstag in Japan – und bei unserer kleinen Weltreise – nahmen wir uns ein strammes Programm vor. Unser Flug ging erst spät abends, so dass wir uns Zeit für Abenteuer versprachen. Wir checkten aus, ließen unser Gepäck in der Herberge und brachen frohen Mutes auf. Unser erstes Ziel war das das nicht allzu weit entfernte Shibuya.
Vielleicht sind einige Leute mit dem Anblick von Shibuya vertraut: Es ist diese riesige Kreuzung im Zentrum von Tokyo, an der auf einmal alle Fußgängerampeln auf Grün springen und Fluten von Menschen gleichzeitig die Straße überqueren. Ja, wir waren dort. Und ehrlich gesagt, waren wir enttäuscht. So riesig war die Kreuzung gar nicht, nein, ich würde sie nicht einmal als groß bezeichnen. Die Kreuzung zweier Hauptverkehrsstraßen in Auckland auf dem Weg in die Innenstadt war größer gewesen. Es waren an diesem Tag zu dieser Uhrzeit auch nicht so viele Menschen anwesend, dass man es als überfüllt hätte bezeichnen können. Wir hatten tatsächlich so viel mehr erwartet, dass wir mehrere Minuten lang nach einer weiteren Kreuzung in der Nähe der Haltestelle suchten, weil wir davon überzeugt waren, dass es das nicht sein konnte. Falsch gedacht, hier waren wir richtig.

Dieser kleine moralische Rückschlag sollte uns nicht davon abhalten, einen schönen Tag zu verbringen. Wir holten aus und stapften tapfer in die nächstbeste Straße, um uns dem Charme dieses Stadtteils zu ergeben. An diesem sonnigen letzten Tag in einem fremden Land streiften wir durch große und kleine Straßen, betrachteten moderne Gebäude, sahen uns in verschiedenen Geschäften um und suchten schließlich wieder eine halbe Stunde nach einem Lokal, in dem wir zu Mittag essen konnten, weil wir davon überzeugt waren, irgendwo ein CoCo Curry gesehen zu haben. Wir wurden fündig und erlebten den erfrischenden Kontrast zwischen tiefgekühltem Verkaufsraum (er war klimatisiert) und heißem Curry.
Damit lief unsere Zeit in der Fremde ihrem Ende entgegen und ich sinnierte über die seltsamen Parallelen, die wir in Japan zu Deutschland gefunden hatten.
• Da gab es die Restaurants mit ihren absonderlichen Öffnungszeiten, insbesondere einer Mittagspause, während ich hungrig war. Ja, das ist in Deutschland normal.
• Begleitet wurde diese Erscheinung von einem viel zu komplizierten Bahnsystem, das nicht einmal Einheimische verstanden. Zugegeben, es ist noch verwirrender als in Deutschland, aber es weckte eine gewisse Heimatverbundenheit.
• Die ganzen Straßenzüge ohne Geschäfte auf Hauptverkehrsstraßen waren weitere Faktoren, die mir seltsam vertraut vorkamen, allerdings alles andere als Heimatliebe weckten.
• Schließlich möchte ich noch die japanischen Geschäftsleute erwähnen, die in ihrer Kleidungsauswahl das ganze Spektrum von Schwarz bis Hellgrau ausschöpfen, um bloß nicht allzu viel Charme und Schalk in ihrer Garderobe erkennen zu lassen.
Am Ende fand ich doch ein Schild, das meine Beziehung zu Japan kurz zusammenzufassen vermag:

Denn ich weiß, dass wir nicht immer die besten Touristen waren. Trotzdem durften wir uns dieses vertraut-fremde Land doch ohne ernstzunehmende Schwierigkeiten ansehen.
Dank präziser Beschreibung des Haltestellenstandpunktes wussten wir unser Ziel einzuschätzen: gegenüber des Bahnhofs vor dem Ibis-Hotel. Wir wussten zwar, wo sich die Haltestelle befand, nicht aber wie wir unseren Weg dorthin finden würden. Sinnvolle Wegweiser gab es nicht. Ich wage mittlerweile zu behaupten, dass der Hauptbahnhof in Kyoto meine neue Nemisis geworden ist und Kaufhäuser damit abgelöst hat. Selbst im Lotte Department Store fühlte ich mich niemals so verloren.
Zu unserem Bedauern gab es zu dieser frühen Stunde auch niemanden, den wir um Hilfe hätten bitten können. Die wenigen Gestalten, die außer uns durch den Bahnhof huschten, gaben sich große Mühe uns nicht zu nahe zu kommen. Wir stapften also drauf los, hielten an einem Umgebungsplan, lasen Schilder, sahen uns um, stapften weiter, fanden jemanden, den wir fragen konnten – erfolglos – gingen raus, sahen uns um, stellten fest, dass es in Strömen regnete, fanden das Hotel, sahen eine Baustelle, die uns von diesem trennte, folgten den Umleitungsschildern für Fußgänger, erinnerten uns an den Linksverkehr in Japan, übersahen beinahe die Ampel, wurden klatschnass, weil wir keine Regenschirme hatten, überquerten die Straße und stellten uns am Hotel schließlich unter. Wir hatten es geschafft!
Von der U-Bahn- bis zur Bushaltestelle brauchten wir 25 Minuten. Da wir ein solches Szenario an diesem Bahnhof erwartet hatten, waren wir sehr früh aufgebrochen, wodurch wir nun immer noch eine beachtliche Wartezeit hatten. Außerdem fuhr die U-Bahn um die Uhrzeit noch nicht in so dichtem Takt. Wir wollten kein Risiko eingehen.
Deutsch-pünktlich (also fünf Minuten vor der eigentlichen Uhrzeit) fuhr der Willer Expressbus Richtung Tokyo an unserer Haltestelle ein. Der Fahrer überprüfte unsere Namen und Fahrkarten, half uns beim Einladen des Gepäcks, gab uns unsere Sitznummern und wir nahmen die längste Busreise seit Beginn dieses Abenteuers auf uns. Neun Stunden waren hierfür angesetzt. Für diese lange Fahrt hatte man für die Gäste eine Erholungshilfe in Form von Schlafhauben eingebaut. Jeder Sitz verfüge über solch eine Vorrichtung. Egal, wie hell es im Bus oder draußen war, man hatte seine eigene, private, kleine, dunkle Nische, wenn man schlafen wollte.

Es dauerte nicht lange, da stellte sich bei uns der Fernreisetrott ein. Wir starrten aus dem Fenster, unterhielten uns, nickten weg, betrachteten die verregnete Landschaft und staunten immer wieder darüber, wie wenige Autos auf den Straßen zwischen den Städten unterwegs waren. Stellenweise fühlte ich mich an Franz Josef erinnert.

Wie wir feststellten, waren die Fernbusfahrer in Japan äußerst verantwortungsbewusst, was dazu führte, dass wir mehrere Gelegenheiten zu einer ausgiebigen Pause hatten. Auf diese Weise lernten wir japanische Rasthöfe kennen. Es war ein spannendes und nennenswertes Erlebnis. Es begann damit, dass wir auf Rastplätzen verschiedener Größen hielten. Nichtsdestotrotz war ein jeder von ihnen gepflegt, bot Toiletten in ausreichender Anzahl und immer auch eine Möglichkeit sich etwas Essbares zu kaufen. Wahrscheinlich plante der Fahrer – oder sein Unternehmen – die Pausen so, damit genau diese Kriterien erfüllt waren.
Was uns beide faszinierte, waren die Toiletten. Obwohl mitten im Nirgendwo gelegen, waren es stellenweise High-Tech-Anlagen mit Optionen, von denen ich in Deutschland nicht einmal zu träumen wagen würden. Es fing recht harmlos an mit einem belegt/frei-System, das an ein modernes Parkhaus erinnerte.

Dann fanden wir Alters- und Größengerechte Waschbecken sowie Schminktische. Kindgerecht, altersgerecht, benutzerfreundlich. Es war alles auch sehr stylisch aufgebaut.

Lustiger wurde es, als wir in den Kabinen Instruktionen fanden. Dabei ging es nicht nur um den Gebrauch des High-Tech-Toilettensitzes mit diversen Funktionen, sondern auch um den japanisch korrekten Gebrauch der Toilette an sich.

(Da man die Beschriftungen auf diesem Foto nicht lesen kann, fasse ich das Nennenswerte hier zusammen: Bitte abspülen (zweimal); Bitte das Toilettenpapier nur in dieser Kabine benutzen und nicht in eine andere mitnehmen)
Das beste Feature war allerdings ein Bildschirm, den wir am Eingang einer Einrichtung vorfanden:

Er zeigte den Besuchern nicht nur an, wo welche Kabine gerade frei war, nein, er informierte einen auch über die Ausstattung selbiger. Es gab westliche und japanische Toiletten, behindertengerechte und solche mit Kindersitz für Eltern, die ihre Kleinen nicht in jemandes Obhut lassen konnten oder wollten. Brillante Idee.
Nach viel zu vielen Stunden endlich in Tokyo, Shinjuku, angekommen, standen wir erneute vor der Aufgabe, mit der Bahn zu fahren. Immerhin war unser Ziel Asakusabashi – also fast das andere Ende der Stadt. Wir versuchten es gar nicht erst irgendwie selbst herauszufinden, sondern fragten gleich den nächsten Mitarbeiter am Schalter. Es war spät, wir waren müde und hatten Gepäck dabei. Ein freundlicher Mitarbeiter sagte uns sowohl welche Bahn wir nehmen mussten, als auch wo wir das Ticket dafür erstehen konnten. Mit diesen Informationen war es ein Kinderspiel.
Glücklicherweise war es von der Haltestelle Asakusabashi bis zu unserer Herberge nicht weit. In wenigen Minuten standen wir vor dem Gebäude, in dem sich das Anne Hostel Asukasabashi befand, gingen rein und wunderten uns, dass niemand an der Rezeption saß. Ein Schild setzte uns darüber in Kenntnis, dass die eigentliche Rezeption sich im vierten Stock befand und wir gerne dafür den Aufzug nutzen durften. Dieser war allerdings so klein, dass wir gerade so zu zweit mit Gepäck hinein passten. Als wir auf besagter Etage ankamen, musste ich rückwärts rausgehen, weil der Platz zum Drehen nicht reichte. Egal, wir waren sicher angekommen.
In einem viel zu kleinen Kämmerlein störten wir gerade eine Person beim Essen.

Es war ein junger Mann, der uns trotz vollem Munde freundlich begrüßte. Er stellte die üblichen Fragen, wer seid ihr, woher kommt ihr, wo ward ihr, etc., während er unsere Reservierung prüfte. Allerdings brachte dieser Mitarbeiter sich selbst in eine moralische Schieflage, als er an den Grundfesten seines Weltbilds rüttelte, indem er uns die Frage stellte, wo es uns am besten gefallen hatte. Wahrheitsgemäß antworteten wir, dass Korea uns im Sturm erobert hatte, was dazu führte, dass der junge Mann sich beinahe an seinem Essen verschluckte. Ungläubig fragte er uns, warum dem so war. Die Antwort schien ihm auch nicht sonderlich zu gefallen. Wir hatten keinen guten ersten Eindruck hinterlassen. Doch professionell, wie er war, geleitete er uns zu unserem Zimmer und erklärte uns die Regeln der Herberge.
Am Eingang zu jeder Etage gab es eine Grenze, an der man seine Schuhe zurücklassen musste. Die Schlappen auf dem Schuhregal dienten auch nur dazu, um schnell zwischen den Etagen hin und her zu laufen, denn die eigenen Schuhe durfte man dort nicht abstellen. Stattdessen musste man sie in den Schließfächern vor den Zimmern unterbringen. Besagte Schließfächer rochen dementsprechend. Nachdem uns der Schlüssel übergeben wurde, machten wir es uns in unseren Betten so gemütlich wie es nur ging. Das war in Anbetracht der Umstände schon eine gewisse Herausforderung, da wir nicht mehr Platz als in OKI’s Inn hatten. Vier Betten in einem Zimmer, das für höchstens zwei ausgelegt war.

Aber man hatte sich beholfen, indem man in jedem Bett ein Regal am Fußende eingebaut hatte. Natürlich konnte man das auch als Tisch nutzen. Immerhin waren die Betten breit genug, um gemütlich drin zu schlafen. Allerdings hatten die Japaner das Prinzip von Kissen noch nicht so ganz verstanden. Während ich noch eine zwei Finger dicke Unterlage hatte, war Franziskas Exemplar von seltsamem Format. Zwar waren die Außenseiten rund zwei Finger dick, aber in der Mitte war ein Loch. Es schien einfach durchgelegen. Als Franziska nach Ersatz fragte, weil dieses Kissen nur Spott und Hohn war, guckte man sie an der Rezeption groß an und erklärte ihr, dass alle Kissen so seien. Wir hatten unsere Zweifel, das zu glauben. Es dauerte einige Zeit, bis man Ersatz gefunden hatte, und wir wurden eines Besseren belehrt: Auch dieses Kissen hatte ein Loch in der Mitte. Letzten Endes diente es nur den Schein zu wahren.
Lange blieben wir nicht auf unserem Zimmer. Denn die Reise hatte mich hungrig hinterlassen, wodurch wir uns erdreisteten, den jungen Mann erneut zu behelligen und ihn mit Fragen bezüglich der Umgebung, insbesondere Essensmöglichkeiten zu malträtieren. Mir tat der Mensch, der nicht in Ruhe essen konnte, beinahe leid. Doch er erfüllte seine Aufgabe hervorragend, sagte uns, wo es Restaurants gab, wies aber auch darauf hin, dass sie womöglich geschlossen waren. So langsam gewöhnte ich mich an den Gedanken, auch wenn er mir einen kalten Schauer über den Rücken jagte. Wir brachen auf.
Der Einfachheit halber fasse ich nun alles Essen in Tokyo in einem Block zusammen.
Nichtsdestotrotz wagten wir uns in die dunkle Wildnis der Tokyoer Innenstadt, um ein warmes Mahl zu ergattern. Zuerst gingen wir auf die Hauptverkehrsstraße zu. Dann sahen wir uns um. Es war recht düster und bedrückend, was ausschließlich daran lag, dass so wenig Licht vorhanden war. Außerdem gingen nur wenige Leute die nasse Straße entlang. Nach einigem hin und her und Suchen fanden wir schließlich ein ansprechendes und geöffnetes Restaurant im ersten Stockwerk, in das wir sogleich einkehrten.
Als wir eintraten, begrüßte uns schon ein Kellner, der uns schnell einen Tisch zuwies. Es gab einige Kleinigkeiten, die uns ins Auge fielen: am Tisch gab es einen Klingelknopf, mit dem man den Keller rufen konnte; sehr viele Leute saßen alleine an Einzeltischen; eine Anzeige über der Kasse zeigte an, welcher Tisch als nächstes bedient werden würde.
Nach kurzer Betrachtung der Speisekarte entschieden wir uns für zwei unterschiedliche Gerichte, damit wir möglichst viel probieren konnten. Während Franziska sich für eine vegetarische Variante entschied, nahm ich Katsu Don.


Das Essen war zwar gut, die Portion für mich allerdings entschieden zu klein, was meine Reisebegleitung aufzubessern versuchten, indem sie mir ihre Miso-Suppe gab. Gleichwohl war es schon bald Zeit, das Mahl zu beenden und uns auf den Weg zurück zur Herberge zu machen. Für den kleinen Hunger zwischendurch gab es unterwegs noch einen 7/11-Supermarkt. (Ja, es war auch unsere bevorzugte Bank.)
Ich genoss das Frühstück in unserer Herberge sehr. Es gab ein All-you-can-eat-Buffet mit Tee, Toast, Eiern und verschiedenen Sorten Marmelade. Was mir besonders daran gefiel, war der All-you-can-eat-Aspekt. Keine Einschränkungen, keine Überwachung, keine Restriktionen. Man kam morgens in den Aufenthaltsraum, nahm sich Teller und Lebensmittel, setzte sich und stand auf, wenn man fertig war. Sie baten darum, dass man sein Geschirr selbst spülte, aber das war nun wirklich kein Aufwand für diesen Service.

Da wir schon einmal in dem Heimatland von Tenpura waren, bestanden wir beide darauf, dieses köstliche Gericht in seinem Original zu probieren. Ich möchte hier anmerken, dass die japanischen Restaurants in meiner Heimatstadt Düsseldorf auch mitunter hervorragend sind, weil wir eine der größten japanischen Gemeinden außerhalb Japans haben, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass wir zum Ursprung zurückkehren wollten. Die weitberühmte Touristenmeile Asakusa war nur zwei Haltestellen entfernt, was es uns einfach machte einen Ausflug mit einem schmackhaften Mittagessen zu verbinden. Es gab verschiedene Varianten von Tenpura auf Nudeln, wobei wir uns für – wie gewohnt – verschiedene Menüs entschieden, um uns austauschen zu können. Es war hervorragend.

An unserem vorletzten Tag in Tokyo suchten wir händeringend nach einem geeigneten Lokal für unser Mittagessen. Noch bevor wir einen Fuß in die Hauptstad Japans gesetzt hatten, war es beschlossene Sache, dass wir nicht kochen würden – aus Prinzip. Leider erwies sich das aufgrund mangelnder Lokalitäten immer wieder als Problem, zumal ich kalten Reis nicht mehr sehen konnte. Doch an einem der unwahrscheinlichsten Orte fanden wir dann doch ein noch unwahrscheinlicheres Restaurant: Im inneren Bereich der riesigen Haltestelle Ueno, also hinter den Ticketkontrollen, betraten wir ein indisches Restaurant, das auf schnellen Durchgangsverkehr eingestellt war. Wir entschieden uns für ein großes Fladenbrot mit unterschiedlichen Saucen und gemischtem Krautsalat. Das Ganze wurde auf einer Cafeteria-Platte aus Edelstahl serviert. Es war sehr schmackhaft, aber für mich dann doch zu wenig, weshalb ich mir mit einem großen Nachtisch half.

Auch in Tokyo ergab sich für uns die Möglichkeit bei CoCoCurry einzukehren.

Die Größe der Reisportion verriet für gewöhnlich, wer welches Menü bestellte.
Damit war unsere kulinarische Reise in Tokyo auch schon abgeschlossen. Immerhin verbachten wir nur drei Tage in der Hauptstadt, was vor allem durch die lange Reise verschuldet war. Es war dennoch ein lohnenswerter Ausflug.
Während wir in Tokyo waren, ergab sich die Gelegenheit ein Volleyballspiel zu sehen. Der Fernseher im Aufenthaltsraum lief die ganze Zeit und wir waren gerade im Begriff unseren sozialen Verpflichtungen nachzukommen. Der einzige Grund, warum es uns nur ansatzweise interessierte, war, dass das Match zwischen Japan und Korea ausgetragen wurde. Die weiblichen Vertreter spielten gegeneinander. Wir beschlossen, uns diesen Spaß anzusehen.
Mit uns im Raum saß ein französischer Tourist, der seine Loyalität offen zur Schau trug. Eine große japanische Flagge war um seine Schultern geschlungen. Als wir ins Gespräch kamen und ihm offenbarten, dass wir für das koreanische Team waren, sprudelte pure Entrüstung aus ihm heraus, die er aufgrund seines schieren Unglaubens nur stotternd hervorbringen konnte. Seine Argumentationsweise hingegen war fadenscheinig. Er meinte, weil er gerade in diesem Land sei, Japan, wäre es nur natürlich für die japanische Mannschaft zu sein. Ich fragte mich, ob er nicht zugeben wollte, dass Manga und Anime sein Herz erfüllten, oder ob er sich einfach nur bei den Einheimischen einschleimen wollte. Wie dem auch sei, eine gespannte Stimmung entbrannte in dem kleinen Raum. Obwohl wir die meiste Zeit nur zu dritt waren, konnte man die Spannung fast schon greifen. Ich übertreibe. Nichtsdestotrotz wurde aus seiner Prophezeiung, dass dies eine einfache Partie für Japan werden würde, nichts. Die Koreanerinnen schlugen sich mitunter sehr gut, ließen zum Schluss allerdings nach. Ich holte zwischendurch Abendessen, so dass wir mit Snacks das Spiel genießen konnten. Dank unseres Nachbarn wurde es äußerst unterhaltsam. Als es vorbei war, ließ es sich der junge Mann nicht nehmen, seine Freude ob des japanischen Sieges offen zur Schau zu tragen. Wir schmunzelten.
Asakusa
Natürlich führte kein Weg an Asakusa vorbei, wenn wir uns wie richtige Touristen benehmen wollten. Da Franziska diese Touristenmeile noch nicht kannte, stand sie ganz oben auf unserer Liste. So brauchen wir eines Tages auf, uns ins Getümmel zu stürzen und diesen Ort auf uns wirken zu lassen. Für all jene, denen Asakusa kein Begriff ist, versuche ich die Umgebung in Worte zu fassen.
Es war ein Teil der Stadt, in dem traditionell gebaute Gebäude auf den Konsumdrang unserer Generation trafen. Das riesige Eingangstor war mehr Zierde denn funktioneller Natur.

Menschenmassen umströmten diesen Koloss, gingen hindurch und daran vorbei, blieben stehen, um Fotos zu machen (so wie wir), wuselten sich durch die Menge, zu der sie selbst gehörten. Trotzdem war es nicht ganz so voll, weil die Saison sich gerade ihrem Ende neigte.
Hinter diesem Tor breitet sich eine breite Straße aus, die links und rechts von kleinen Hütten gesäumt wurde.

Diese Hütten beherbergten Verkaufsstände und Geschäfte jeglicher Art. Man konnte hier allerlei Souvenirs kaufen, denn es war für jeden Geschmack etwas dabei. Von wirklich nützlich und schick hin zu Blödsinn, den man bestenfalls an die fünfjährige Nichte mit Glittermanie weitergeben konnte. Wie beispielsweise wunderbar verzierte Stäbchen. Daneben fand sich Krimskram, den wirklich kein Mensch braucht, wie beispielsweise Miniquietschkatanas.
Hatte man einmal diesen Verkaufswahnsinn hinter sich gebracht, kam man durch ein zweites Tor auf einen Vorhof, an dem nur noch spirituelle Kleinigkeiten erworben werden konnten. Am Ende dieses Hofes stand ein großer Tempel.

Wir drehten einen Runde, betrachteten alles, inklusive Nebenstraßen, machten Pausen, machten Fotos und kauften einige Kleinigkeiten. Franziska fand einige Accessoires für ihr Bento; auf mich warteten einige Flaggen, die ich an meinen Globetrotterhut nähen konnte.
An dieser Stelle möchte ich noch erwähnen, dass Asakusa nicht aus bloß dieser einen weitberühmten Einkaufspassage bestand. Es gab zahlreiche Straßen und Gässchen drum herum, die uns ein vielfältiges Angebot boten. Es gab eine Mischung aus alt aussehenden und neueren Gebäuden, die in teils kuriosen Arrangements nebeneinander standen.

Wenn man sich ein bisschen Zeit nahm und die Gegend um dies eine Straße herum erkundete, konnte man interessante Sachen finden. Daher rate ich jedem Interessenten, sich für einige Zeit von den Massen abzukapseln und eigene Wege zu gehen. Alternativ kann man auch eine Rikscharundfahrt machen. Wir waren zu Fuß allerdings gut unterwegs und erledigten alles auf unsere Weise, bevor wir wieder weiterzogen.
Unsere Abenteuer mit dem Schienennetz nahm einfach kein Ende. Wir wollten von Asakusabashi nach Tokyo Station fahren. In der U-Bahnhaltestelle fand sich auch ein schöner Plan, den ich sogar lesen konnte. Auf diesem stand geschrieben, dass wir zweimal umsteigen und insgesamt 280 Yen pro Person bezahlen müssten. Leider spuckte der Automat keine Fahrkarten mit diesem Betrag aus, so dass wir uns gezwungen sahen, einen Bahnangestellten zu behelligen. Dieser klärte uns darüber auf, dass wir nicht, wie geplant, mit der U-Bahn fahren konnten, sondern die JR nehmen mussten. Die Haltestelle dieses Verkehrsunternehmens befand sich außerhalb des Gebäudes. Er wies uns den Weg und ließ uns von dannen ziehen.
Der Fahrplan in der JR-Haltestelle war alles andere als leserlich, da keiner von uns Kanji verstand, was dazu führte, dass wir den nächsten Angestellten behelligen mussten, um zu erfahren, wie wir zu unserem Ziel gelangen könnten. Dafür mussten wir uns erst einmal in eine Schlange stellen. (Schlangestehen scheint Nationalsport in Japan zu sein, denn die Japaner machen es bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Es erinnerte mich ein bisschen an den Kommunismus in Polen, als die Leute sich sofort in eine Schlange stellten, als sie daran vorbei gingen, weil gerade etwas Nützliches hätte geliefert werden können. Wie dem auch sei.) Der Herr hinter der Glasscheibe erklärte uns nicht nur, welches Ticket wir brauchten, sondern er stellte es aus und wies uns den Weg inklusive der Haltestelle, an der wir umsteigen mussten. Das fanden wir äußerst freundlich und hilfreich.
Was in Tokyo Station und an anderen Plätzen geschah, wird gesondert behandelt, ich möchte mich in diesem Abschnitt nur auf die Fahrerei mit den öffentlichen Verkehrsmitteln konzentrieren.
Die Fahrt von Tokyo Station nach Ueno war fast schon ein Kinderspiel. Die größte Schwierigkeit bestand im Kauf einer Fahrkarte, weil der Liniennetzplan mal wieder nicht in europäischen Buchstaben dargestellt war. Ich frage mich langsam, wie ein Land mit so vielen Touristen pro Jahr es sich überhaupt erlauben konnte, so nachlässig zu sein. Das ist doch Spott und Hohn den Besuchern gegenüber. Niemand soll mir noch einmal mit Servicewüste Deutschland kommen – die Japaner machen uns da enorme Konkurrenz.
Wir fragten die nächste Bahnangestellte, welches Ticket wir brauchten, und kamen nur auf diese Weise an unserem Ziel an.
In der Nähe von Ueno gab es die U-Bahnhaltestellte Ueno -okachimachi, die eine bessere Verbindung mit weniger Umsteigen nach Asakusabashi gewährleistete. Wir fanden die Haltestelle, fanden das richtige Ticket, fanden die Haltestelle zum Umsteigen und fuhren los. Als wir dann in die andere Bahn steigen wollten, stellten wir fest, dass wir dafür die U-Bahn verlassen mussten, 200 Meter oberirdisch einem ausgeschilderten Pfad zu folgen hatten, um dann wieder in das U-Bahnnetz einzutauchen. Dies war aber nicht so einfach, weil man den richtigen Eingang nehmen musste, um am richtigen Gleis anzukommen. Natürlich schafften wir dies nicht auf Anhieb – und fragten somit den nächsten Mitarbeiter, der uns zu unserem Gleis lotste. Dafür mussten wir durch die Kontrolle, bis zum Ende dieses Gleises, dort die Treppe runter, durch die Unterführung und auf der anderen Seite wieder hoch.
Ich fing langsam an die Deutsche Bahn zu vermissen, weil ich dort wenigstens die Beschilderung lesen und die unfreundlichen Mitarbeiter anpflaumen konnte. Glücklicherweise war das System so intelligent, dass wir bei dieser Aktion nicht noch zuzahlen mussten.
Zurück zu Tokyo Station
Ein weiteres Ausflugsziel war der Bahnhof Tokyo. Da wir schon unfreiwilligerweise das Ungetüm in Kyoto hinter uns gebracht hatten, dachten wir uns, dass wir auch einen Blick in das Pendant der Hauptstadt werfen sollten, zumal es als Sehenswürdigkeit angepriesen wurde. Unweit dieses Bahnhofs versprach die Kitte-Mall Einkaufsvergnügen für jedermann. Aus diesem Grund planten wir dort unser Mittagsmahl einzunehmen. In solch einem groß umworbenen Komplex würde sich mit Sicherheit etwas zu essen auftreiben lassen.
Kaum waren wir an der Tokyo Station angekommen, wuselten wir uns durch die Menschenmassen zum richtigen Ausgang, um möglichst zügig an unserem Ziel anzukommen. Wir erwarteten, dass wir noch einige Minuten zu Fuß gehen mussten, doch dem war überraschenderweise nicht so. Kaum waren wir aus dem Bahnhofsgebäude raus, standen wir vor der Mall. Ich blinzelte verwundert. Auf der Stadtkarte sah es weiter weg aus. Wir zuckten die Schultern, überquerten die einzige Straße und tauchten ins Einkaufsvergnügen ein.
Oder auch nicht. Die Kitte-Mall war… ernüchternd.

Es erinnerte mich stark an die Arkaden zu Hause, in Deutschland. Funktional, schmucklos, mittlerweile wenigstens hell, wahrscheinlich mit einem Designer-Stempel irgendwo drauf, aber trotzdem nichts fürs Auge dabei. Ein überdachter Hof, dessen Wände mit Galerien versehen waren, um Geschäfte unterzubringen, lag vor uns. An Stelle von Geländern hinderten gläserne Fassaden die Menschen vor dem Sturz in die Tiefe.
Im Grunde war es ein ausgehöhltes Dreieck, das mit viel Glas und Marmor auf Hochglanz poliert worden war, dabei aber jeglichen Inhalts entbehrte. Es war langweilig und steril. Es mit der Lotte Mall in Busan vergleichen zu wollen, hieße Te Papa mit dem Senkenbergmuseum in Frankfurt zu vergleichen – und das kann ich nicht reinen Gewissens über mich bringen.
Obwohl wir einen Lageplan inklusive Gourmet guide hatten, fiel es uns schwer ein passendes Lokal zu finden, in dem wir hätten essen können. Das lag einfach daran, dass die lecker aussehenden Sachen nicht in unserer Preiskategorie lagen. Aus diesem Grund entschlossen wir uns spontan dafür, irgendwo anders einzukehren, auch wenn wir uns darüber im Klaren waren, dass die Suche noch ein wenig Zeit in Anspruch nehmen könnte. Statt zu speisen erkundigten wir diese Arkaden von oben bis unten.
Immerhin hatten sie versucht, das Dach dieser trostlosen Einrichtung ein bisschen aufzupeppen, indem sie ein bisschen Grün hinstreuten. Dieses Bisschen war aber eine große Fläche, die ausschließlich aus Rasen bestand und nicht betreten werden durfte.

Ich gebe ihnen Punkte für den bloßen Versuch.
Die Aussicht war allerdings nennenswert. Wir hatten von dort oben eine herrliche Sicht auf die Ausmaße des Bahnhofs Tokyo. Er war riesig, pompös und erinnerte an ein längst vergangenes Jahrhundert, obwohl er gerade erst 1914 eröffnet worden war. Beeindruckend war er auf jeden Fall. Die rot-weiße Fassade mit dem schwarzen Dach, das an mehreren Stellen in wuchtigen Kuppeln aufgebäumt war, erweckte den Eindruck eins überragenden Selbstbewusstseins. Um dieses Bauwerk versammelten sich die Hochhäuser des Glas-Beton-Zeitalters. Ich bin mir sicher, dass dieser Prachtbau noch imposanter gewirkt hatte, als die neueren Ungetüme noch nicht darüber thronten. Letztlich war sogar die Kitte-Mall ihren gerade einmal sechs Stockwerken höher.

Nach einiger Verweildauer und einem gründlichen Rundumblick war es für uns Zeit aufzubrechen und weiterzuziehen. Die Zeit drängte, denn wir hatten nur wenige Tage in dieser Metropole zu unserer Verfügung. Wir gingen wieder in den Bahnhof, kauften einen Fahrschein und hofften, in dem riesigen Bereich hinter den Schranken ein Restaurant zu finden. Doch außer einigen To-Go-Schaltern gab es nichts Nennenswertes, weshalb wir uns für die Weiterreise entscheiden. Jedenfalls fanden wir nichts mit Sitzgelegenheiten. Wir nahmen also den nächstbesten Zug Richtung Ueno.
Es ereignete sich etwas, womit ich zu Lebzeiten nicht gerechnet hätte. Der Zug fuhr einfach nicht ab. Wir standen in der Bahn und warteten... und warteten… und warteten. Nach kurzer Zeit kam eine Durchsage, die wir natürlich nicht verstanden, doch die Bahn fuhr immer noch nicht weiter. Wir hatten tatsächlich mehrere Minuten Verspätung! Im Nachhinein erfuhren wir etwas von Personen auf den Gleisen. Selbstverständlich hatte ich Verständnis für den Stillstand des Zuges, aber es war dennoch überraschend.
In Ueno angekommen, standen wir nun wieder in diesem Bereich hinter den Schranken, der erstaunlicherweise entschieden größer war als Tokyo Station. Es gab sogar ein Pfahl mit Richtungsweisern, damit die Leute sich nicht verliefen.

Geschäfte mit allen möglichen Waren gaben sich hier die Hand noch bevor man in die belebte Einkaufszone in Ueno eintauchte. Doch wir schafften es, uns loszureißen und die Straße draußen in Angriff zu nehmen.
Wenn man den richtigen Ausgang an der Haltestelle Ueno nahm – was wir taten –, musste man nur eine Straße überqueren, um in eine Fußgängerzone voller Geschäfte zu gelangen. Ähnlich wie in Asakusa gab es hier Traditionelles neben Modernem. Andres als in Asakusa zählte kein riesiger Tempel mit dazugehöriger Pagode zu den Hauptsehenswürdigkeiten. Es ging einfach nur ums Einkaufen. Hier verrichteten die Japaner ihre täglichen Einkäufe: Lebensmittel, Einrichtungsgegenstände, Bekleidung, etc. Es war ein natürlich gewachsener Straßenzug ohne künstlerisches Tamtam.

Ich erinnerte mich daran, dass ich auf dieser Straße vor Jahren mal eine schöne Teedose gekauft hatte, weshalb wir die Fußgängerzone auf und ab liefen, um diesen kleinen Laden wiederzufinden. Leider erfolglos. Immerhin fand Franziska ein Kleidungsstück, das ihr gefiel. Allgemein sprach uns nicht viel an, obwohl es ein großes Angebot gab. Kleine Einkaufsbuden kuschelten sich an größere Häuser, die wiederum an große Einkaufszentren grenzten. Nach einiger Zeit des Schlenderns und Schauens machten wir uns wieder auf den Weg in die Herberge.
Flussufer in der Nähe des Hostels
Ein kleines Ausflugsziel, das kaum der Rede wert scheint, aber uns dennoch gut gefiel, war die Fußgängerpromenade am Flussufer nicht weit Anne’s Hostel. Hier hatten wir einen schönen Ausblick auf das gegenüberliegende Flussufer mit dem Tokyo Skytree, der dann doch ein bisschen karg und traurig aussah, was vermutlich vom Wetter mit beeinflusst wurde.

Da es gerade zu regnen begann, machten wir uns nicht die Mühe die Promenade noch entlang zu flanieren. Zum Flanieren waren außerdem zu wenige Leute da. Aber der Blick auf die wohlbeschaffene Promenade links und rechts von uns, mit genügend Platz für zahlreiche Passanten und Auflockerungen durch grüne Pflanzeninseln, verschaffte uns ein Gefühl davon, wie es hier wohl an einem sonnigen Samstagnachmittag aussehen könnte.
Kurz vor unserer Abreise aus Tokyo stellten wir fest, dass wir nicht genug Geld hatten, um die letzten Tage zu überstehen. Gleichzeitig wollten wir nicht an einem 7/11-Automaten abheben, weil 100 €, selbst für uns beide zusammen, zu viel gewesen wären. Wir brauchten nur noch ein bisschen Taschengeld, um für die letzten Mahlzeiten und einen eventuellen Notfall aufzukommen. Also kamen wir auf die glorreiche Idee, Geld umzutauschen. Schließlich hatten wir genug Bares dabei – in neuseeländischer Währung jedenfalls. Aus diesem Grund stürzten wir wieder mal an die Rezeption unseres Hostels und behelligten die freundliche Mitarbeiterin, um zu erfahren, wo es die nächstbeste Bank gäbe.
Wir hatten Glück, denn auf dem Weg zur Metrohaltestelle fand sich schon ein Geldinstitut, das unsere Bedürfnisse zu decken vermochte. So spazierten wir ebenso selbstsicher wie verwirrt in die Lobby dieses Gebäudes, sahen uns um und wussten nicht weiter. Das war aber überhaupt kein Problem, denn nach kurzer Zeit fanden wir einen Automaten vor, an dem wir eine Nummer ziehen konnten, um zum Schalter vorgelassen zu werden. Gesagt, getan. So warteten wir seelenruhig, bis wir an der Reihe waren, gingen zum Schalter, legten unseren Fall vor, woraufhin wir erneute eine Nummer ausgehändigt bekamen, mit der wir uns bitte in den ersten Stock begeben sollten, wo solche Anliegen behandelt wurden.
An diesem Punkt fing es an, interessant zu werden. Aus Mangel an Alternativen folgten wir dem Prozedere. Oben angekommen begrüßte uns eine weitere, äußerst freundliche Mitarbeiterin. Sie nahm unsere Nummer entgegen, nickte freundlich und händigte uns ein weiteres Stück Papier mit einer Nummer drauf aus, während sie zu ihrer Linken deutete, wo der nächste Schalter uns erwartete. Ich versuchte mich damit zu trösten, dass wir wenigstens im Trockenen waren und unser triefender Regenschirm lustige Muster auf dem Fußboden hinterließ.
Bei der mittlerweile dritten Bankmitarbeiterin kamen wir mit unserem Anliegen wenigstens weiter. Sie erklärte uns in gutem Englisch, dass der Umtausch von neuseeländischen Dollarn nicht das geringste Problem darstellte, wir allerdings eine Gebühr zu entrichten hatten. Das war halb so wild, schließlich hatten wir damit gerechnet. Wir entschieden uns für einen gemeinsamen Umtausch, damit wir die Gebühr nicht zweimal zahlen mussten. Daraufhin reichte sie uns einen Antrag, den wir auszufüllen hatten, was sich allerdings recht schwierig gestaltete, weil wir weder eine Anschrift noch eine Telefonnummer in Japan hatten. Die Bankangestellte half uns freundlich weiter, musste dafür dann aber doch eine Kollegin zu Rate ziehen. Als all der Papierkram zur Zufriedenheit aller Anwesenden erledigt war, nahm die Dame unser Geld sowie die Dokumente und tauschte diese gegen eine Bearbeitungsnummer ein. Nun durften wir uns auf eine bereitstehende Bank setzen und darauf warten bis unsere Nummer aufgerufen wurde, um zu signalisieren, dass unser Antrage bearbeitet worden war und das Geldinstitut bereit zur Auszahlung war. Es ist lohnenswert zu erwähnen, dass wir zu dieser Zeit die einzigen Kunden auf dieser Etage waren. Die Bearbeitung ging eher zügig vonstatten (es sah so aus, als würden sie die neuseeländischen Geldscheine einfach nur auf Echtheit prüfen), so dass wir nach kurzem Warten wieder zurückgerufen wurden und einige japanische Banknoten in Empfang nehmen durften.
Es war zwar ein äußerst komplizierter Vorgang, dessen minutiöse Ausführung in Anbetracht der Umstände an Besessenheit grenzte. Nichtsdestotrotz erhielten wir am Ende das, was wir wollten, und hatten keinerlei Probleme mit der Bank. Finanziell frisch gewappnet zogen wir wieder in die Wildheit dieser Millionenmetropole.
Mittlerweile bin ich davon überzeugt, dass der Weltuntergang in Japan äußerst unspektakulär wäre und die Leute einen Tag danach trotz widriger Umstände pünktlich zur Arbeit eschreinen würden.
Shibuya
Für unseren letzten Aufenthaltstag in Japan – und bei unserer kleinen Weltreise – nahmen wir uns ein strammes Programm vor. Unser Flug ging erst spät abends, so dass wir uns Zeit für Abenteuer versprachen. Wir checkten aus, ließen unser Gepäck in der Herberge und brachen frohen Mutes auf. Unser erstes Ziel war das das nicht allzu weit entfernte Shibuya.
Vielleicht sind einige Leute mit dem Anblick von Shibuya vertraut: Es ist diese riesige Kreuzung im Zentrum von Tokyo, an der auf einmal alle Fußgängerampeln auf Grün springen und Fluten von Menschen gleichzeitig die Straße überqueren. Ja, wir waren dort. Und ehrlich gesagt, waren wir enttäuscht. So riesig war die Kreuzung gar nicht, nein, ich würde sie nicht einmal als groß bezeichnen. Die Kreuzung zweier Hauptverkehrsstraßen in Auckland auf dem Weg in die Innenstadt war größer gewesen. Es waren an diesem Tag zu dieser Uhrzeit auch nicht so viele Menschen anwesend, dass man es als überfüllt hätte bezeichnen können. Wir hatten tatsächlich so viel mehr erwartet, dass wir mehrere Minuten lang nach einer weiteren Kreuzung in der Nähe der Haltestelle suchten, weil wir davon überzeugt waren, dass es das nicht sein konnte. Falsch gedacht, hier waren wir richtig.

Dieser kleine moralische Rückschlag sollte uns nicht davon abhalten, einen schönen Tag zu verbringen. Wir holten aus und stapften tapfer in die nächstbeste Straße, um uns dem Charme dieses Stadtteils zu ergeben. An diesem sonnigen letzten Tag in einem fremden Land streiften wir durch große und kleine Straßen, betrachteten moderne Gebäude, sahen uns in verschiedenen Geschäften um und suchten schließlich wieder eine halbe Stunde nach einem Lokal, in dem wir zu Mittag essen konnten, weil wir davon überzeugt waren, irgendwo ein CoCo Curry gesehen zu haben. Wir wurden fündig und erlebten den erfrischenden Kontrast zwischen tiefgekühltem Verkaufsraum (er war klimatisiert) und heißem Curry.
Damit lief unsere Zeit in der Fremde ihrem Ende entgegen und ich sinnierte über die seltsamen Parallelen, die wir in Japan zu Deutschland gefunden hatten.
• Da gab es die Restaurants mit ihren absonderlichen Öffnungszeiten, insbesondere einer Mittagspause, während ich hungrig war. Ja, das ist in Deutschland normal.
• Begleitet wurde diese Erscheinung von einem viel zu komplizierten Bahnsystem, das nicht einmal Einheimische verstanden. Zugegeben, es ist noch verwirrender als in Deutschland, aber es weckte eine gewisse Heimatverbundenheit.
• Die ganzen Straßenzüge ohne Geschäfte auf Hauptverkehrsstraßen waren weitere Faktoren, die mir seltsam vertraut vorkamen, allerdings alles andere als Heimatliebe weckten.
• Schließlich möchte ich noch die japanischen Geschäftsleute erwähnen, die in ihrer Kleidungsauswahl das ganze Spektrum von Schwarz bis Hellgrau ausschöpfen, um bloß nicht allzu viel Charme und Schalk in ihrer Garderobe erkennen zu lassen.
Am Ende fand ich doch ein Schild, das meine Beziehung zu Japan kurz zusammenzufassen vermag:

Denn ich weiß, dass wir nicht immer die besten Touristen waren. Trotzdem durften wir uns dieses vertraut-fremde Land doch ohne ernstzunehmende Schwierigkeiten ansehen.
... link (0 Kommentare) ... comment
Sonntag, 1. Mai 2016
Don Quijote
atimos, 22:38h
Bei den Vorbereitungen für unsere Reise dachte ich selbstverständlich daran zumindest ein wenig Lesematerial mitzunehmen. Immerhin schätze ich Lesen sehr und konnte mir nicht vorstellen, dass ich keine einzige freie Minute haben würde, um mich zumindest ein wenig in eine Lektüre zu vertiefen. Gleichzeitig musste ich das Volumen und Gewicht meines Gepäcks berücksichtigen, was für mich – in Ermangelung eines elektronischen Lesegeräts – bedeutete, dass ich mich beschränken musste. Ich entschied mich für zwei dicke Bücher. Dies hatte zwei Gründe: Zum einen hätte ich sie im Zweifelsfall auch in meinem Rucksack verstauen können. Zum anderen versprach ich mir davon zumindest einen Teil meiner Zeit füllen zu können.
Dennoch wollte ich nicht irgendwelche Schätze mitnehmen, von denen mein geistiges und körperliches Wohl abhing, denn ich hatte schon die Erfahrung gemacht, dass der Aufenthaltsort von meinem Gepäck und mir nicht immer derselbe war. Eines der beiden Bücher, für das ich mich entschied, war Don Quijote. Dieses Buch hatte ich mir zu Bachelorzeiten besorgen müssen, doch ich hatte es nie ganz gelesen. Mit dieser langen Reise witterte ich eine einzigartige Gelegenheit. Ich würde das Buch bestimmt lesen, wenn mich nichts anderes davon ablenkte. Immerhin zählte es zu Weltliteratur.
Ja, ich fasse mich kurz: Don Quijote braucht dringend eine Neuübersetzung. Der jahrhundertealte Schreibstil ist einfach nur anstrengend und viel vom Witz geht verloren, wenn man mit der Sprache zu ringen hat. Vielleicht ist es ein gutes und bedeutendes Buch, aber ich habe es zu hassen gelernt. Da ich stellenweise wirklich nichts Besseres zu tun hatte, las ich es dennoch zu Ende.
Aber das ist in diesem Beitrag nicht der springende Punkt. Worauf es mir ankommt, ist, dass Don Quijote mich auf dieser Reise verfolgte. Während ich das Buch als über drei Kontinente, sieben Länder und unzählige Städte mit mir trug, gab mir das Universum auch dann einen Hinweis auf seine Existenz, wenn ich es mal nicht in Händen hielt.
Bei einem unserer Besuche des Nationalmuseums in Seoul mussten wir wegen Bauarbeiten einen anderen Weg gehen. Wir kamen an einer Bushaltestelle vorbei, in der große Werbeposter ihre Botschaft verbreiteten. Sie machten auf das Musical „Man of la Mancha“ aufmerksam. Auch wenn ich die Sprache nicht verstand, so war das skizzierte Bild auf gelbem Hintergrund mehr als deutlich.

Es folgte eine Begebenheit in Tokyo, die etwas größere Ausmaße annahm. Im Bestreben ihre Bento-Sammlung ein bisschen zu erweitern, führte meine Reisebegleitung mich in einen Laden, der Bento-Zubehör zu günstigen Preisen anbot. Es war ein Geschäft mit großer Verkaufsfläche, die sich über mehrere Etagen zog. Der Name des Ladens war: Don Quijote.

Als ob das nicht genug wäre, erwartete mich ein weitere Don Quijote zu Hause. Während meiner kleinen Weltreise hatte auch eine Freundin von mir ihre Koffer gepackt und einen Abstecher nach Spanien gewagt. Als riesiger Fan von Postkarten bat ich sie natürlich darum mir eine zu schicken. Sie war so freundlich, dieser Bitte nachzukommen, und schickte mir eine ansehnliche Postkarte mit dem Bild von Casa Batlló in Barcelona. Auf der Rückseite dieser Karte prangerte groß der Ritter von der traurigen Gestalt.

Damit war meine persönliche Geschichte mit dieser tragischen Figur noch nicht abgeschlossen. In meinem Bekanntenkreis ist es mittlerweile weitbekannt, dass mein Vater sich der Sammlung von Münzen gewidmet hat, insbesondere der Sonderprägungen von 2-€-Münzen. So wartete auf mich nach meiner Rückkehr ein kleiner Schatz, den ich eingehend untersuchen durfte, um festzustellen, was mein Vater noch nicht sein Eigen nennen konnte. Darunter war – selbstverständlich – Don Quijote.

Dennoch wollte ich nicht irgendwelche Schätze mitnehmen, von denen mein geistiges und körperliches Wohl abhing, denn ich hatte schon die Erfahrung gemacht, dass der Aufenthaltsort von meinem Gepäck und mir nicht immer derselbe war. Eines der beiden Bücher, für das ich mich entschied, war Don Quijote. Dieses Buch hatte ich mir zu Bachelorzeiten besorgen müssen, doch ich hatte es nie ganz gelesen. Mit dieser langen Reise witterte ich eine einzigartige Gelegenheit. Ich würde das Buch bestimmt lesen, wenn mich nichts anderes davon ablenkte. Immerhin zählte es zu Weltliteratur.
Ja, ich fasse mich kurz: Don Quijote braucht dringend eine Neuübersetzung. Der jahrhundertealte Schreibstil ist einfach nur anstrengend und viel vom Witz geht verloren, wenn man mit der Sprache zu ringen hat. Vielleicht ist es ein gutes und bedeutendes Buch, aber ich habe es zu hassen gelernt. Da ich stellenweise wirklich nichts Besseres zu tun hatte, las ich es dennoch zu Ende.
Aber das ist in diesem Beitrag nicht der springende Punkt. Worauf es mir ankommt, ist, dass Don Quijote mich auf dieser Reise verfolgte. Während ich das Buch als über drei Kontinente, sieben Länder und unzählige Städte mit mir trug, gab mir das Universum auch dann einen Hinweis auf seine Existenz, wenn ich es mal nicht in Händen hielt.
Bei einem unserer Besuche des Nationalmuseums in Seoul mussten wir wegen Bauarbeiten einen anderen Weg gehen. Wir kamen an einer Bushaltestelle vorbei, in der große Werbeposter ihre Botschaft verbreiteten. Sie machten auf das Musical „Man of la Mancha“ aufmerksam. Auch wenn ich die Sprache nicht verstand, so war das skizzierte Bild auf gelbem Hintergrund mehr als deutlich.

Es folgte eine Begebenheit in Tokyo, die etwas größere Ausmaße annahm. Im Bestreben ihre Bento-Sammlung ein bisschen zu erweitern, führte meine Reisebegleitung mich in einen Laden, der Bento-Zubehör zu günstigen Preisen anbot. Es war ein Geschäft mit großer Verkaufsfläche, die sich über mehrere Etagen zog. Der Name des Ladens war: Don Quijote.

Als ob das nicht genug wäre, erwartete mich ein weitere Don Quijote zu Hause. Während meiner kleinen Weltreise hatte auch eine Freundin von mir ihre Koffer gepackt und einen Abstecher nach Spanien gewagt. Als riesiger Fan von Postkarten bat ich sie natürlich darum mir eine zu schicken. Sie war so freundlich, dieser Bitte nachzukommen, und schickte mir eine ansehnliche Postkarte mit dem Bild von Casa Batlló in Barcelona. Auf der Rückseite dieser Karte prangerte groß der Ritter von der traurigen Gestalt.

Damit war meine persönliche Geschichte mit dieser tragischen Figur noch nicht abgeschlossen. In meinem Bekanntenkreis ist es mittlerweile weitbekannt, dass mein Vater sich der Sammlung von Münzen gewidmet hat, insbesondere der Sonderprägungen von 2-€-Münzen. So wartete auf mich nach meiner Rückkehr ein kleiner Schatz, den ich eingehend untersuchen durfte, um festzustellen, was mein Vater noch nicht sein Eigen nennen konnte. Darunter war – selbstverständlich – Don Quijote.

... link (0 Kommentare) ... comment
Sonntag, 24. April 2016
Zitate
atimos, 10:52h
Diese Zitate sind in keiner Weise sortiert. Es ist nur eine Ansammlung lustiger Sprüche, die wir von verschiedenen Leuten gehört haben.
O-Ton Charts unserer Reise:
# I want to be nice to her, but I want to kill her. (Ich möchte nett zu ihr sein, aber ich möchte sie umbringen.)
# You can save the world with duct tape. (Man kann die Welt mit Panzerband retten.)
# Broom behind the house.
# Walk in like you own the place. (Geht hinein, als ob euch der Laden gehören würde.)
# It's still Australia, it's still trying to kill you. (Es ist immer noch Australien, es versucht immer noch euch umzubringen.)
# If you have an egg in the fridge, you have a meal. (Wenn du ein Ei im Kühlschrank hast, hast du eine Mahlzeit.)
# There is no rain forest without rain. (Es gibt keinen Regenwald ohne Regen.)
# We trained the dog to stay away from the chickens by putting it on an electric leash. It worked with our daughter, so we figured it might help with the dog. (Wir brachten dem Hund bei sich von den Hühner fern zu halten, indem wir ihn an eine elektrische Leine banden. Es hatte mit unserer Tochter funktioniert, also dachten wir, dass es auch beim Hund funktionieren würde.)
# Aha! I see you happen to have a refractometer. Are you going to measure the Brix?
# “In Germany you don’t eat just butter.” – “It's gwaenchanh-a in Korea.” (“In Deutschland isst man Butter nicht pur.“ – „Es ist ok in Korea.“)
# Your nose, it's not big. It's a mountain. (Deine Nase ist nicht groß. Sie ist ein Berg.)
# Stop hitting on her! (Hör auf sie anzumachen!)
# And then we saw that Christchurch wasn’t so big after all. (Und dann stellten wir fest, dass Christchurch doch nicht so groß war.)
# I mean, this suitcase is almost like a pig on wheels. (Ich meine, dieser Koffer ist fast wie ein Schwein auf Rädern.)
# Das Zusammenleben mit Koreanern und zwei Badezimmern entwickelt sich zu einer Geduldsprobe.
# Die Japaner sehen so japanische aus.
# „Do you like it?“ - „No.“ - „Why do you eat it?“ - „I don't know.“ („Magst du es?“ - „Nein.“ - „Warum isst du es dann?“ - „Ich weiß es nicht.“)
# Die sehen in ihren Uniformen auch aus, als wären sie aus Nordkorea abgehauen.
# Dieses Land braucht eine Armee.
# Let's do the Korean thing. (Lass uns die koreanische Sache machen.)
# Sind Sie im Ernst?
# It is oddly satisfying. (Es ist seltsam befriedigend.)
# You are very pale. That's beautiful, but you look dead. (Du bist sehr blass. Das ist sehr schön, aber du siehst tot aus.)
# „Bitte sag mir, dass mein Hintern in Ahjuma-pants nicht so dick aussieht.“ – „Weiß nicht. Steh auf.“
O-Ton Charts unserer Reise:
# I want to be nice to her, but I want to kill her. (Ich möchte nett zu ihr sein, aber ich möchte sie umbringen.)
# You can save the world with duct tape. (Man kann die Welt mit Panzerband retten.)
# Broom behind the house.
# Walk in like you own the place. (Geht hinein, als ob euch der Laden gehören würde.)
# It's still Australia, it's still trying to kill you. (Es ist immer noch Australien, es versucht immer noch euch umzubringen.)
# If you have an egg in the fridge, you have a meal. (Wenn du ein Ei im Kühlschrank hast, hast du eine Mahlzeit.)
# There is no rain forest without rain. (Es gibt keinen Regenwald ohne Regen.)
# We trained the dog to stay away from the chickens by putting it on an electric leash. It worked with our daughter, so we figured it might help with the dog. (Wir brachten dem Hund bei sich von den Hühner fern zu halten, indem wir ihn an eine elektrische Leine banden. Es hatte mit unserer Tochter funktioniert, also dachten wir, dass es auch beim Hund funktionieren würde.)
# Aha! I see you happen to have a refractometer. Are you going to measure the Brix?
# “In Germany you don’t eat just butter.” – “It's gwaenchanh-a in Korea.” (“In Deutschland isst man Butter nicht pur.“ – „Es ist ok in Korea.“)
# Your nose, it's not big. It's a mountain. (Deine Nase ist nicht groß. Sie ist ein Berg.)
# Stop hitting on her! (Hör auf sie anzumachen!)
# And then we saw that Christchurch wasn’t so big after all. (Und dann stellten wir fest, dass Christchurch doch nicht so groß war.)
# I mean, this suitcase is almost like a pig on wheels. (Ich meine, dieser Koffer ist fast wie ein Schwein auf Rädern.)
# Das Zusammenleben mit Koreanern und zwei Badezimmern entwickelt sich zu einer Geduldsprobe.
# Die Japaner sehen so japanische aus.
# „Do you like it?“ - „No.“ - „Why do you eat it?“ - „I don't know.“ („Magst du es?“ - „Nein.“ - „Warum isst du es dann?“ - „Ich weiß es nicht.“)
# Die sehen in ihren Uniformen auch aus, als wären sie aus Nordkorea abgehauen.
# Dieses Land braucht eine Armee.
# Let's do the Korean thing. (Lass uns die koreanische Sache machen.)
# Sind Sie im Ernst?
# It is oddly satisfying. (Es ist seltsam befriedigend.)
# You are very pale. That's beautiful, but you look dead. (Du bist sehr blass. Das ist sehr schön, aber du siehst tot aus.)
# „Bitte sag mir, dass mein Hintern in Ahjuma-pants nicht so dick aussieht.“ – „Weiß nicht. Steh auf.“
... link (0 Kommentare) ... comment
Montag, 21. März 2016
Kyoto – August 2015
atimos, 21:00h
Wie sich herausstellte, lagen Osaka und Kyoto gar nicht so weit auseinander, wie ich immer den Eindruck hatte. Das befähigte uns zu einem ausgiebigen Frühstück und einem gemütlichen Spaziergang zur Haltestelle. In Anbetracht unseres Gepäcks war mehr als ein Schlendern eh nicht möglich, aber auch darin hatten wir bereits einige Erfahrung. Mit dem japanischen Äquivalent eines Regionalexpresses brauchten wir gerade einmal 35 Minuten vom Hauptbahnhof Osaka bis zu jenem in Kyoto, was uns beide sehr glücklich stimmte.
Als wir dann schneller als erwartet in Kyoto ankamen, wollten wir die günstige Gelegenheit nicht ungenutzt verstreichen lassen, sondern uns gleich nach Fahrkarten für einen Ausflug in die Region erkundigen.

Dieser Teil der Erzählung verdient eine eigene Überschrift:
Wie wir versuchten eine Fahrkarte zu bekommen – oder die Suche nach dem Passierschein A38.
Im Internet hatten wir von einem Regionalpass, dem Kansai Area Pass, gelesen, mit dem man für relativ wenig Geld den ganzen Tag durch die Gegend tingeln konnte. Außerdem wollten wir noch einmal persönlich fragen, wie viel eine Fahrt mit dem Zug nach Tokyo kosten würde. Da wir mittlerweile aber mit dem chaotischen japanischen Schienensystem vertraut waren, wussten wir nicht, wo wir danach fragen konnten. Um unsere Suche abzukürzen – dachten wir uns – und kein unnötiges Risiko einzugehen, sprachen wir die erstbeste Information an, auf die wir trafen. Wir nahmen an, die Leute wüssten, wo ein JR Schalter wäre, denn immerhin arbeiteten sie in diesem Gebäude. Wie eingangs erwähnt waren wir gerade erst angekommen und hatten keine Ahnung von der Lage, Konstruktion oder Größe dieses Gebäudes, das sich unschuldigerweise „Hauptbahnhof“ nannte.
Den kärglichen Anweisungen des Mitarbeiters folgend gingen wir einmal quer durch die Halle, um dort die Rolltreppe hoch zu fahren. Englisch war nicht die Stärke dieses Japaners, aber wir waren in der Lage zu kommunizieren. Am Schalter angekommen, sahen wir schon ein Schild, das keine guten Nachrichten verheißen konnte. Hier wurden nur Fahrkarten für den heutigen Tag verkauft. Darüber hinaus waren die Englischkenntnisse dieses Angestellten sehr schlecht, so dass er uns nach dem ersten Satz an einen Kollegen verwies. Mit Händen und Füßen versuchte er uns den Weg möglichst genau zu beschreiben und wir nickten freundlich, bevor wir gingen. Die Rolltreppe runter, die Rolltreppe daneben wieder rauf, um die Ecke, durch den Ausgang der geschlossenen Fahrkartenzone, zum nächsten Schalter.
Der Herr, der uns nun gegenüber saß, verstand einige Schlüsselwörter auf Englisch, aber bei allem nicht die zusammenhängenden Sätze, die wir produzierten. Er verstand, wohin wir wollten. Er zeigte uns auch, wie viel das Ticket kosten würde. Er begriff aber nicht, dass wir uns über andere Pässe als den JR-Pass erkundigen wollten und dass wir noch andere Informationen suchten. Allem Anschein nach war das doch nicht der Schalter, den wir suchten. Bevor es noch weiter ausuferte, schickte er uns zu seinen Kollegen. Immerhin reichte sein Sprachvermögen, um uns den Weg zu erklären. Mittlerweile war ich so weit, es ihm hoch anzurechnen.
So kamen wir in die erste Filiale von Shinkanzen und JR. Vorher waren es nur einzelne Schalter mit einzelnen Mitarbeitern, aber hier fanden sich mehrere Leute auf einmal hinter der Theke. Auf die Frage hin, ob es eine günstigere Schienenverbindung nach Tokyo gab, antwortete man uns, dass es lange dauern würde. Es war der Punkt erreicht, an dem ich langsam die Geduld verlor und die Dame auf der anderen Seite dies zu spüren bekam. Ich sagte ihr deutlich heraus, dass es mich nicht interessiere, wie lange es dauerte, ich wolle den Preis wissen. Das war fast schon zu viel für diese zartbesaitete Asiatin, doch sie suchte uns einen Preis heraus und sagte anständig, dass die Fahrt 10 Stunden in Anspruch nehmen würde. Wir machten Fortschritte. Als es aber um den Kansai Area Pass ging, den wir haben wollten, konnte sie uns auch nicht mehr weiter helfen, so dass sie uns zu ihren Kollegen in einem anderen Teil des Gebäudes schickte.
Bei der nächsten Verkaufsstelle für Zugfahrkarten, der vierten mit der Überschrift Shinkanzen and JR mittlerweile, kamen wir einen Schritt weiter, auch wenn wir dabei zwei Schritte zurück machten. Ja, es gab diesen Tagespass, den wir wollten. Nein, wir konnten ihn nicht hier erwerben. Das Unternehmen JR West stellte diese Art von Tagespass aus. Um dorthin zu gelangen, mussten wir aus der Verkaufsstelle raus, rechts, die Rolltreppe hoch zur Fußgängerüberführung, auf der anderen Seite wieder runter, um dort eine Filiale aufzusuchen. Ich musste sehr tief durchatmen – mehrfach.
Wir nahmen diese Pilgerreise immer noch mit schweren Rucksäcken beladen auf uns. Auf der anderen Seite der Fußgängerüberführung angekommen blickten wir nach links, nach rechts, fanden einige nützliche Schilder vor und folgten diesen. Bei JR West angelangt bestätigte man uns, dass es diesen Pass gäbe, dass er auch den Preis hatte, den wir im Internet nachgelesen hatten und dass er von eben jenem Unternehmen ausgestellt wurde, in dessen Filiale wir uns gerade befanden. Allerdings war diese Stelle nicht dafür zuständig. Wir sollten in die zentrale Verkaufsstelle gehen, die rechts, die Rolltreppe runter im Erdgeschoss und dann noch einmal rechts anzufinden war. Ich wünschte, ich könnte ein passendes Emot-Icon einfügen, das meinen Gemütszustand zu diesem Zeitpunkt adäquat wiedergeben würde. Da dem nicht so ist, begnüge ich mich mit einer Umschreibung. Ich blinzelte den Sachbearbeiter nichtssagend an. Nach einiger Zeit lächelte ich freundlich, bedankte mich und wir verabschiedeten uns.
Da wir besagte Zentrale Verkaufsstelle nicht auf Anhieb fanden – ja, Kyoto Station an sich ist schon ein Labyrinth, da braucht man schon einen Kompass, um überhaupt den Ausgang zu finden, aber wenn man eine Fahrkarte will, sollte man Verpflegung mitnehmen –, kehrten wir in die Touristeninformation ein, um uns nach dem Weg zu erkundigen. Man händigte uns einen Lageplan des Gebäudes aus. An diesem Punkt akzeptiere ich nie wieder Witze darüber, dass ich mich in Gebäuden, insbesondere Kaufhäusern, verlaufen kann. Wenn ich mich in der Lotte Mall verlief, war ich zumindest sicher, dass ich überleben würde, bis meine Reisebegleitung oder das Sicherheitspersonal mich fand, denn es gab wirklich überall Verpflegung und alle Annehmlichkeiten des zivilisierten Lebens. Hier war ich mir nicht so ganz sicher. Wir brauchten tatsächlich einen Lageplan, um einen Schalter zu finden. Die Dame überließ uns zudem Stadtkarte, Informationsbroschüre, Sightseeing-Guide und Liniennetzplan. Ich würde ja gerne etwas Positives darüber schreiben, aber ich bin noch nicht durch.
Wir folgten den Anweisungen der Dame, nur um festzustellen, dass sie uns zum Schalter mit Bustickets gelotst hatte. Als wir dessen gewahr wurden, verzichteten wir es in der Schlange zu warten, bis wir an die Reihe kamen. Stattdessen gruben wir unsere Nasen in den Lageplan und fanden mit vereinten Kräften einen Schalter, an dem man uns eventuell weiterhelfen konnte.
In dieser Filiale hatte man die ganze Angelegenheit ein bisschen aufgeteilt: Da gab es den Schalter für Japaner und einen für Ausländer. Ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher, ob das praktisch oder rassistisch war. Ungeachtet meiner persönlichen Vorbehalte stellten wir uns brav in die richtige Schlange und warteten erneut darauf an die Reihe zu kommen. Es gab allerdings nur einen Schalter für Ausländer, aber sehr viele Anfragen und Gäste. Langsam rückten wir dem Schalter näher. Bevor wir jemals ankamen, preschte eine weitere Mitarbeiterin vor und stellte den Wartenden Fragen, nur um die meisten dann unverrichteter Dinge in der Schlange stehen zu lassen. Ihre Funktion verstand ich nicht so ganz. Schließlich kam sie bei uns an und fragte uns, was wir wollten. Wir erklärten ihr unser Anliegen, dass wir den Kansai Area Pass wollten sowie einiger Informationen bezüglich einiger Verbindungen. Sie zog uns zur Seite und suchte die Verbindung, nach der wir gefragt hatten, heraus. Dann zeigte sie uns das Ergebnis.
Das war ja schön und gut, dass sie es auf ihrem Tablett hatte, aber dieses Gerät konnte ich nicht mitnehmen. Wir baten sie uns die Informationen irgendwie auszuhändigen, vorzugsweise schriftlich. Also schrieb sie uns einige Haltestellennamen auf. Wir sahen sie an wie ein Auto – nur nicht so schnell. Langsam, beherrscht fragten wir sie nach den Linien, die wir nehmen mussten. Um dieser ganzen Farce die Krone aufzusetzen, verlangten wir auch noch so etwas wie Fahrtdauer und Ticketpreis. Widerwillig ergänzte die Dame diese Informationen. Langsam gewann ich den Eindruck ein Störfaktor zu sein, den sie durch ihre plumpe Art zu beseitigen suchte. Ich habe noch nie so nutzlose Informationen bezüglich Bahnverbindungen bekommen. Als ich zu guter Letzt noch nach den Abfahrtszeiten fragte, tat sie es schnippisch mit einer ungenauen Zeit ab. Offensichtlich war es höchste Zeit uns zu bedanken und zu verabschieden.
Mittlerweile völlig entkräftet wollten wir das Risiko einer Fehlinformation nicht noch einmal eingehen, weshalb wir die Dame in Ruhe ließen und uns jemand anderen suchten, der uns bei der Suche nach unserer Herberge weiterhelfen konnte. Immerhin wussten wir bereits, dass wir dafür die U-Bahn nehmen mussten und diese von einem ganz anderen Unternehmen betrieben wurde als der Tagespass, nach dem wir uns soeben erkundigt hatten. Vor der zentralen Verkaufsstelle fand sich ein kleiner Tisch mit einer allgemeinen Information. Dies schien ein guter Anlaufpunkt für unser Anliegen zu sein. Dieses Mal kamen wir auch schnell an die Reihe und erhielten die gewünschte Information.
Nach neuneinhalb Schaltern und zwei Stunden Suche begaben wir uns in die U-Bahn, da wir langsam Hunger bekamen und Luft holen mussten. Eine Fahrkarte hatten wir bisher wohlgemerkt noch nicht.
Auch wenn die folgende Beschreibung dem tatsächlichen Ablauf ein bisschen vorauseilt, dachte ich mir, dass es besser wäre, dieses Abenteuer in einem zusammenhängenden Stück zu berichten, anstatt später darauf zurückzukommen.
Wir beschlossen eine weitere Quelle aufzusuchen und fragten einfach unsere derzeitigen Gastgeber. Freundlich, wie sie waren, suchten sie uns die Verbindung von Haustür zu Haustür heraus, schrieben sie auf – inklusive Bahnlinien, Bahnhöfen zum Umsteigen, Bahnunternehmen, Umsteigezeiten, Fahrpreis und Fahrtdauer – und händigten uns dieses bunt untermalte Informationsblättchen aus.
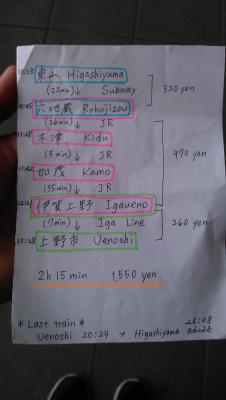
Das war mehr als ich erwartete hatte und entschieden besser als der Service der JR West. Leider kamen dabei ganz andere Strecken, Preise und Fahrzeiten zustande, so dass wir wieder bei null anfingen, weshalb wir noch einen Besuch bei der Verkaufsstelle anstrebten, um noch einmal genau nachzufragen und zu vergleichen.
Zwei Tage später standen wir auf der Matte, es war gerade kein weiterer Kunde vor uns, und hakten noch einmal genau nach. Es war wieder die Mitarbeiterin vom letzten Mal da, doch sie schien uns nicht wiederzuerkennen – oder machte es jedenfalls nicht deutlich. Wie dem auch sei, wir stellten unsere Frage, bekamen dieses Mal sogar eine ausgedruckte Streckenverbindung. Daraufhin legten wir ihr die Verbindung vor, die unser Gastgeber herausgesucht hatte, und fragten, was es damit auf sich habe, ob wir auch so fahren könnten. Die Dame betrachtete den Zettel, schlug ihr Tablett auf und sah nach. Mit einer der notierten Linie konnte sie gar nichts anfangen, weshalb ihre Kollegin einen Wälzer in der Größe des Telefonbuchs von Berlin rausholte und darin nachschlug, welche Linie das war. Sie bestätigte uns, dass wir auch so fahren konnten, ebenso wie sie uns bestätigte, dass wir für die U-Bahn extra zahlen mussten. Auf den ersten Blick sahen wir, dass sich der Kansai Area Pass so auf keinen Fall lohnen würde. Denn der Kansai Area Pass galt ausschließlich für die Züge der JR, was weder U-Bahn, Busse noch Bahnen von Privatunternehmen einschloss. Die einfache Hin- und Rückfahrt nach Iga wäre immer noch günstiger als dieses Scheinangebot von JR West.
Wir fragten noch, wo wir künftige Reiserouten nachsehen konnten, weil wir nicht jedes Mal zu einem Schalter kraxeln wollten, ob es einen Liniennetzplan und eine Website gäbe. Man erklärte uns, dass es eine App gab, die Japaner nutzten, aber sie war nur auf Japanisch. Ich war baff. So wie die Dame es darstellte, gab es für mich als Besucher nicht die geringste Möglichkeit irgendwie selbstständig von A nach B zu gelangen, wenn mir die Strecke nicht bereits bekannt war. Das trotz boomender Touristenzahlen. Selbst in meiner Heimatstadt, die nicht einmal halb so viele Einwohner wie Kyoto hat und nicht gerade vor Touristen überschäumt, findet sich eine bessere Einstellung zu internationaler Klientel.
Franziskas Blick wanderte zu mir, meiner zu ihr, beide sahen wir uns verständnislos an. Wir bedankten uns, nickten freundlich, sahen ein, dass die beiden Damen nichts dafür konnten, und gingen unserer Wege. Es war frustrierend.
Fazit dieses Unterfangens: Die spinnen, die Japaner. Ob sie sich nun diesen Zirkus mit dem Schienensystem bei den Deutschen abgeschaut haben oder es umgekehrt der Fall ist, spielt für mich nicht die geringste Rolle. Das System ist so kompliziert, dass nicht einmal Muttersprachler, die bei JR arbeiten, durchblicken und ihre Probleme haben, die richtige Fahrkarte für den richtigen Tag zu bekommen. Zu allem Überfluss sind die ganzen Angebote mit ihren verschiedenen Pässen nur dann sinnvoll, wenn man 75% seiner Zeit im Zug verbringt. Will man dieses Transportmittel aber nur dazu nutzen, um von einem Ort zum anderen zu kommen, weil man sich etwas ansehen will, also tatsächlich aus dem Zug aussteigt, lohnt sich kaum ein „Angebot“. Da können sie noch so pünktlich sein, wie sie wollen, kundenfreundlich ist anders. Mit jedem Schritt, den ich tiefer in dieses Land vordrang, vermisste ich Korea mehr. Die Koreaner, von den Japanern oftmals als Barbaren bezeichnet, bewiesen, dass ein effizientes, pünktliches Schienennetzwerk auch einfach sein konnte.
Wir machten uns also auf den Weg zu unserer neuen Herberge, um endlich eine Pause einlegen und etwas zu essen bekommen zu können. Glücklicherweise fanden wir die U-Bahn ohne weitere Probleme und hatten von den Hostelbesitzern eine detaillierte Wegbeschreibung bekommen, so dass wir zuversichtlich waren.
Hier möchte ich noch ein erstaunliches Phänomen einschieben, das uns in Kyoto auffiel. Während wir in Korea überall auf Spiegel gestoßen sind, waren sie in Japan eher spärlich gesät. Aber auf einmal fanden wir sie in U-Bahnhöfen, mitten auf dem Treppenabsatz, und fragten uns, woher der Sinneswandel kam. Es dauerte einige Zeit, bis wir begriffen, dass diese Spiegel nicht der Ästhetik dienten, sondern ganz praktische Zwecke hatten: Wie im Straßenverkehr sollten sie genutzt werden, um den entgegenkommenden Fußgängerverkehr einzuschätzen und diesem gegebenenfalls auszuweichen. Erstaunlich.
Wir stiegen an der richtigen Haltestelle aus, gingen die Treppe hoch, wandten uns nach links, dann nach einigen Schritten wieder nach links und standen in einer dieser überdachten Einkaufspassagen.

Irgendwo in dieser Höhle war unsere neue Herberge zu finden, das OKI’s Inn. Bei der Suche nach einer geeigneten Unterkunft in Kyoto hatten wir uns einige Angebote durchgelesen. OKI’s Inn hatte letztlich das Rennen gemacht, weil es beteuerte ein traditionell japanisches Ambiente zu vermitteln. Das war nicht untertrieben. Wir schlurften durch die Einkaufspassage, blickten nach rechts und links, um auch nichts zu verpassen und standen plötzlich vor einer holzvertäfelten Schiebetür, neben der ein Schild positioniert war.

Der erste Eindruck war schon vielversprechend. Wir wollten es traditionell, wir sollten es bekommen. Als wir eintraten erwischten wir die Herbergsleiter oder –besitzer gerade bei der Arbeit, denn sie waren mit dem Herrichten der Zimmer noch nicht fertig. Im Eingangsbereich standen Fahrräder, die man mieten konnte; der Raum dahinter beherbergte die Rezeption. Wir wurden sofort freundlich begrüßt, man erklärte uns, dass das Zimmer noch nicht fertig sei, aber dass wir unser Gepäck gerne schon abstellen durften, wenn wir draußen etwas unternehmen wollten. Selbstverständlich wollten wir das, immerhin hatte ich Hunger. So nahmen wir das Angebot unserer Gastgeber dankend an und zogen wesentlich leichter beladen wieder von dannen.
Draußen angekommen standen wir vor der Frage, was wir essen sollten – und vor allem wo. Bei der Wahl unserer Unterkunft hatten wir dieses Mal überhaupt nicht auf die Location geachtet, da wir davon ausgingen, dass man überall irgendwie mit der Bahn, dem Zug oder dem Bus hinkommt. Wir hatten dabei völlig vergessen an unsere Grundbedürfnisse, wie beispielsweise Verpflegung zu denken, weil es bisher immer irgendwie geklappt hatte. In Neuseeland hatten wir meistens großzügige Gastfamilien oder die Städte waren so klein, dass alles fußläufig erreichbar war. Hier war es wieder an der Zeit, umzudenken und sich vorzubereiten.
Wir waren ja bereits darauf gestoßen, dass man in Japan nicht überall einfach so etwas zu essen bekam, und dieser Gedanke sickerte nur widerwillig in unser Bewusstsein. Was wir allerdings gänzlich vergessen hatten und womit wir noch nicht konfrontiert worden waren, war die Tatsache, dass auch Restaurants eine Pause haben konnten, die für gewöhnlich zwischen dem Ansturm am Mittag und jenem am Abend erfolgte. Zudem gab es Ruhetage. In Deutschland ein bewährtes Konzept, war dies in Korea doch ein Frevel, auf den wir nicht mehr vorbereitet waren.
Letzten Endes standen wir gerade zu dieser Pausenzeit vor der verschlossenen Tür des einzigen Restaurants in der näheren Umgebung, das diesen Titel verdient hätte. Glücklicherweise fand sich nicht weit von uns noch ein McDonalds, das an diesem Tag als Retter in Not gefeiert werden musste.
Ich möchte damit keinesfalls zum Ausdruck bringen, dass es in der Nähe von OKI’s Inn nichts gab. Das Angebot war einfach nicht so reich, wie wir es in letzter Zeit gewohnt waren. Es dauerte lange Zeit, bis wir umgedacht hatten und uns auf die veränderten Lebensbedingungen einstellten.
Nach dem Essen war es immer noch zu früh zum Einchecken, weshalb wir beschlossen die Umgebung auszukundschaften. Wir hatten die Karte aus dem Touristenbüro am Hauptbahnhof parat, weshalb wir zielsicher irgendwo dort entlang gingen.
Unsere erste Sehenswürdigkeit sollte der Heian Jingu Schrein werden, der schon von weitem durch ein riesiges, rotes Tor angekündigt wurde. Da ich mit dem Maßstab der Karte noch nicht vertraut war, hielten wir auch hier die Augen offen, um das Tor auf keinen Fall zu verpassen. Immerhin waren wir dieses Mal nur einfach Touristen. Die Sorge entpuppte sich allerdings als völlig überflüssig, da besagtes rotes Tor tatsächlich enorm war. Bereits von der Hauptverkehrsstraße aus konnte man es irgendwo in der Ferne erkennen, und als wir näher kamen, verlor es keinesfalls an Eindruckskraft.


Wir durchschritten es, um uns auf dem breit angelegten Fußgängerpfad dahinter dem Schrein zu nähern. Links und rechts von uns standen Absperrungen, die durch froschförmige Poller gehalten wurden. Allem Anschein nach machten sich die Behörden Kyotos Sorgen um den Rasen. Das gesamte Tempelgelände war mit kleinen Kieselsteinen belegt, zwischen denen vereinzelt Bäume wuchsen. Selbstverständlich waren diese gezielt gepflanzt, gehegt und gepflegt worden.
Der Schrein wollte dem Tor in farblichen Angelegenheiten Konkurrenz machen. Rot wechselte sich mit Weiß ab, ab und zu stach Gold hervor und die Dächer zierte ein gräuliches Grün.

In Anbetracht der schieren Größe dieses Komplexes erstaunte es mich die ganze Zeit, dass hier nur von einem Schrein die Rede war und man darauf verzichtete es einen Tempel zu nennen. Worin genau der Unterschied lag, bleibt mir anhand der gesehenen Bauten ein Rätsel. Wir drehten eine Runde über das Gelände, ließen unsere Füße mehr oder weniger entscheiden, wohin es gehen sollte, betrachteten die Ecken und Winkel dieses Komplexes, bevor wir uns dazu entschieden, weiterzuziehen.
Auf unserer Karte waren noch weitere Tempel und Schreine eingezeichnet, so dass wir es uns nicht nehmen wollten, auch diesen einen Besuch abzustatten. Immerhin waren wir nun satt und hatten noch genügend Zeit, bevor wir einchecken konnten. Also brachen wir auf, erneut durch das riesige rote Tor, diesmal in entgegengesetzter Richtung, um weitere religiöse Ortschaften aufzusuchen.
Für all jene, die sich mit Kyoto nicht sonderlich gut auskennen: Es gab Tempel und Schreine en masse. Einige davon wurden als besonders sehenswert hervorgehoben und von diversen Reiseanbietern angepriesen, wohingegen andere einfach nur den alltäglichen Bedürfnissen der Bevölkerung dienten. Ungeachtet ihrer Popularität gab es immer wieder Elemente, die sich wiederholten, und gleichzeitig Einzigartigkeiten, die sie gegeneinander abgrenzten. Kurzum: Es gab viel zu sehen.
Unser nächstes Ziel war der Schoren-in Tempel, der ein bisschen versteckt lag und aus einer sehr schön gepflegten Anlage bestand.

Auch hier sahen wir uns gerne um. Auch wenn alle Wege befestigt waren und man sich selbst im schlimmsten Regen sicher hätte bewegen können, wirkte dieser Tempel eiladender und grüner als der Koloss von vorhin.
Weiter dieselbe Straße runter fand sich ein weiterer Tempel, der den Namen Chion-in Tempel trug. Also, auch wenn der Heian Jingu Schrein schon ein protziges Bauwerk war, weiß ich nicht so ganz, welches Wort ich für den Chion-in Tempel verwenden soll.

Und das war nur der Eingang. Das gesamte Gelände erstreckte sich über eine beachtliche Menge an Quadratmetern, die zudem kunstvoll zugebaut und –pflanzt waren.
Einige der Gebäude konnte man einsehen, andere wiederum betreten, was wir natürlich ausnutzten. Auch wenn ein Teil der Anlage gerade saniert wurde, hatten die Verantwortlichen alles in ihrer Macht stehende getan, um Besucher trotzdem anzulocken und ihnen den Zugang zu ermöglichen. Immerhin war dies auch ein geheiligter Ort für die Bewohner der Gegend.
Auch wir machten uns auf, um diesen Teil der Anlage in Augenschein zu nehmen. Am Fuß der nicht allzu hohen Treppe, die zu einem wichtigen Gebäude führte, fanden wir Kisten mit Tüten für die Schuhe. Anfangs verstanden wir nicht, denn wir gingen davon aus, dass wir nur die Treppe hoch, einmal um das Gebäude herum und die Treppe wieder hinunter gehen würden. Letzten Endes passierte eben dies. Allerdings war die Runde um das Gebäude doch größerer Natur als zuerst angenommen.
Wir planten unsere Schuhe abzustellen und hinein zu gehen, doch daraus wurde nichts. Eine Dame mittleren Alters hielt uns auf. Sie sprach kein Wort Englisch, das hinderte sie aber keinesfalls daran, uns behilflich sein zu wollen. Sie drückte uns je eine Tüte in die Hand und erklärte uns mit Gesten, dass wir die Schuhe dort hineinpacken sollten. An diesem Punkt war es uns nicht mehr möglich ihr zu wiedersprechen, weil wir nicht unhöflich erscheinen wollten. Daher befolgten wir ihren gut gemeinten Ratschlag und nahmen unsere Schuhe mit, obwohl uns nicht der Sinn danach stand. Es war eine lustige Begebenheit, die uns wieder vor Augen führte, wie freundlich Fremde doch sein wollten.
Oben angekommen wurden wir von einer großen, güldenen Buddhastatue begrüßt.

Wir wandten uns nach rechts, um das Gebäude zu umrunden, und stellten fest, dass es hier weiter ging. Ein überdachter Weg führte zu einem etwas weiter entfernt stehenden Gebäude. Schon bei den ersten Schritten auf diesem ach so unscheinbaren Dielenboden merkte ich, dass etwas seltsam war. Er war glatt und eben, sah wunderbar gepflegt aus, und doch quietschte es bei jedem Schritt leise. Tatsächlich standen wir auf einem Nachtigallenboden, ohne dass uns jemand darauf vorbereitet hätte. Ich hatte es mir anders vorgestellt, vor allem lauter. Stattdessen war es nur ein leises Fiepen, das bei jedem Schritt zu hören war. Da ich es mir sehr gewünscht hatte, mal über solch einen Boden zu laufen, wenn sich die Gelegenheit ergab, war ich mehr als zufrieden. Ich war begeistert. Ich hätte stundenlang nur hin und her laufen können, aber ich wollte zumindest ein Mindestmaß an Anstand wahren und mich nicht wie ein völlig bekloppter Ausländer aufführen.

Das Innere des Tempels war verschachtelt, verworren und richtig groß. Viele abzweigende Gänge waren nur dem Personal, also den Mönchen vorbehalten, so dass wir Besucher große Teile der Anlage gar nicht zu Gesicht bekamen. Was wir aber sahen, waren lange Gänge, geräumige Hallen, Statuen und Statuetten von Buddha, versteckte Gärten, die von Gebäuden umschlossen waren. So langsam erklärte sich auch, warum man zu Anfang dazu angehalten wurde die Schuhe mitzunehmen: damit man die inneren Gärten betreten konnte.
Nach einiger Zeit gemütlichen Schlenderns entschieden wir uns für den Rückweg, um uns das Tempelgelände außerhalb dieser Baustelle anzusehen. Es gab große Glocken in Pavillons, einen angelegten Teich, über den eine Brücke führte, Grünflächen, Bäume, aber auch sehr viele Kieselwege.

Ich weiß nicht, wie es uns gelungen war, aber auch dieses Mal hatten wir es versäumt, die vom Architekten vorgegebene Richtung zu wählen, nämlich durch den Haupteingang einzutreten, sondern wir kamen durch einen hinteren Nebeneingang auf das Gelände. Ergo: Das riesige Eingangstor sahen wir relativ spät. Einigen Traditionen folgt man offensichtlich auch unbewusst. Stattdessen schlenderten wir erst einmal über das Gelände, gingen dann die breite Treppe hinunter und auf das Tor zu.
Da wir gerade in der Gegend und in Stimmung waren, wandten wir uns nach links, um auch dem Park neben dem Tempel einen Besuch abzustatten. Künstliche Wasserläufe, grüne Inseln zwischen gewundenen Pfaden, zurechtgestutzte Bäume und Büsche, ja, das alles sah sehr japanisch aus.
Nach einer kurzen Runde gingen wir wieder zur Herberge, um endlich einzuchecken. Vor Ort angekommen, stellten wir freudig fest, dass alles für uns bereit war. Wie gebucht bekamen wir unsere Betten im Vierbettzimmer und stutzten erst einmal. Der Raum war ungefähr so groß wie unserer Herberge in Seoul, aber anstatt zwei Personen sollten hier vier nächtigen.
Es gab genau Platz für zwei Hochbetten und die Leitern, um auf die oberen Betten zu gelangen. Wer Gepäck mitbrachte, wusste nicht, was er tat. Es gab wirklich keine Ecke, in der man einen Koffer – oder in unserem Fall Reiserucksack – hätte unterbringen können, ohne dass dieser im Weg war.

Es machte mir erstaunlich wenig aus. Auch wenn die Herberge in Osaka im Vergleich dazu eine Luxusloft war, war das allgemeine Ambiente von Oki’s Inn einfach nur klasse. Wir verbrachten tatsächlich nur so viel Zeit in dem Zimmer, um zu schlafen.
Der größte Knackpunkt war tatsächlich das Bett. Nachdem ich sechs Wochen lang in Seoul in brütender Hitze auf dem oberen Bett genächtigt hatte, machte ich meiner Reisebegleitung deutlich, wo ihr Platz für die restlichen Wochen sein würde. Also bezog ich hier den unteren Posten, der genau wie der obere mit einem Rahmen versehen war, damit man nicht zufällig hinausrollte. Für die oberen Betten ist das eine durchaus sinnvolle Erfindung, befindet sich die Schlafstatt allerdings ebenerdig, sehe ich darin mehr ein Hindernis als eine Hilfe. Ich habe mir mehr als einmal den Kopf am oberen Rahmen gestoßen, nur weil ich aus meinem Käfig raus wollte.
Das Gros unserer Zeit im Oki’s Inn verbrachten wir im geräumigen, traditionell eingerichteten Wohnzimmer – wenn man diesen Raum so nennen darf.

Ein Raum auf Kniehöhe, dessen Boden mit Tatamimatten ausgelegt war, lud zum Verweilen, Sozialisieren und Essen gleichermaßen ein. Man kam in die Räumlichkeit durch gläserne Schiebetüren; am Haupteingang gab es eine kleine Veranda. Selbstverständlich betrat man das Zimmer ohne Schuhwerk und lümmelte sich gemütlich auf dem Boden oder den dafür vorgesehenen Kissen.
Wir verbrachten die meiste Zeit am runden Tisch, obwohl er kleiner war. Dort nahmen wir viele Mahlzeiten ein, unterhielten uns mit anderen Gästen des Hostels, trafen die Katzen der Inhaber und hatten sehr viel Spaß.
Links vom Gemeinschaftsraum fand sich eine kleine Küche, die noch spartanischer eingerichtet war als jene im Inno Hostel in Seoul. Es gab ein Waschbecken, eine Mikrowelle, einige Töpfe und Teller sowie zwei Herdplatten. Darüber hinaus bot das Oki’s Inn kostenlos Tee für seine Besucher an – ein herrlicher Service.
Ein kleiner überdachter Innenhof verband die verschiedenen Gebäude miteinander. Der Empfangsbereich mit angrenzenden Schlafquartieren war von Gemeinschaftsraum und Badezimmern getrennt. Ein einsamer, junger Baum stand inmitten der Gebäude und zwang die Gäste zu einem minimalen Umweg. Der Einfachheit halber stellte man uns Badelatschen zur Verfügung, um schnell mal von A nach B gehen zu können, ohne festes Schuhwerk unterschnallen zu müssen. Immerhin betraten wir das Schlafzimmer auch barfuß.

Es war eine wirklich urige Herberge mit sehr viel Charme, Stil und herausragenden Inhabern. Ich weiß bis heute nicht, wie sie heißen. Wir trafen lustige Leute dort, bekamen immer Unterstützung, wenn wir sie brauchten, und genossen unsere Zeit. Eine hervorragende Wahl, weshalb ich das OKI’s Inn jedem gerne weiterempfehle.
Erwähnenswert finde ich die Geldbeschaffung in Japan. Während Neuseeländer durch und durch auf den Einkauf mit Kreditkarte eingestellt sind und man sich praktisch an jedem Geldautomaten gütlich tun kann, so lange man sein Plastikgeld bei sich führt und unter Umständen zu Mehrausgaben in Form von Gebühren bereit ist, ist dieses Prinzip der bargeldlosen Zahlung in asiatischen Ländern noch nicht so weit verbreitet. Wer sich zudem keine ausreichenden Finanzmittel im Vorfeld zulegt, wird nicht umhin kommen, sich einigen Probleme gegenüberzusehen. In Japan war es uns nicht möglich an jedem beliebigen Automaten jeder beliebigen Bank Geld abzuheben. Seitens unseres Kreditinstitutes gab es diesbezüglich keinerlei Probleme, nein, es waren die japanischen Banken und deren Maschinen, die dies nicht zuließen. Tatsächlich fanden wir nur einen Typ Geldautomat, der unsere Kreditkarten nahm und eine Auszahlung ermöglichte. Diese standen in jedem 7/11 Laden, den wir unterwegs antrafen – oder zumindest stolperten wir immer in ausgerechnet die Läden, die hierbei keine Probleme machten, was ich äußerst begrüße. Einen Haken hatte die Sache dann doch: Man konnte nur Beträge in 10.000-Yen-Schritten abheben (zu Deutsch waren es ungefähr je 100 Euro). Es ist also durchaus möglich ohne Bargeld nach Japan zu fliegen, allerdings ist die Beschaffung desselbigen nicht so einfach wie anderenorts.
Wir erinnern uns daran, dass Lotte nicht omnipräsent ist:

Wie bereits angedeutet liefen wir im Hostel einigen interessanten Leuten über den Weg. Dazu zählte auch Yvette. Die gebürtige Mexikanerin machte gerade in Japan ihren Urlaub und besuchte bei der Gelegenheit einige Freunde, die sie durch frühere Erfahrungen in diesem Land hatte. Wir unterhielte uns gut und oft mir ihr, weshalb wir auch einen gemeinsam Ausflug in Angriff nahmen.
Während ich mir in Südkorea, insbesondere in Seoul, nie Gedanken darum machte, ob ich etwas zu Essen bekäme, wenn wir einen Tagesausflug machten, hatte ich in Japan immer Angst davor Hunger zu leiden. Der Ausflug zum Osaka Castle Museum steckte mir noch in den Knochen. Die Ankunft in Kyoto tat ihr Übriges. Wenn es selbst in Großstädten wie Osaka oder Kyoto nicht üblich war überall Marktstände, Cafés oder Läden zu haben, in denen man wenn schon nicht eine vernünftige Mahlzeit, so doch zumindest einen bezahlbaren Snack ergattern konnte, wie sah es dann in kleineren Agglomerationen aus? Ich machte mir zusehends weniger Sorgen bezüglich eines Kulturschocks, wenn ich wieder nach Hause kam. In Deutschland sah es doch nicht anders aus. Man musste bei Ausflügen immer eigenes Essen mitnehmen oder genau wissen, wann man wo sein würde und in der Nähe ein Restaurant kennen.
Das hielt uns keinesfalls davon ab völlig unvorbereitet, was die Essensfrage betraf, zu einem neuen Ausflug aufzubrechen. Wir nahmen Yvette mit. Unser Ziel war das Nijo Schloss, das sich nur wenige U-Bahnhaltestellen von unserer Herberge befand.
Mit mehr fast 400 Jahren und der Plakette des Weltkulturerbes erwarteten wir jede Menge, auch wenn uns dank der Besichtigung des Osaka Castle Museums noch einige Sorgen plagten. Zu Unrecht, wie sich herausstellte. Das Nijo Schloss ist eine Besichtigung auf jeden Fall wert. Ich empfehle es hiermit ausdrücklich. Dieses Mal waren die 600 Yen eine lohnenswerte Investition.
Wir genossen den imposanten Eingang mit Vorsicht, auch wenn die goldverzierte Holzkonstruktion beeindruckend war.

Dahinter umfingen uns Kieswege, deren Ränder Rasenstreifen und kleine Gartenanlagen säumten. Wir bogen nach links ab, folgten dem Weg und standen plötzlich vor einem Prachtbau, der sich über mehrere Einzelgebäude erstreckte. Korridore verbanden diese miteinander.
Spätestens hier mussten wir mit unserer Tradition brechen und den vorgegebenen Weg gehen, weil es einfach keine andere Möglichkeit gab, das Schloss zu betreten. Drinnen waren Fotos strengstens untersagt. Im Eingangsbereich ließen wir unser Schuhe zurück und begaben uns ins Innere des Komplexes.
Es gab verschiedene Räume, die in vergangener Zeit verschiedene Funktionen erfüllt hatten. Neben dem Wartezimmer und dem Empfangssaal sahen wir auch die Audienzhalle sowie das Schlafquartier des Shoguns. In jedem Raum fanden sich beeindruckende Gemälde, die manchmal direkt auf den Wänden aufgetragen waren, andernorts nur Klappwände zierten. Man hatte sehr viel Gold benutzt, so dass es mitunter erdrückend wirkte. Es handelte sich hauptsächlich um Landschaftsdarstellungen und Naturmalereien. Alles in allem war es ein wirklich beachtlicher Bau, der einen bleibenden Eindruck hinterließ.
Auch hier fand sich in vielen Bereichen ein Nachtigallenboden, so dass ich weiterhin meine Freude damit haben konnte. Die Gang durch den Palast war so konzipiert, dass man eine Runde um alle Räume drehte und diese von fast allen Seiten einsehen konnte. Auf diese Weise lief man nicht in andere Leute hinein, die in entgegengesetzter Richtung unterwegs waren. Nach gründlicher Betrachtung verließen wir dieses künstlerische Meisterwerk wieder, um die umliegenden Gärten zu durchforsten.

Es wurde schnell deutlich, dass die Japaner eine ganz andere Einstellung zur Gartengestaltung und –pflege aufwiesen als ihre Nachbarn im nicht zu fernen Westen.

Es wirkte wesentlich durchdachter und geplanter, als wenn man nur ein bisschen Grün aussäte und ab und zu den Rasen mähte.

In einer Ecke des Gartens fand sich ein kleines Café, das wir gerne aufsuchten. Wir hatten unsere Runde um das Gelände beendet und festgestellt, dass es Zeit für Mittagessen war. In diesem Café hofften wir fündig zu werden. Bereits bei der Annäherung bat uns ein Mitarbeiter vor der Tür enthusiastisch herein, doch wir wollten nicht irgendetwas. Also fragten wir zuerst, ob sie neben Erfrischungsgetränken auch Speisen anboten. Der Mensch vor der Tür sah uns erst einmal verständnislos an, bevor er die Frage verdaute und dann leider verneinte. Für uns hieß dies, dass wir weitersuchen mussten.
So verließen wir beschwingt, aber hungrig das Gelände und sahen uns um. Blanke Häuserzeilen starrten uns entgegen. Einige Autos fuhren auf der Straße vorbei. Kein Hinweis auf ein Lokal in der Nähe. Um nicht ziel- und orientierungslos durch die Gegend zu stapfen, wie wir es in Osaka gemacht hatten, beschlossen wir die Einheimischen um Hilfe zu bitten. Wir gingen zur Information und fragen, ob uns jemand sagen könne, wo es ein Restaurant in der Nähe gäbe. Wieder starrten uns ausdruckslose Augen entgegen, bevor wir ein Nein zu hören bekamen. Wir fragten weiter, doch ohne Erfolg. Letzten Endes mussten wir auf eigene Faust aufbrechen und unser Glück in den Straßen Kyotos versuchen.
Keine 100 Meter weiter fanden wir an einer großen Kreuzung ein einsames Restaurant, vor dem eine kleine Menschentraube stand. Es war Mittagszeit, es war viel los. Einige der Leute entschieden sich, dass sie nicht länger warten wollten und gingen weiter. Wir wollten dieses Risiko nicht eingehen, zumal die Speisekarte draußen vielversprechend aussah. So warteten wir nur wenige Minuten, bevor ein Keller heraussprang, uns nach der Anzahl fragte und uns herein bat.
Leider waren derzeit nur Plätze an der Theke frei, weshalb wir in einer Reihe nebeneinander saßen und uns nicht so gut unterhalten konnten. Aber wir waren vorwiegend wegen des Essens hier, so dass es letzten Endes nicht so schlimm war. Die Speisekarte bot Nudelsuppenvariationen in Hülle und Fülle, doch ich befürchtete, dass es für meinen ausgehungerten Magen nicht genug sein würde. Also bestellte ich neben meiner Portion Ramen noch Gyoza und frittiertes Hähnchen dazu – selbstverständlich für alle.

Es war hervorragend, deliziös. Wir bekamen unsere Bestellung sehr schnell, sie war heiß und gut abgeschmeckt. Außerdem beinhaltete die Portion alles, was ich zu dem Zeitpunkt begehrte. Mein Lob an den Chef.
Da wir gerade wieder beim Thema Essen sind, hole ich jetzt weiter aus, was meine Gewohnheiten in Kyoto betraf.
Im Gegensatz zu anderen Orten, an denen wir während unserer Reise verweilt hatten, kochten wir in Japan überhaupt nicht. Das, was Kochen am nächsten kommt, war die tägliche Zubereitung von Tee. In den Supermärkten nicht weit von OKI’s Inn gab es eine recht gute Auswahl an Fertiggerichten, die man wahlweise warm oder kalt essen konnte. Zum Frühstück holten wir uns meist irgendetwas Sushi-Artiges, während ich abends mal dies, mal das kaufte. Auch wenn ich das Essen nicht schlechtreden möchte, so erfüllte es doch nicht so ganz meine Standards, was vor allem an der Temperatur lag. Ich hatte mich dermaßen an glühend heiße Speisen gewöhnt, dass mir der kalte – oder im besten Fall lauwarme – Reis langweilig vorkam. Selbst wenn ich mir die Gerichte aufwärmte, was der Einfachheit halber in der Mikrowelle geschah, boten sie kein nennenswertes Geschmackserlebnis. Ich versuchte verschiedene Variationen und Kombinationen, doch letzten Endes vermisste ich frisches Bibimbap.

Um die Ecke gab es allerdings eine europäische Bäckerei, die – im Gegensatz zu Tous les Jours – diese Bezeichnung tatsächlich verdiente. Wir holten uns zwei Teilchen aus Blätterteig, die mit Früchten belegt waren.

Natürlich kamen wir nicht umhin die japanische Burgerkette, Mos Burger genannt, zu unseren Mahlzeiten zu zählen. Was sofort auffiel, war die Tatsache, dass die Burger viel zu klein waren. Das reichte ja gerade mal als Vorspeise.

Es gab Teriyaki-Burger, weil diese von uns als Synonym für das Land betrachtet wurden. Kurze Zeit später musste ich noch etwas mehr essen.
Mittlerweile war uns Spiel „Finde die Koreaner“ ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, doch wir fügten eine neue Dimension hinzu. In Kyoto trafen wir auf immer mehr Asiaten, die weder koreanisch, japanisch, noch chinesisch aussahen. Etwas stimmte nicht. Es ergab irgendwie keinen Sinn – bis wir sie reden hörten. Es handelte sich bei diesem Typ offensichtlich um Amerikaner asiatischer Herkunft. Das machte die Sache wieder einfach.
Wir besuchten ebenfalls den Yasaka Schrein, der unweit unserer Herberge war. Dort fanden wir Gebäude verschiedener Stilrichtungen nebeneinander aufgestellt. Am Eingang begrüßte uns ein großes rot-weißes Tor, das hoch erhoben auf einer Treppe stand. Eine Löwenstatue hielt mahnend alles Böse fern.

Dahinter fand man allerdings viele Gebäude, die aus dunkelbraunem Holz bestanden und mit Gold verziert waren. Einige kleinere Bauwerke waren nur lose zusammengezimmerte Bretterbuden, bei denen wir Angst hatten, dass sie bald auseinanderfallen würden. Wiederum andere Bauten hingegen mischten beide Stile.

Wir drehten eine große Runde, liefen Treppen rauf, Treppen hinunter, gingen um Hauptgebäude herum, um uns Verstecktes anzusehen, beobachteten Leute, wie sie beteten, fanden den Zugang zum Park, um festzustellen, dass dieser den Schrein mit dem Chion-in Tempel verband, drehten wieder um und verließen das Gelände wieder.
Wir fanden eine Straße, auf der es zu beiden Seiten relativ breite Fußgängerwege gab. Geschäfte verschiedener Art säumten den Fahrbahnrand, während eine schöne Dekoration zum Schlendern einlud. Die Dächer erlaubten es zudem bei Wind und Wetter von Geschäft zu Geschäft zu bummeln. Franziska fand einen Hello Kitty Laden, den sie unbedingt von innen sehen wollte. Allerdings überraschte es mich sehr, wie wenige Restaurants wir trotz so viele Einkaufsmöglichkeiten vorfanden.

Wir machten uns recht frühzeitig Gedanken darüber, wie wir von Kyoto nach Tokyo kommen würden. Ursprünglich war eine Fahrt mit der Bahn angedacht, doch nach unserer Erfahrung mit der JR und den horrenden Preisen erwogen wir Alternativen. Franziska fand in einem Internetforum, dass Busse durchaus günstiger als die JR waren, leider aber auch länger brauchten. Der Shinkanzen mag schnell sein, günstig ist er auf keinen Fall. Das japanische Äquivalent eines Inter City Buses klang auf einmal recht verlockend. Nach weiterer Recherche fand meine Reisebegleitung allerdings nur einen Busanbieter, der seine Website auch in englischer Sprache gestaltet hatte, so dass uns eine Buchung möglich wurde. Das war doch arg suspekt. Wir fragten freundlich bei unseren Herbergsbesitzern nach, doch diese bestätigten uns, dass es sich um eine seriöse und zuverlässige Seite handelte. In Japan schien sie bekannt zu sein.
Somit fiel unsere Wahl auf den Willer Express Busdienst. Wir folgten den Anweisungen auf der Website, buchten unsere Tickets, bekamen eine Bestellbestätigung und dachten uns, dass wir damit einfach zur Bezahlung fortschreiten könnten. Wir vergaßen offensichtlich, dass wir es mit einem japanischen Verkehrsunternehmen zu tun hatten.
Als Ausländer hatte man bei der Wahl der Zahlungsmethoden nur eine äußerst eingeschränkte Wahl, nämlich keine. Es sei denn, ein Freund zahlte. Da wir keine solchen Freunde in Kyoto hatten, blieb uns nichts anderes übrig, als die Zahlung per Einzahlung an einem bestimmten Automaten in einem gewissen Geschäft, 7/11, vorzunehmen. Als wir am nächsten Tag unterwegs waren, wollten wir das unbedingt schnell erledigen, weshalb wir in ein 7/11 einkehrten und es dort versuchten. Wir hatten immerhin die Buchungsnummer dabei.
Das Problem fing aber schon damit an, dass der Automat genauso viel Englisch konnte, wie der durchschnittliche Japaner. Wir klickten uns durch das Menü, bis wir einen passend scheinenden Punkt fanden. Dort sollten wir die Buchungsnummer eingeben. Das klang machbar. Gesagt, getan, wir kamen zum nächsten Menüpunkt. Jetzt wollte das Gerät unsere Festnetznummer. Auch diese hatten wir wohlweislich mitgenommen, weil wir sie schon bei der Buchung brauchten. Allerdings war die Sache nicht ganz so einfach, denn es gab zwei Felder, in die man etwas eintrag en konnte, und keines davon hatte eine englische Überschrift. An diesem Punkt fragen wir eine der Verkäuferinnen, weil wir nun wirklich nicht wussten, was wir hier angeben sollten.
Das darauf folgende Problem bestand darin, eine Verkäuferin zu finden, die Englisch sprach. Wir brachten den ganzen Laden in Aufruhr, weil die Angestellten uns zum einen helfen wollten, es zum anderen wegen der Sprachbarriere nicht konnten. Endlich fand sich eine junge Dame, die zumindest einige zusammenhängende Sätze zustanden brachte, so dass sie an die Front geschickt wurde. Sie zeigte Franziska, wie der Automat funktionierte.
Es begann mit demselben Menü, das meine Reisebegleitung auch schon selbst gefunden hatte. Sie gaben gemeinsam die Buchungsnummer ein, es erschien wieder die Aufforderung eine Telefonnummer einzutippen. Die Verkäuferin versuchte es ohne und erzielte einen Abbruch. Es ging von vorne los. Diesmal gab sie sie in eines der Felder ein, doch das führte dazu, dass man seine ganze Adresse eingeben musste. Diese hatten wir nicht. Es ging einige Male hin und her, die Verkäuferin versuchte verschiedene Fälder, wir hatten verschiedene Nummern (Buchungs- und Belegnummer), doch nichts half. Früher oder später kamen wir an einen Punkt, an dem uns Daten fehlten. Dass der Automat nicht auch noch unser Sternzeichen wissen wollte, war alles. Es ging so weit, dass ein Kunde sich dazu gesellte und uns zu helfen versuchte.
Nach einer Viertelstunde gaben wir auf. Wir bedankten uns recht freundlich bei der Verkäuferin, holten uns noch einen Snack, um uns erkenntlich zu zeigen, und zogen wieder von dannen. Das Ziel war das Hostel, um uns zu erkundigen, wie wir denn nun die Tickets bezahlen konnten. Der Einfachheit halber fragten wir die gerade anwesende Inhaberin. Sie meinte, dass es für gewöhnlich sehr einfach sei, man aber unbedingt Bargeld brauche. Wir sahen uns verwirrt an.
An diesem Punkt ging Franziska noch einmal die Mail durch. Irgendwo im Text fand sie dann einen Passus, der besagte, dass man die Buchung erst via angegebenem Link bestätigen musste, bevor die Buchungsnummer aktiviert wurde. Also taten wir dies. Wenige Minuten später brachen wir zum nächsten 7/11-Markt auf, um unsere Tickets endlich käuflich zu erwerben. Wir standen vor dem Automaten und stellten fest, dass er gar kein Bargeld annahm. Es gab nur einen Schlitz für eine Karte. Bevor wir jetzt irgendetwas falsch machten, stapften wir entmutigt und frustriert zurück ins Hostel.
Eben in dieser Verfassung schlugen wir vor der Inhaberin auf. Um dieses Mal ganz sicher zu gehen, dass nichts schiefging, baten wir unsere Retterin in Not, dass sie uns doch zum nächsten 7/11 begleitete – er war eh um die Ecke.
Wir kamen also in den nächsten Laden reinspaziert, gingen zielgerichtet zum Automaten, stellten uns dämlich davor und begannen von neuem unser Ticket zu bestellen. Genauer gesagt war es unsere hilfreiche Begleitung, die dies alles erledigte: Buchungsnummer, Telefonnummer, plötzlich änderte sich der Bildschirm, so weit waren wir beim letzten Mal nicht gekommen. Ich fühlte mich, als hätte ich ein neues Level in einem Videospiel freigespielt. Unsere Herbergsmutter tippte noch schnell auf einige Buttons, die auf dem Bildschirm aufpoppten, und dann waren wir wieder am Anfang. Tickets hatten wir immer noch nicht.
Versiert in diesen Angelegenheiten bückte sie sich und holte aus einem Fach einen Beleg hervor. Das war immer noch nicht das Busticket, sondern der Buchungsbeleg, mit dem wir zum Verkäufer gehen mussten. Erst als wir an der Kasse den ausstehenden Betrag beglichen hatten, druckte dieser uns die Fahrkarten aus. Wir waren fertig. Aber immerhin stand unserer Reise nach Tokyo nichts mehr im Wege. Damit auch nichts mehr schief ging, packten wir die Fahrkarten sorgsam weg.
Selbstverständlich lernten wir nichts aus unseren bisherigen Abenteuern mit den japanischen öffentlichen Verkehrsmittel und beschlossen daher einen Ausflug zu einem etwas weiter entlegenen Schrein zu unternehmen. Des Komforts wegen entschieden wir uns für den Schienenweg, um unserem Ziel wenigstens ein bisschen näher zu kommen. Es war drückend heiß an diesem Tag, die Sonne schien von einem herrlich blauen Himmel auf uns herab und weit und breit war keine Klimatisierung in Sicht. Dennoch wollten wir uns dieses Wunderwerk nicht entgehen lassen. Immerhin wurde der Fushimi Inari-Taisha Schrein immer wieder lobenswert erwähnt und von vielen Reisenden sowie Einheimischen empfohlen.
Leider lag dieser Schrein nur ein ganz klein bisschen außerhalb des vergrößerten Bereiches auf unserer Stadtkarte, weshalb wir zwar wussten, an welcher Haltestelle wir auszusteigen hatten. Aber die Strecke von der Haltestelle bis zum tatsächlichen Schrein war ein kleines Rätsel für uns. Darüber hinaus nahmen wir die U-Bahn anstatt der JR-Linie, wodurch wir noch ein kleines bisschen weiter von unserem Ziel entfernt ankamen. Wir verließen uns einfach auf unserem Orientierungssinn.
Als wir an der Haltestelle ankamen, begrüßte uns nichts. Kein Schild, kein Hinweis, kein Wegweiser, keine Touristeninfo, nichts, das in irgendeiner Weise hilfreich gewesen wäre, diesen Schrein zu finden. Wahrscheinlich rechnete hier, so weit von der Sehenswürdigkeit, niemand mit einem neugierigen Touristen. Also schlugen wir irgendeine Richtung ein und stolperten über leere Straßen. Auch wenn die Karte nicht jede einzelne Gasse und Straße aufzeigte, hatten wir doch eine grobe Richtung, in der wir uns orientieren konnten.
Nach einiger Zeit, einigem Irren und keinem Menschen, dem wir unterwegs begegneten, kamen wir in einen belebteren Teil der Stadt, der schon eher den einen oder anderen Touristen gesehen hatte. Kleine Läden zierten hier die bürgersteiglosen Straßen. Wir überquerten Gleise und sahen die JR-Haltestelle unweit. Es schien der richtige Weg zu sein.
Als wir auf eine belebte Fußgängerzone stießen, war jeder Zweifel verflogen. So folgten wir nunmehr dem mehr als deutlichen Weg zusammen mit den Menschenmassen, die sich langsam ansammelten. Unser Weg zum Fushimi Inari-Taisha Schrein war geebnet.
Einige Worte zu eben diesem Schrein. Das Besondere an ihm ist die schiere Anzahl an hintereinander platzierten roten Toren. Sie drängen sich so dicht an dicht, dass man stellenweise durch einen roten Tunnel geht, der nur durch wenige Lücken ein bisschen Sonnenlicht durchlässt. Diese Tore gibt es in verschiedenen Größen. Einige sind nur so klein, dass sie über einem Grabstein stehen; andere sind so groß, dass eine Kutsche hindurchpassen würde. Das ganze Konstrukt stand auf einem Berg.
Am Anfang begrüßte uns ein riesiges Tor. (Nein, dies war nicht der Haupteingang.)

Ohne Unterbrechung zogen wir weiter, um uns diese Sehenswürdigkeit zu Gemüte zu führen. So stapften wir Steigungen empor, erklommen Treppenstufen, passierten Bäume, Skulpturen, ausgetrocknete Bachläufe und bestaunten die wirklich endlos scheinende Flut an roten Toren. Irgendwo in der Mitte gab es einen Friedhof neben einem See, um den herum einige Souvenirläden angelegt waren. Wir entschieden uns für eine Pause.

Leute kamen uns entgegen, Leute gingen wieder. An manchen Stellen gab es zwei verschiedene Wege, einen für jene die rauf gingen, den anderen für jene, die wieder runter kamen. Aber größtenteils geriet man einfach immer wieder in den Gegenverkehr.
Während wir einer Schildkröte beim Schwimmen zusahen, überdachten wir unsere Situation. Es war heiß, wir waren erschöpft, ich bekam Hunger, und obwohl es Läden in unmittelbarer Nähe gab, bot keiner davon eine gute Mahlzeit an. Dabei hatten wir erst die Hälfte der Strecke hinter uns gelassen. Man musste bedenken, dass wir die gleiche Anzahl von Schritten, die wir gekommen waren, auch wieder zurückgehen mussten. So entschieden wir uns für den Rückweg, denn unten gab es Restaurants und Eisdielen. Nach einer kurzen Erfrischung zogen wir weiter, denn leider fanden wir in der Nähe des Schreins kein Lokal, das uns ansprach.
In der Innenstadt gab es einen Bereich, der auf der Karte hervorgehoben war. Dort fanden sich Geschäfte und Einkaufspassagen. Es war unser nächstes Ziel. In der Hoffnung ein interessantes Restaurant zu finden, begaben wir uns zum Nishiki Food Markt. Eine kurze Fahrt mit der Bahn, einige Schritte zu Fuß gelaufen, schon waren wir da und schlenderten durch eine teils überdachte Einkaufspassage.
Leider bestand der Nishiki Food Market hauptsächlich aus Geschäften, die Essen in ihrer rohen Form verkauften. Außer einigen Snacks fanden wir nichts, was wir hätten sofort verzehren können. Die Suche ging also weiter. Ich gestehe ehrlich, dass ich an diesem Punkt nicht mehr so ganz aufnahmefähig war, da mein Magen mir das Zepter aus der Hand nahm und einen klaren Kurs steuerte.
Wir verlagerten unsere Suche auf eine Parallelstraße, auf der wir zwar viele prunkvolle Gebäude, aber nur wenige Lokale fanden. Was dies Gebäude beherbergten, vermochte ich nicht herauszufinden, da ich stark abgelenkt war.

Doch wir weigerten uns aufzugeben. Irgendwo hier musste es doch etwas zu essen geben. Mittlerweile hätte ich mich sogar mit McDonald’s zufrieden gegeben. Glücklicherweise musste es nicht so weit kommen, denn wir fanden die japanische Alternative, Mos-Burger.
Nach dieser Stärkung war meine Abenteuerlust von neuem entfacht und ich sah mich in der Lage, dem Trubel dieser Großstadt entgegenzutreten. Franziska hatte herausgefunden, dass sich in der Nähe ein Bento-Shop befand, den sie gerne persönlich aufsuchen wollte. Wir kannten die ungefähre Lage und hatten eine Stadtkarte dabei – Es konnte nichts mehr schief gehen. Nach einigem hin und her, standen wir in dem gesuchten Laden und meine Reisebegleitung schaute sich neugierig um.
Als nächstes kehrten wir in die angrenzende, überdachte Einkaufspassage, um uns dort die verschiedenen Geschäfte anzusehen.

Bei dieser Gelegenheit kehrte ich in eine der zahlreichen Pachinko-Hallen ein. Für all jene, die nicht im Bild sind: Pachinko ist ein Glücksspiel, bei dem man kleine Metallkugeln in einen Automaten wirft. Je nachdem, wo sie landen, kann man etwas gewinnen. In Spielhallen stehen dutzende, ja sogar hunderte dieser Automaten nebeneinander, so dass ein enormer Lärm entsteht. Aus eben diesem Grund wollte ich einmal in so ein Geschäft gehen. Besagte Halle hatte zwei Eingänge, die beide durch solide Glastüren geschlossen waren. Ich betrat die Halle durch Eingang 1 und verließ sie wieder durch Eingang 2. Der ganze Weg war nicht mehr als fünf Meter lang, trotzdem hatte ich nach dieser kurzen Zeit bereits Schwierigkeiten mit meinem Gehör. Als ich wieder in der verhältnismäßig ruhigen Einkaufspassage war, brauchte ich einem Moment, um mich zurechtzufinden. Glücklicherweise war meine Reisebegleitung nicht einfach zu übersehen. Ich verstehe nicht, wie Leute es über mehrere Stunden in solchen Hallen aushalten.
Glücklicherweise war die Einkaufspassage unweit vom OKI’s Inn entfernt, so dass wir uns zu Fuß auf den Heimweg begaben. Nun gut, vielleicht übertreibe ich hier ein bisschen. Immerhin waren wir noch 20 Minuten zu Fuß unterwegs, aber das war für uns keine nennenswerte Entfernung.
Während unseres Aufenthaltes in Kyoto trug es sich zu, dass ein Taifun Japan streifte. Schon tags zuvor verdunkelten dräuende Wolken die Ankunft dieses Wetterphänomens. An besagtem Tag war es denn dunkel, schwarze Wolken hingen tief, Regen fiel, starker Wind machte Ausflüge zu einer Qual, es kühlte merklich ab – und der Sturm traf Kyoto nicht einmal, denn es war nur ein Ausläufer. Weiter im Süden hatten die Leute mit der prallen Gewalt des Taifuns zu kämpfen. Also entschlossen wir uns den Tag im Hostel zu verbringen und nur raus zu gehen, um etwas zu essen zu kaufen. Auch so war es ein angenehmer Tag. Wir saßen im geräumigen Wohnzimmer und unterhielten uns mit fast allen Gästen. Bei der Gelegenheit lernten wir auch die Katzen der Hostelinhaber kennen.
Ninja Museum
Ganz groß auf unserer To Do-Liste Japan stand „Iga“. Besser gesagt das Ninja-Haus, das dort stand und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Leider befürchteten wir zwischendurch immer wieder, dass wir dort nie ankommen würden, weil wir den Passierschein A38 nicht erhalten hatten. Glücklicherweise waren die Instruktionen, also die Verbindung, die die Managerin unseres Hostels rausgesucht hatte, Gold wert. Es stand alles drauf, was wir wissen mussten, so dass wir uns dazu entschlossen, dieses Abenteuer in Angriff zu nehmen (siehe oben).
So brachen wir eines Morgens auf, um diese Fahrt von mehr als zwei Stunden auf uns zu nehmen, um einem Mythos hinterher zu jagen, der uns hoffentlich in vollem Ausmaß amüsieren würde. Da die Umsteigezeiten nicht sonderlich lang waren, was man durchaus auch als Vorteil verstehen konnte, fragten wir bei jeder Gelegenheit nach, welchen Zug wir denn nun tatsächlich nehmen mussten – um auf jeden Fall anzukommen. Dieses Bedürfnis hatte ich nie in Seoul oder Busan verspürt, aber hier waren wir schließlich in Japan.


Nach einer langen Fahrt, auf der wir entschieden zu viel Spaß auf Kosten der Japaner hatten, kamen wir am Bahnhof Uenoshi an. Von dort aus mussten wir unseren Weg zu Fuß fortsetzen. Das war nur halb so wild, dachten wir uns, zumal wir eine Touristeninformation nicht weit vom Bahnhof fanden. Dort bekamen wir auch eine Karte mit eingezeichnetem Weg zum Museum – allerdings war diese ausschließlich auf Japanisch. Nicht so schlimm, denn es fanden sich überall Hinweise darauf, ob wir noch auf dem richtigen Weg waren. Es gab Schaufensterpuppen, die wie Ninjas gekleidet waren und sich gut sichtbar versteckten; Ninjas waren an Wände gepinselt; sogar auf und in dem Zug, der nach Iga führte, waren überall Ninjas drauf. Wir brauchten nur einen kurzen Anstoß in die richtige Richtung. Außerdem musste man nur 10 Minuten zu Fuß den Berg rauf gehen.


Oben angekommen legten wir erst einmal eine kurze Rast mit Snacks ein. Dann begaben wir uns zu Ticketschalter, nur um weiteren Fragen gegenübergestellt zu werden. Da gab es verschiedene Eintrittskarten für verschiedene Sehenswürdigkeiten. Was uns hauptsächlich interessierte, war das Ninja-Haus, das Museum dazu nahmen wir gerne noch mit. Das Uneo Schloss hingegen stand nicht sonderlich weit auf unserer Prioritätenliste, tatsächlich wussten wir bis dahin gar nicht, dass es da stand. Die Ninja-Show fand ich nicht zwingend notwendig, doch da man dafür eh separat bezahlen musste, wollten wir uns spontan entschließen. Noch war genug Zeit, sich ganz und gar dem Museum zu widmen.
Was hier so einfach als Aufschlüsselung aller möglichen Optionen aufgeführt ist, war tatsächlich hart erarbeitet, denn keine der beiden Damen am Schalter sprach genug Englisch, um uns die aufkommenden Fragen zu beantworten. Ich fühlte mich wie in der Touristeninformation in Hongdae. Wir wollten doch nur wissen, welches Ticket wir kaufen mussten. Nachdem sie unsere Frage verstanden hatten, versuchten sie es mit Händen und Füßen sowie einigen Informationsmaterialien – und hatten Erfolg. Wir erfuhren, was wir wissen mussten.
So stürzten wir uns ins Abenteuer und Vergnügen. Es begann damit, dass uns eine Tüte für unsere Schuhe in die Hand gedrückt wurde – natürlich muss man Schuhe im Haus ausziehen. In diesem Ninja-Haus, das aus nur zwei Räumen bestand, gab es jede Menge zu sehen. Da wir die einzigen beiden (sichtbaren) Ausländer dieser Gruppe waren, machte sich niemand die Mühe irgendetwas auf Englisch zu erklären. Somit kann ich wenig zum Inhalt der Ansagen machen. Aber für die visuellen Demonstrationen brauchte man wenige Sprachkenntnisse.
Es war alles dabei, was einem den Tag versüßt: Verstecke hinter Wänden, Regale, die zu Leitern umfunktioniert wurden, Geheimtüren, falsche Böden, Verstecke unterm Fußboden. Es war herrlich. Die Damen wussten schon, was sie taten, auch wenn internationale Präsentationen nicht zu ihren Stärken zählten.
Sie begann damit, dass sie nonchalant gegen eine Wand lief – und hinter ihr verschwand. Es war eine Drehtür, die als Wand getarnt war. Bis in die kleinsten Details, Maserung und Kratzer, waren beide Seiten dieser Wand-Tür identisch. So plötzlich, wie die Dame verschwunden war, tauchte sie auch wieder auf. Dabei war es nicht nur wichtig zu wissen, wo die Wand war und dass sie sich bewegte, sondern auch wann man sie wieder zum Reinrasten bringen musste. Denn sie bewege sich sanft und geräuschlos in ihren Angeln.
Die Dame zeigte uns Verstecke hinter den Wänden, aus denen man den ganzen Raum überblicken konnte, ohne selbst gesehen zu werden. Eine Garderobe konnte zu einer Leiter umfunktioniert werden und wenn man oben im Zwischenboden verschwunden war, zog man sie einfach wieder hoch.
Ein Teil einer Außenwand schien stabil, doch trog dieser Eindruck. Denn wenn man zwei Bolzen kurz anhob, hatte man eine Tür. Aus einer vermeidlichen Sackgasse wurde ein Weg in die Freiheit. Mehr und mehr solcher Kleinigkeiten wurden uns dargeboten. Es machte Spaß den geübten Darstellern zuzusehen, wie sie mühelos verschwanden, auftauchten und Sachen aus dem Nichts herzauberten. Als sie mit ihrer Demonstration fertig waren, vierließen wir das Haus auf der anderen Seite wieder.
Dann begaben wir uns in das tatsächliche Museum, in dem verschiedene Ausstellungsstücke und Erläuterungen dem Besucher das Leben der Ninjas näher erläuterten. Wie viel davon Tatsachen und wie viel Fiktion waren, kann ich nicht beurteilen. Jedenfalls war es äußerst interessant.
Da der Tag noch jung war und wir sonst nicht mehr viel zu tun hatten, beschlossen wir uns die Ninja-Show doch noch anzusehen. Eine gute Wahl. Wir bekamen einen guten Platz in zweiter Reihe, so dass wir eine hervorragende Sicht auf die Bühne hatten. Zu Anfang erklärte ein Ninja irgendetwas, aber wir waren mal wieder außen vor. Erst bei den Anweisungen bezüglich Fotografie und Filmen schnappten wir genug englische Begriffe auf, um zu wissen, dass man bitte kein Blitzlicht verwenden sollte und Filmen gänzlich untersagt wäre. Irgendwann während der Show fragte uns einer der Artisten, ob wir irgendetwas auf Japanisch verstanden. Wir guckten groß und schüttelten den Kopf, woraufhin er einige Erklärungen auf Englisch abgab. Das war äußerst hilfreich, allerdings bestand sein Englisch auch mehr aus Händen und Füßen als aus zusammenhängenden Sätzen. Trotzdem war ich froh über seine Bemühungen.
Allgemein war es für die Show nicht notwendig, da man auch mit gesundem Menschenverstand und den Informationen aus dem Museum sehr weit kam. Bevor alles allerdings richtig losging, warnte Franziska mich, ich solle mich gefälligst mit meinem Gelächter zurückhalten. Schon kurze Zeit nach Beginn der Show wurde deutlich, dass das gar nicht möglich gewesen wäre, weil diese Artisten sich selbst oder die Ninjas in keiner Weise ernst nahmen.
Es begann mit einem einfachen Shinobi, der sich traditionell verbeugte, verschiedene Handzeichen machte, sein Schwert in den Gürtel steckte und erst einmal zwei Tamashegiri fachmännisch zerteilte.

Bereits bei diesem Ereignis waren Franziska und ich enttäuscht. Nicht von der Vorstellung, nein, sie war sehr amüsant. Es waren die Zuschauer, die uns negativ auffielen. In Korea wäre dieser Mann mit einem Schwall erstaunter „Ohhs“ und „Ahhs“ belohnt worden. Aber die Japaner nickten nur und gafften weiter. Sogar der Applaus war verhalten. Obwohl ich doch eher überrascht sein sollte, dass ich überhaupt noch überrascht war. Immerhin hatten die Japaner die Vorführung im Ninja-Haus ebenso trocken hingenommen. Es erinnerte mich stark an eine Vorführung in Deutschland, bei der man auch bis zum Ende wartet, bis man seine Freude an der Vorstellung am Schluss durch Applaus kundtun durfte – und ich stockte. Noch so ein Punkt, in dem diese beiden Länder sich so gut verstanden. Mir war es zu steril.
Daraufhin folgte eine Demonstration von Kletterkünsten, indem ein junger Mann sein Schwert als Kletterhilfe benutzte. Er war wirklich gut. Natürlich hätte man für die Höhe keine Hilfe benötigt, aber es ging hier um eine Demonstration.

Ein Showkampf zwischen zwei Ninja entlockten den Japanern dann doch das eine oder andere Lachen, doch befürchte ich, dass wir dummen Ausländer doch den ganzen Laden mit unseren amüsierten und sehr lauten Zwischenrufen aufmischten. Spätestens jetzt wurde deutlich, dass die ganze Vorstellung allein der Unterhaltung diente – historische Richtigkeit stand definitiv nicht an erster Stelle, wobei ich nicht unterstellen möchte, dass sie hier einem einen Bären aufbanden.

Erst als ein großer Ninja zwei bis drei Shuriken auf einmal in eine Holzwand warf, hörte man erste anerkennende Ausdrücke des Erstaunens. Endlich kam auch Gelächter auf, als ein Ninja sich als Straßenkünstler verkleidete und mit seinen Kunststückchen anfing. Er schaffte es nicht nur einen Ball auf seinem Schirm zu balancieren und darüber rollen zu lassen, nein, er vollführte das gleiche Spielchen mit einer Münze. Es war wirklich beeindruckend. Koreaner wären spätestens an dieser Stelle vor Bewunderung von den Stühlen gefallen.

Als nächstes kam eine Dame auf die Bühne, die in einer geschmeidigen Bewegung ihre Querflöte in ein Blasrohr verwandelte. Sie ließ einen Ballon zerplatzen, erklärte einiges zu ihrem Instrument (natürlich in japanischer Sprache) und suchte sich jemanden aus dem Publikum, um an der Demonstration teilzunehmen. Mich.
Da stand ich nun, ich armer Tor, und wusste nicht, wie mir geschah. Vor allem wusste ich nicht so recht, was sie von mir wollten. Man erklärte langsam – sowohl an mich als auch ans Publikum gewandt –, dass ich nun ebenfalls versuchen sollte, einen Luftballon mit Hilfe des Blasrohrs zum Platzen zu bringen. Die Dame fragte mich, woher ich käme, also antwortete ich wahrheitsgemäß. Dann zeigte sie mir, was ich tun sollte. So nahm ich Aufstellung, befolgte die Anweisungen des Personals und pustete. Leider verfehlte mein Geschoss den Luftballon um ein gutes Stück – aber ich traf die Matte. Im nächsten Anlauf durfte ich näher dran. Dieses Mal traf ich den Ballon, allerdings prallte das Geschoss daran ab und landete auf dem Boden. Ich hätte mich vor Lachen beinahe weggeschmissen, riss mich dann aber lieber am Riemen. Es war eine urkomische Situation.
Als Geschenk erhielt ich einen Gutschein für das Werfen mit Wurfsternen, also Shuriken. Vorerst durfte ich mich allerdings auf meinen Platz setzen und den Rest der Show genießen.
Es folgte eine Darbietung mit Seil vs. Schwert. Der Ninja mit dem Seil gewann gegen sein Schwert schwingendes Pendant, was dank einer ausgefallenen Choreographie dramatisch und überzeugend wirkte.

Zu Schluss traten noch zwei Schwertkämpfer gegeneinander an. Auch hier waren die einstudierten Bewegungen sehr gut gemacht und hervorragend in Szene gesetzt. Allerdings bin ich davon überzeugt, dass der Verlierer so viele Hiebe, Stiche und Schnitte nicht überlebt hätte. Wenn er spätestens beim zweiten Streich noch immer Stand, verstand sein Gegner sein Handwerk nicht. Wie dem auch sei, der junge Mann starb lang, gekonnt und theatralisch. Es war eine Augenweide. Ich war begeistert und dankte Franziska mehrfach für diese grandiose Idee.
Natürlich löste ich meinen Gutschein ein. Beim „Schießstand“ gab es verschiedene „Klassen“. Da gab es einen Wurfstand für Kinder, der den Kleinen je nach Alter und / oder Größe eine andere Entfernung zum Ziel zumutete. Es war erstaunlich, wie wenige Berührungsängste die Japaner mit dieser Waffe hatten. Da wurden Knirpse von unter einem Meter und bestimmt weniger als acht Jahren an den Stand gelassen, als ob man Süßigkeiten verteilen würde. Gleichzeitig wuselten die Kleinen neben den Erwachsenen, während diese ihre Geschosse abwarfen. Niemand schien sich Sorgen um die Sicherheit zu machen.
Bei den Erwachsenen unterschied man zwischen Männern und Frauen. So stellte ich mich brav in die Damenreihe, die nur aus mir bestand, nickte bei den Instruktionen des Einweisers dumm, weil ich kein einziges Wort verstand, wog einen Stern nach dem anderen in der Hand und warf sie der Reihe nach auf die Zielscheibe. Zwar traf ich nie ins Schwarze, war mit 70 Punkten aber besser dabei als die meisten anderen.
Im Nachhinein erfuhr ich dann, dass man bei Erreichen einer gewissen Punktzahl ein Poster geschenkt bekommen hätte. Das kommt davon, wenn man die Sprache nicht spricht und kein Wort versteht. Trotzdem war es ein riesiger Spaß.
Damit erklärten wir den Tag für beendet und machten uns auf den Rückweg. Gerade zur richtigen Zeit, wie sich herausstellte, denn kaum saßen wir im Zug, setzte der Regen ein.

Als wir dann schneller als erwartet in Kyoto ankamen, wollten wir die günstige Gelegenheit nicht ungenutzt verstreichen lassen, sondern uns gleich nach Fahrkarten für einen Ausflug in die Region erkundigen.

Dieser Teil der Erzählung verdient eine eigene Überschrift:
Wie wir versuchten eine Fahrkarte zu bekommen – oder die Suche nach dem Passierschein A38.
Im Internet hatten wir von einem Regionalpass, dem Kansai Area Pass, gelesen, mit dem man für relativ wenig Geld den ganzen Tag durch die Gegend tingeln konnte. Außerdem wollten wir noch einmal persönlich fragen, wie viel eine Fahrt mit dem Zug nach Tokyo kosten würde. Da wir mittlerweile aber mit dem chaotischen japanischen Schienensystem vertraut waren, wussten wir nicht, wo wir danach fragen konnten. Um unsere Suche abzukürzen – dachten wir uns – und kein unnötiges Risiko einzugehen, sprachen wir die erstbeste Information an, auf die wir trafen. Wir nahmen an, die Leute wüssten, wo ein JR Schalter wäre, denn immerhin arbeiteten sie in diesem Gebäude. Wie eingangs erwähnt waren wir gerade erst angekommen und hatten keine Ahnung von der Lage, Konstruktion oder Größe dieses Gebäudes, das sich unschuldigerweise „Hauptbahnhof“ nannte.
Den kärglichen Anweisungen des Mitarbeiters folgend gingen wir einmal quer durch die Halle, um dort die Rolltreppe hoch zu fahren. Englisch war nicht die Stärke dieses Japaners, aber wir waren in der Lage zu kommunizieren. Am Schalter angekommen, sahen wir schon ein Schild, das keine guten Nachrichten verheißen konnte. Hier wurden nur Fahrkarten für den heutigen Tag verkauft. Darüber hinaus waren die Englischkenntnisse dieses Angestellten sehr schlecht, so dass er uns nach dem ersten Satz an einen Kollegen verwies. Mit Händen und Füßen versuchte er uns den Weg möglichst genau zu beschreiben und wir nickten freundlich, bevor wir gingen. Die Rolltreppe runter, die Rolltreppe daneben wieder rauf, um die Ecke, durch den Ausgang der geschlossenen Fahrkartenzone, zum nächsten Schalter.
Der Herr, der uns nun gegenüber saß, verstand einige Schlüsselwörter auf Englisch, aber bei allem nicht die zusammenhängenden Sätze, die wir produzierten. Er verstand, wohin wir wollten. Er zeigte uns auch, wie viel das Ticket kosten würde. Er begriff aber nicht, dass wir uns über andere Pässe als den JR-Pass erkundigen wollten und dass wir noch andere Informationen suchten. Allem Anschein nach war das doch nicht der Schalter, den wir suchten. Bevor es noch weiter ausuferte, schickte er uns zu seinen Kollegen. Immerhin reichte sein Sprachvermögen, um uns den Weg zu erklären. Mittlerweile war ich so weit, es ihm hoch anzurechnen.
So kamen wir in die erste Filiale von Shinkanzen und JR. Vorher waren es nur einzelne Schalter mit einzelnen Mitarbeitern, aber hier fanden sich mehrere Leute auf einmal hinter der Theke. Auf die Frage hin, ob es eine günstigere Schienenverbindung nach Tokyo gab, antwortete man uns, dass es lange dauern würde. Es war der Punkt erreicht, an dem ich langsam die Geduld verlor und die Dame auf der anderen Seite dies zu spüren bekam. Ich sagte ihr deutlich heraus, dass es mich nicht interessiere, wie lange es dauerte, ich wolle den Preis wissen. Das war fast schon zu viel für diese zartbesaitete Asiatin, doch sie suchte uns einen Preis heraus und sagte anständig, dass die Fahrt 10 Stunden in Anspruch nehmen würde. Wir machten Fortschritte. Als es aber um den Kansai Area Pass ging, den wir haben wollten, konnte sie uns auch nicht mehr weiter helfen, so dass sie uns zu ihren Kollegen in einem anderen Teil des Gebäudes schickte.
Bei der nächsten Verkaufsstelle für Zugfahrkarten, der vierten mit der Überschrift Shinkanzen and JR mittlerweile, kamen wir einen Schritt weiter, auch wenn wir dabei zwei Schritte zurück machten. Ja, es gab diesen Tagespass, den wir wollten. Nein, wir konnten ihn nicht hier erwerben. Das Unternehmen JR West stellte diese Art von Tagespass aus. Um dorthin zu gelangen, mussten wir aus der Verkaufsstelle raus, rechts, die Rolltreppe hoch zur Fußgängerüberführung, auf der anderen Seite wieder runter, um dort eine Filiale aufzusuchen. Ich musste sehr tief durchatmen – mehrfach.
Wir nahmen diese Pilgerreise immer noch mit schweren Rucksäcken beladen auf uns. Auf der anderen Seite der Fußgängerüberführung angekommen blickten wir nach links, nach rechts, fanden einige nützliche Schilder vor und folgten diesen. Bei JR West angelangt bestätigte man uns, dass es diesen Pass gäbe, dass er auch den Preis hatte, den wir im Internet nachgelesen hatten und dass er von eben jenem Unternehmen ausgestellt wurde, in dessen Filiale wir uns gerade befanden. Allerdings war diese Stelle nicht dafür zuständig. Wir sollten in die zentrale Verkaufsstelle gehen, die rechts, die Rolltreppe runter im Erdgeschoss und dann noch einmal rechts anzufinden war. Ich wünschte, ich könnte ein passendes Emot-Icon einfügen, das meinen Gemütszustand zu diesem Zeitpunkt adäquat wiedergeben würde. Da dem nicht so ist, begnüge ich mich mit einer Umschreibung. Ich blinzelte den Sachbearbeiter nichtssagend an. Nach einiger Zeit lächelte ich freundlich, bedankte mich und wir verabschiedeten uns.
Da wir besagte Zentrale Verkaufsstelle nicht auf Anhieb fanden – ja, Kyoto Station an sich ist schon ein Labyrinth, da braucht man schon einen Kompass, um überhaupt den Ausgang zu finden, aber wenn man eine Fahrkarte will, sollte man Verpflegung mitnehmen –, kehrten wir in die Touristeninformation ein, um uns nach dem Weg zu erkundigen. Man händigte uns einen Lageplan des Gebäudes aus. An diesem Punkt akzeptiere ich nie wieder Witze darüber, dass ich mich in Gebäuden, insbesondere Kaufhäusern, verlaufen kann. Wenn ich mich in der Lotte Mall verlief, war ich zumindest sicher, dass ich überleben würde, bis meine Reisebegleitung oder das Sicherheitspersonal mich fand, denn es gab wirklich überall Verpflegung und alle Annehmlichkeiten des zivilisierten Lebens. Hier war ich mir nicht so ganz sicher. Wir brauchten tatsächlich einen Lageplan, um einen Schalter zu finden. Die Dame überließ uns zudem Stadtkarte, Informationsbroschüre, Sightseeing-Guide und Liniennetzplan. Ich würde ja gerne etwas Positives darüber schreiben, aber ich bin noch nicht durch.
Wir folgten den Anweisungen der Dame, nur um festzustellen, dass sie uns zum Schalter mit Bustickets gelotst hatte. Als wir dessen gewahr wurden, verzichteten wir es in der Schlange zu warten, bis wir an die Reihe kamen. Stattdessen gruben wir unsere Nasen in den Lageplan und fanden mit vereinten Kräften einen Schalter, an dem man uns eventuell weiterhelfen konnte.
In dieser Filiale hatte man die ganze Angelegenheit ein bisschen aufgeteilt: Da gab es den Schalter für Japaner und einen für Ausländer. Ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher, ob das praktisch oder rassistisch war. Ungeachtet meiner persönlichen Vorbehalte stellten wir uns brav in die richtige Schlange und warteten erneut darauf an die Reihe zu kommen. Es gab allerdings nur einen Schalter für Ausländer, aber sehr viele Anfragen und Gäste. Langsam rückten wir dem Schalter näher. Bevor wir jemals ankamen, preschte eine weitere Mitarbeiterin vor und stellte den Wartenden Fragen, nur um die meisten dann unverrichteter Dinge in der Schlange stehen zu lassen. Ihre Funktion verstand ich nicht so ganz. Schließlich kam sie bei uns an und fragte uns, was wir wollten. Wir erklärten ihr unser Anliegen, dass wir den Kansai Area Pass wollten sowie einiger Informationen bezüglich einiger Verbindungen. Sie zog uns zur Seite und suchte die Verbindung, nach der wir gefragt hatten, heraus. Dann zeigte sie uns das Ergebnis.
Das war ja schön und gut, dass sie es auf ihrem Tablett hatte, aber dieses Gerät konnte ich nicht mitnehmen. Wir baten sie uns die Informationen irgendwie auszuhändigen, vorzugsweise schriftlich. Also schrieb sie uns einige Haltestellennamen auf. Wir sahen sie an wie ein Auto – nur nicht so schnell. Langsam, beherrscht fragten wir sie nach den Linien, die wir nehmen mussten. Um dieser ganzen Farce die Krone aufzusetzen, verlangten wir auch noch so etwas wie Fahrtdauer und Ticketpreis. Widerwillig ergänzte die Dame diese Informationen. Langsam gewann ich den Eindruck ein Störfaktor zu sein, den sie durch ihre plumpe Art zu beseitigen suchte. Ich habe noch nie so nutzlose Informationen bezüglich Bahnverbindungen bekommen. Als ich zu guter Letzt noch nach den Abfahrtszeiten fragte, tat sie es schnippisch mit einer ungenauen Zeit ab. Offensichtlich war es höchste Zeit uns zu bedanken und zu verabschieden.
Mittlerweile völlig entkräftet wollten wir das Risiko einer Fehlinformation nicht noch einmal eingehen, weshalb wir die Dame in Ruhe ließen und uns jemand anderen suchten, der uns bei der Suche nach unserer Herberge weiterhelfen konnte. Immerhin wussten wir bereits, dass wir dafür die U-Bahn nehmen mussten und diese von einem ganz anderen Unternehmen betrieben wurde als der Tagespass, nach dem wir uns soeben erkundigt hatten. Vor der zentralen Verkaufsstelle fand sich ein kleiner Tisch mit einer allgemeinen Information. Dies schien ein guter Anlaufpunkt für unser Anliegen zu sein. Dieses Mal kamen wir auch schnell an die Reihe und erhielten die gewünschte Information.
Nach neuneinhalb Schaltern und zwei Stunden Suche begaben wir uns in die U-Bahn, da wir langsam Hunger bekamen und Luft holen mussten. Eine Fahrkarte hatten wir bisher wohlgemerkt noch nicht.
Auch wenn die folgende Beschreibung dem tatsächlichen Ablauf ein bisschen vorauseilt, dachte ich mir, dass es besser wäre, dieses Abenteuer in einem zusammenhängenden Stück zu berichten, anstatt später darauf zurückzukommen.
Wir beschlossen eine weitere Quelle aufzusuchen und fragten einfach unsere derzeitigen Gastgeber. Freundlich, wie sie waren, suchten sie uns die Verbindung von Haustür zu Haustür heraus, schrieben sie auf – inklusive Bahnlinien, Bahnhöfen zum Umsteigen, Bahnunternehmen, Umsteigezeiten, Fahrpreis und Fahrtdauer – und händigten uns dieses bunt untermalte Informationsblättchen aus.
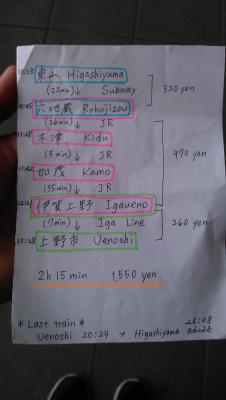
Das war mehr als ich erwartete hatte und entschieden besser als der Service der JR West. Leider kamen dabei ganz andere Strecken, Preise und Fahrzeiten zustande, so dass wir wieder bei null anfingen, weshalb wir noch einen Besuch bei der Verkaufsstelle anstrebten, um noch einmal genau nachzufragen und zu vergleichen.
Zwei Tage später standen wir auf der Matte, es war gerade kein weiterer Kunde vor uns, und hakten noch einmal genau nach. Es war wieder die Mitarbeiterin vom letzten Mal da, doch sie schien uns nicht wiederzuerkennen – oder machte es jedenfalls nicht deutlich. Wie dem auch sei, wir stellten unsere Frage, bekamen dieses Mal sogar eine ausgedruckte Streckenverbindung. Daraufhin legten wir ihr die Verbindung vor, die unser Gastgeber herausgesucht hatte, und fragten, was es damit auf sich habe, ob wir auch so fahren könnten. Die Dame betrachtete den Zettel, schlug ihr Tablett auf und sah nach. Mit einer der notierten Linie konnte sie gar nichts anfangen, weshalb ihre Kollegin einen Wälzer in der Größe des Telefonbuchs von Berlin rausholte und darin nachschlug, welche Linie das war. Sie bestätigte uns, dass wir auch so fahren konnten, ebenso wie sie uns bestätigte, dass wir für die U-Bahn extra zahlen mussten. Auf den ersten Blick sahen wir, dass sich der Kansai Area Pass so auf keinen Fall lohnen würde. Denn der Kansai Area Pass galt ausschließlich für die Züge der JR, was weder U-Bahn, Busse noch Bahnen von Privatunternehmen einschloss. Die einfache Hin- und Rückfahrt nach Iga wäre immer noch günstiger als dieses Scheinangebot von JR West.
Wir fragten noch, wo wir künftige Reiserouten nachsehen konnten, weil wir nicht jedes Mal zu einem Schalter kraxeln wollten, ob es einen Liniennetzplan und eine Website gäbe. Man erklärte uns, dass es eine App gab, die Japaner nutzten, aber sie war nur auf Japanisch. Ich war baff. So wie die Dame es darstellte, gab es für mich als Besucher nicht die geringste Möglichkeit irgendwie selbstständig von A nach B zu gelangen, wenn mir die Strecke nicht bereits bekannt war. Das trotz boomender Touristenzahlen. Selbst in meiner Heimatstadt, die nicht einmal halb so viele Einwohner wie Kyoto hat und nicht gerade vor Touristen überschäumt, findet sich eine bessere Einstellung zu internationaler Klientel.
Franziskas Blick wanderte zu mir, meiner zu ihr, beide sahen wir uns verständnislos an. Wir bedankten uns, nickten freundlich, sahen ein, dass die beiden Damen nichts dafür konnten, und gingen unserer Wege. Es war frustrierend.
Fazit dieses Unterfangens: Die spinnen, die Japaner. Ob sie sich nun diesen Zirkus mit dem Schienensystem bei den Deutschen abgeschaut haben oder es umgekehrt der Fall ist, spielt für mich nicht die geringste Rolle. Das System ist so kompliziert, dass nicht einmal Muttersprachler, die bei JR arbeiten, durchblicken und ihre Probleme haben, die richtige Fahrkarte für den richtigen Tag zu bekommen. Zu allem Überfluss sind die ganzen Angebote mit ihren verschiedenen Pässen nur dann sinnvoll, wenn man 75% seiner Zeit im Zug verbringt. Will man dieses Transportmittel aber nur dazu nutzen, um von einem Ort zum anderen zu kommen, weil man sich etwas ansehen will, also tatsächlich aus dem Zug aussteigt, lohnt sich kaum ein „Angebot“. Da können sie noch so pünktlich sein, wie sie wollen, kundenfreundlich ist anders. Mit jedem Schritt, den ich tiefer in dieses Land vordrang, vermisste ich Korea mehr. Die Koreaner, von den Japanern oftmals als Barbaren bezeichnet, bewiesen, dass ein effizientes, pünktliches Schienennetzwerk auch einfach sein konnte.
Wir machten uns also auf den Weg zu unserer neuen Herberge, um endlich eine Pause einlegen und etwas zu essen bekommen zu können. Glücklicherweise fanden wir die U-Bahn ohne weitere Probleme und hatten von den Hostelbesitzern eine detaillierte Wegbeschreibung bekommen, so dass wir zuversichtlich waren.
Hier möchte ich noch ein erstaunliches Phänomen einschieben, das uns in Kyoto auffiel. Während wir in Korea überall auf Spiegel gestoßen sind, waren sie in Japan eher spärlich gesät. Aber auf einmal fanden wir sie in U-Bahnhöfen, mitten auf dem Treppenabsatz, und fragten uns, woher der Sinneswandel kam. Es dauerte einige Zeit, bis wir begriffen, dass diese Spiegel nicht der Ästhetik dienten, sondern ganz praktische Zwecke hatten: Wie im Straßenverkehr sollten sie genutzt werden, um den entgegenkommenden Fußgängerverkehr einzuschätzen und diesem gegebenenfalls auszuweichen. Erstaunlich.
Wir stiegen an der richtigen Haltestelle aus, gingen die Treppe hoch, wandten uns nach links, dann nach einigen Schritten wieder nach links und standen in einer dieser überdachten Einkaufspassagen.

Irgendwo in dieser Höhle war unsere neue Herberge zu finden, das OKI’s Inn. Bei der Suche nach einer geeigneten Unterkunft in Kyoto hatten wir uns einige Angebote durchgelesen. OKI’s Inn hatte letztlich das Rennen gemacht, weil es beteuerte ein traditionell japanisches Ambiente zu vermitteln. Das war nicht untertrieben. Wir schlurften durch die Einkaufspassage, blickten nach rechts und links, um auch nichts zu verpassen und standen plötzlich vor einer holzvertäfelten Schiebetür, neben der ein Schild positioniert war.

Der erste Eindruck war schon vielversprechend. Wir wollten es traditionell, wir sollten es bekommen. Als wir eintraten erwischten wir die Herbergsleiter oder –besitzer gerade bei der Arbeit, denn sie waren mit dem Herrichten der Zimmer noch nicht fertig. Im Eingangsbereich standen Fahrräder, die man mieten konnte; der Raum dahinter beherbergte die Rezeption. Wir wurden sofort freundlich begrüßt, man erklärte uns, dass das Zimmer noch nicht fertig sei, aber dass wir unser Gepäck gerne schon abstellen durften, wenn wir draußen etwas unternehmen wollten. Selbstverständlich wollten wir das, immerhin hatte ich Hunger. So nahmen wir das Angebot unserer Gastgeber dankend an und zogen wesentlich leichter beladen wieder von dannen.
Draußen angekommen standen wir vor der Frage, was wir essen sollten – und vor allem wo. Bei der Wahl unserer Unterkunft hatten wir dieses Mal überhaupt nicht auf die Location geachtet, da wir davon ausgingen, dass man überall irgendwie mit der Bahn, dem Zug oder dem Bus hinkommt. Wir hatten dabei völlig vergessen an unsere Grundbedürfnisse, wie beispielsweise Verpflegung zu denken, weil es bisher immer irgendwie geklappt hatte. In Neuseeland hatten wir meistens großzügige Gastfamilien oder die Städte waren so klein, dass alles fußläufig erreichbar war. Hier war es wieder an der Zeit, umzudenken und sich vorzubereiten.
Wir waren ja bereits darauf gestoßen, dass man in Japan nicht überall einfach so etwas zu essen bekam, und dieser Gedanke sickerte nur widerwillig in unser Bewusstsein. Was wir allerdings gänzlich vergessen hatten und womit wir noch nicht konfrontiert worden waren, war die Tatsache, dass auch Restaurants eine Pause haben konnten, die für gewöhnlich zwischen dem Ansturm am Mittag und jenem am Abend erfolgte. Zudem gab es Ruhetage. In Deutschland ein bewährtes Konzept, war dies in Korea doch ein Frevel, auf den wir nicht mehr vorbereitet waren.
Letzten Endes standen wir gerade zu dieser Pausenzeit vor der verschlossenen Tür des einzigen Restaurants in der näheren Umgebung, das diesen Titel verdient hätte. Glücklicherweise fand sich nicht weit von uns noch ein McDonalds, das an diesem Tag als Retter in Not gefeiert werden musste.
Ich möchte damit keinesfalls zum Ausdruck bringen, dass es in der Nähe von OKI’s Inn nichts gab. Das Angebot war einfach nicht so reich, wie wir es in letzter Zeit gewohnt waren. Es dauerte lange Zeit, bis wir umgedacht hatten und uns auf die veränderten Lebensbedingungen einstellten.
Nach dem Essen war es immer noch zu früh zum Einchecken, weshalb wir beschlossen die Umgebung auszukundschaften. Wir hatten die Karte aus dem Touristenbüro am Hauptbahnhof parat, weshalb wir zielsicher irgendwo dort entlang gingen.
Unsere erste Sehenswürdigkeit sollte der Heian Jingu Schrein werden, der schon von weitem durch ein riesiges, rotes Tor angekündigt wurde. Da ich mit dem Maßstab der Karte noch nicht vertraut war, hielten wir auch hier die Augen offen, um das Tor auf keinen Fall zu verpassen. Immerhin waren wir dieses Mal nur einfach Touristen. Die Sorge entpuppte sich allerdings als völlig überflüssig, da besagtes rotes Tor tatsächlich enorm war. Bereits von der Hauptverkehrsstraße aus konnte man es irgendwo in der Ferne erkennen, und als wir näher kamen, verlor es keinesfalls an Eindruckskraft.


Wir durchschritten es, um uns auf dem breit angelegten Fußgängerpfad dahinter dem Schrein zu nähern. Links und rechts von uns standen Absperrungen, die durch froschförmige Poller gehalten wurden. Allem Anschein nach machten sich die Behörden Kyotos Sorgen um den Rasen. Das gesamte Tempelgelände war mit kleinen Kieselsteinen belegt, zwischen denen vereinzelt Bäume wuchsen. Selbstverständlich waren diese gezielt gepflanzt, gehegt und gepflegt worden.
Der Schrein wollte dem Tor in farblichen Angelegenheiten Konkurrenz machen. Rot wechselte sich mit Weiß ab, ab und zu stach Gold hervor und die Dächer zierte ein gräuliches Grün.

In Anbetracht der schieren Größe dieses Komplexes erstaunte es mich die ganze Zeit, dass hier nur von einem Schrein die Rede war und man darauf verzichtete es einen Tempel zu nennen. Worin genau der Unterschied lag, bleibt mir anhand der gesehenen Bauten ein Rätsel. Wir drehten eine Runde über das Gelände, ließen unsere Füße mehr oder weniger entscheiden, wohin es gehen sollte, betrachteten die Ecken und Winkel dieses Komplexes, bevor wir uns dazu entschieden, weiterzuziehen.
Auf unserer Karte waren noch weitere Tempel und Schreine eingezeichnet, so dass wir es uns nicht nehmen wollten, auch diesen einen Besuch abzustatten. Immerhin waren wir nun satt und hatten noch genügend Zeit, bevor wir einchecken konnten. Also brachen wir auf, erneut durch das riesige rote Tor, diesmal in entgegengesetzter Richtung, um weitere religiöse Ortschaften aufzusuchen.
Für all jene, die sich mit Kyoto nicht sonderlich gut auskennen: Es gab Tempel und Schreine en masse. Einige davon wurden als besonders sehenswert hervorgehoben und von diversen Reiseanbietern angepriesen, wohingegen andere einfach nur den alltäglichen Bedürfnissen der Bevölkerung dienten. Ungeachtet ihrer Popularität gab es immer wieder Elemente, die sich wiederholten, und gleichzeitig Einzigartigkeiten, die sie gegeneinander abgrenzten. Kurzum: Es gab viel zu sehen.
Unser nächstes Ziel war der Schoren-in Tempel, der ein bisschen versteckt lag und aus einer sehr schön gepflegten Anlage bestand.

Auch hier sahen wir uns gerne um. Auch wenn alle Wege befestigt waren und man sich selbst im schlimmsten Regen sicher hätte bewegen können, wirkte dieser Tempel eiladender und grüner als der Koloss von vorhin.
Weiter dieselbe Straße runter fand sich ein weiterer Tempel, der den Namen Chion-in Tempel trug. Also, auch wenn der Heian Jingu Schrein schon ein protziges Bauwerk war, weiß ich nicht so ganz, welches Wort ich für den Chion-in Tempel verwenden soll.

Und das war nur der Eingang. Das gesamte Gelände erstreckte sich über eine beachtliche Menge an Quadratmetern, die zudem kunstvoll zugebaut und –pflanzt waren.
Einige der Gebäude konnte man einsehen, andere wiederum betreten, was wir natürlich ausnutzten. Auch wenn ein Teil der Anlage gerade saniert wurde, hatten die Verantwortlichen alles in ihrer Macht stehende getan, um Besucher trotzdem anzulocken und ihnen den Zugang zu ermöglichen. Immerhin war dies auch ein geheiligter Ort für die Bewohner der Gegend.
Auch wir machten uns auf, um diesen Teil der Anlage in Augenschein zu nehmen. Am Fuß der nicht allzu hohen Treppe, die zu einem wichtigen Gebäude führte, fanden wir Kisten mit Tüten für die Schuhe. Anfangs verstanden wir nicht, denn wir gingen davon aus, dass wir nur die Treppe hoch, einmal um das Gebäude herum und die Treppe wieder hinunter gehen würden. Letzten Endes passierte eben dies. Allerdings war die Runde um das Gebäude doch größerer Natur als zuerst angenommen.
Wir planten unsere Schuhe abzustellen und hinein zu gehen, doch daraus wurde nichts. Eine Dame mittleren Alters hielt uns auf. Sie sprach kein Wort Englisch, das hinderte sie aber keinesfalls daran, uns behilflich sein zu wollen. Sie drückte uns je eine Tüte in die Hand und erklärte uns mit Gesten, dass wir die Schuhe dort hineinpacken sollten. An diesem Punkt war es uns nicht mehr möglich ihr zu wiedersprechen, weil wir nicht unhöflich erscheinen wollten. Daher befolgten wir ihren gut gemeinten Ratschlag und nahmen unsere Schuhe mit, obwohl uns nicht der Sinn danach stand. Es war eine lustige Begebenheit, die uns wieder vor Augen führte, wie freundlich Fremde doch sein wollten.
Oben angekommen wurden wir von einer großen, güldenen Buddhastatue begrüßt.

Wir wandten uns nach rechts, um das Gebäude zu umrunden, und stellten fest, dass es hier weiter ging. Ein überdachter Weg führte zu einem etwas weiter entfernt stehenden Gebäude. Schon bei den ersten Schritten auf diesem ach so unscheinbaren Dielenboden merkte ich, dass etwas seltsam war. Er war glatt und eben, sah wunderbar gepflegt aus, und doch quietschte es bei jedem Schritt leise. Tatsächlich standen wir auf einem Nachtigallenboden, ohne dass uns jemand darauf vorbereitet hätte. Ich hatte es mir anders vorgestellt, vor allem lauter. Stattdessen war es nur ein leises Fiepen, das bei jedem Schritt zu hören war. Da ich es mir sehr gewünscht hatte, mal über solch einen Boden zu laufen, wenn sich die Gelegenheit ergab, war ich mehr als zufrieden. Ich war begeistert. Ich hätte stundenlang nur hin und her laufen können, aber ich wollte zumindest ein Mindestmaß an Anstand wahren und mich nicht wie ein völlig bekloppter Ausländer aufführen.

Das Innere des Tempels war verschachtelt, verworren und richtig groß. Viele abzweigende Gänge waren nur dem Personal, also den Mönchen vorbehalten, so dass wir Besucher große Teile der Anlage gar nicht zu Gesicht bekamen. Was wir aber sahen, waren lange Gänge, geräumige Hallen, Statuen und Statuetten von Buddha, versteckte Gärten, die von Gebäuden umschlossen waren. So langsam erklärte sich auch, warum man zu Anfang dazu angehalten wurde die Schuhe mitzunehmen: damit man die inneren Gärten betreten konnte.
Nach einiger Zeit gemütlichen Schlenderns entschieden wir uns für den Rückweg, um uns das Tempelgelände außerhalb dieser Baustelle anzusehen. Es gab große Glocken in Pavillons, einen angelegten Teich, über den eine Brücke führte, Grünflächen, Bäume, aber auch sehr viele Kieselwege.

Ich weiß nicht, wie es uns gelungen war, aber auch dieses Mal hatten wir es versäumt, die vom Architekten vorgegebene Richtung zu wählen, nämlich durch den Haupteingang einzutreten, sondern wir kamen durch einen hinteren Nebeneingang auf das Gelände. Ergo: Das riesige Eingangstor sahen wir relativ spät. Einigen Traditionen folgt man offensichtlich auch unbewusst. Stattdessen schlenderten wir erst einmal über das Gelände, gingen dann die breite Treppe hinunter und auf das Tor zu.
Da wir gerade in der Gegend und in Stimmung waren, wandten wir uns nach links, um auch dem Park neben dem Tempel einen Besuch abzustatten. Künstliche Wasserläufe, grüne Inseln zwischen gewundenen Pfaden, zurechtgestutzte Bäume und Büsche, ja, das alles sah sehr japanisch aus.
Nach einer kurzen Runde gingen wir wieder zur Herberge, um endlich einzuchecken. Vor Ort angekommen, stellten wir freudig fest, dass alles für uns bereit war. Wie gebucht bekamen wir unsere Betten im Vierbettzimmer und stutzten erst einmal. Der Raum war ungefähr so groß wie unserer Herberge in Seoul, aber anstatt zwei Personen sollten hier vier nächtigen.
Es gab genau Platz für zwei Hochbetten und die Leitern, um auf die oberen Betten zu gelangen. Wer Gepäck mitbrachte, wusste nicht, was er tat. Es gab wirklich keine Ecke, in der man einen Koffer – oder in unserem Fall Reiserucksack – hätte unterbringen können, ohne dass dieser im Weg war.

Es machte mir erstaunlich wenig aus. Auch wenn die Herberge in Osaka im Vergleich dazu eine Luxusloft war, war das allgemeine Ambiente von Oki’s Inn einfach nur klasse. Wir verbrachten tatsächlich nur so viel Zeit in dem Zimmer, um zu schlafen.
Der größte Knackpunkt war tatsächlich das Bett. Nachdem ich sechs Wochen lang in Seoul in brütender Hitze auf dem oberen Bett genächtigt hatte, machte ich meiner Reisebegleitung deutlich, wo ihr Platz für die restlichen Wochen sein würde. Also bezog ich hier den unteren Posten, der genau wie der obere mit einem Rahmen versehen war, damit man nicht zufällig hinausrollte. Für die oberen Betten ist das eine durchaus sinnvolle Erfindung, befindet sich die Schlafstatt allerdings ebenerdig, sehe ich darin mehr ein Hindernis als eine Hilfe. Ich habe mir mehr als einmal den Kopf am oberen Rahmen gestoßen, nur weil ich aus meinem Käfig raus wollte.
Das Gros unserer Zeit im Oki’s Inn verbrachten wir im geräumigen, traditionell eingerichteten Wohnzimmer – wenn man diesen Raum so nennen darf.

Ein Raum auf Kniehöhe, dessen Boden mit Tatamimatten ausgelegt war, lud zum Verweilen, Sozialisieren und Essen gleichermaßen ein. Man kam in die Räumlichkeit durch gläserne Schiebetüren; am Haupteingang gab es eine kleine Veranda. Selbstverständlich betrat man das Zimmer ohne Schuhwerk und lümmelte sich gemütlich auf dem Boden oder den dafür vorgesehenen Kissen.
Wir verbrachten die meiste Zeit am runden Tisch, obwohl er kleiner war. Dort nahmen wir viele Mahlzeiten ein, unterhielten uns mit anderen Gästen des Hostels, trafen die Katzen der Inhaber und hatten sehr viel Spaß.
Links vom Gemeinschaftsraum fand sich eine kleine Küche, die noch spartanischer eingerichtet war als jene im Inno Hostel in Seoul. Es gab ein Waschbecken, eine Mikrowelle, einige Töpfe und Teller sowie zwei Herdplatten. Darüber hinaus bot das Oki’s Inn kostenlos Tee für seine Besucher an – ein herrlicher Service.
Ein kleiner überdachter Innenhof verband die verschiedenen Gebäude miteinander. Der Empfangsbereich mit angrenzenden Schlafquartieren war von Gemeinschaftsraum und Badezimmern getrennt. Ein einsamer, junger Baum stand inmitten der Gebäude und zwang die Gäste zu einem minimalen Umweg. Der Einfachheit halber stellte man uns Badelatschen zur Verfügung, um schnell mal von A nach B gehen zu können, ohne festes Schuhwerk unterschnallen zu müssen. Immerhin betraten wir das Schlafzimmer auch barfuß.

Es war eine wirklich urige Herberge mit sehr viel Charme, Stil und herausragenden Inhabern. Ich weiß bis heute nicht, wie sie heißen. Wir trafen lustige Leute dort, bekamen immer Unterstützung, wenn wir sie brauchten, und genossen unsere Zeit. Eine hervorragende Wahl, weshalb ich das OKI’s Inn jedem gerne weiterempfehle.
Erwähnenswert finde ich die Geldbeschaffung in Japan. Während Neuseeländer durch und durch auf den Einkauf mit Kreditkarte eingestellt sind und man sich praktisch an jedem Geldautomaten gütlich tun kann, so lange man sein Plastikgeld bei sich führt und unter Umständen zu Mehrausgaben in Form von Gebühren bereit ist, ist dieses Prinzip der bargeldlosen Zahlung in asiatischen Ländern noch nicht so weit verbreitet. Wer sich zudem keine ausreichenden Finanzmittel im Vorfeld zulegt, wird nicht umhin kommen, sich einigen Probleme gegenüberzusehen. In Japan war es uns nicht möglich an jedem beliebigen Automaten jeder beliebigen Bank Geld abzuheben. Seitens unseres Kreditinstitutes gab es diesbezüglich keinerlei Probleme, nein, es waren die japanischen Banken und deren Maschinen, die dies nicht zuließen. Tatsächlich fanden wir nur einen Typ Geldautomat, der unsere Kreditkarten nahm und eine Auszahlung ermöglichte. Diese standen in jedem 7/11 Laden, den wir unterwegs antrafen – oder zumindest stolperten wir immer in ausgerechnet die Läden, die hierbei keine Probleme machten, was ich äußerst begrüße. Einen Haken hatte die Sache dann doch: Man konnte nur Beträge in 10.000-Yen-Schritten abheben (zu Deutsch waren es ungefähr je 100 Euro). Es ist also durchaus möglich ohne Bargeld nach Japan zu fliegen, allerdings ist die Beschaffung desselbigen nicht so einfach wie anderenorts.
Wir erinnern uns daran, dass Lotte nicht omnipräsent ist:

Wie bereits angedeutet liefen wir im Hostel einigen interessanten Leuten über den Weg. Dazu zählte auch Yvette. Die gebürtige Mexikanerin machte gerade in Japan ihren Urlaub und besuchte bei der Gelegenheit einige Freunde, die sie durch frühere Erfahrungen in diesem Land hatte. Wir unterhielte uns gut und oft mir ihr, weshalb wir auch einen gemeinsam Ausflug in Angriff nahmen.
Während ich mir in Südkorea, insbesondere in Seoul, nie Gedanken darum machte, ob ich etwas zu Essen bekäme, wenn wir einen Tagesausflug machten, hatte ich in Japan immer Angst davor Hunger zu leiden. Der Ausflug zum Osaka Castle Museum steckte mir noch in den Knochen. Die Ankunft in Kyoto tat ihr Übriges. Wenn es selbst in Großstädten wie Osaka oder Kyoto nicht üblich war überall Marktstände, Cafés oder Läden zu haben, in denen man wenn schon nicht eine vernünftige Mahlzeit, so doch zumindest einen bezahlbaren Snack ergattern konnte, wie sah es dann in kleineren Agglomerationen aus? Ich machte mir zusehends weniger Sorgen bezüglich eines Kulturschocks, wenn ich wieder nach Hause kam. In Deutschland sah es doch nicht anders aus. Man musste bei Ausflügen immer eigenes Essen mitnehmen oder genau wissen, wann man wo sein würde und in der Nähe ein Restaurant kennen.
Das hielt uns keinesfalls davon ab völlig unvorbereitet, was die Essensfrage betraf, zu einem neuen Ausflug aufzubrechen. Wir nahmen Yvette mit. Unser Ziel war das Nijo Schloss, das sich nur wenige U-Bahnhaltestellen von unserer Herberge befand.
Mit mehr fast 400 Jahren und der Plakette des Weltkulturerbes erwarteten wir jede Menge, auch wenn uns dank der Besichtigung des Osaka Castle Museums noch einige Sorgen plagten. Zu Unrecht, wie sich herausstellte. Das Nijo Schloss ist eine Besichtigung auf jeden Fall wert. Ich empfehle es hiermit ausdrücklich. Dieses Mal waren die 600 Yen eine lohnenswerte Investition.
Wir genossen den imposanten Eingang mit Vorsicht, auch wenn die goldverzierte Holzkonstruktion beeindruckend war.

Dahinter umfingen uns Kieswege, deren Ränder Rasenstreifen und kleine Gartenanlagen säumten. Wir bogen nach links ab, folgten dem Weg und standen plötzlich vor einem Prachtbau, der sich über mehrere Einzelgebäude erstreckte. Korridore verbanden diese miteinander.
Spätestens hier mussten wir mit unserer Tradition brechen und den vorgegebenen Weg gehen, weil es einfach keine andere Möglichkeit gab, das Schloss zu betreten. Drinnen waren Fotos strengstens untersagt. Im Eingangsbereich ließen wir unser Schuhe zurück und begaben uns ins Innere des Komplexes.
Es gab verschiedene Räume, die in vergangener Zeit verschiedene Funktionen erfüllt hatten. Neben dem Wartezimmer und dem Empfangssaal sahen wir auch die Audienzhalle sowie das Schlafquartier des Shoguns. In jedem Raum fanden sich beeindruckende Gemälde, die manchmal direkt auf den Wänden aufgetragen waren, andernorts nur Klappwände zierten. Man hatte sehr viel Gold benutzt, so dass es mitunter erdrückend wirkte. Es handelte sich hauptsächlich um Landschaftsdarstellungen und Naturmalereien. Alles in allem war es ein wirklich beachtlicher Bau, der einen bleibenden Eindruck hinterließ.
Auch hier fand sich in vielen Bereichen ein Nachtigallenboden, so dass ich weiterhin meine Freude damit haben konnte. Die Gang durch den Palast war so konzipiert, dass man eine Runde um alle Räume drehte und diese von fast allen Seiten einsehen konnte. Auf diese Weise lief man nicht in andere Leute hinein, die in entgegengesetzter Richtung unterwegs waren. Nach gründlicher Betrachtung verließen wir dieses künstlerische Meisterwerk wieder, um die umliegenden Gärten zu durchforsten.

Es wurde schnell deutlich, dass die Japaner eine ganz andere Einstellung zur Gartengestaltung und –pflege aufwiesen als ihre Nachbarn im nicht zu fernen Westen.

Es wirkte wesentlich durchdachter und geplanter, als wenn man nur ein bisschen Grün aussäte und ab und zu den Rasen mähte.

In einer Ecke des Gartens fand sich ein kleines Café, das wir gerne aufsuchten. Wir hatten unsere Runde um das Gelände beendet und festgestellt, dass es Zeit für Mittagessen war. In diesem Café hofften wir fündig zu werden. Bereits bei der Annäherung bat uns ein Mitarbeiter vor der Tür enthusiastisch herein, doch wir wollten nicht irgendetwas. Also fragten wir zuerst, ob sie neben Erfrischungsgetränken auch Speisen anboten. Der Mensch vor der Tür sah uns erst einmal verständnislos an, bevor er die Frage verdaute und dann leider verneinte. Für uns hieß dies, dass wir weitersuchen mussten.
So verließen wir beschwingt, aber hungrig das Gelände und sahen uns um. Blanke Häuserzeilen starrten uns entgegen. Einige Autos fuhren auf der Straße vorbei. Kein Hinweis auf ein Lokal in der Nähe. Um nicht ziel- und orientierungslos durch die Gegend zu stapfen, wie wir es in Osaka gemacht hatten, beschlossen wir die Einheimischen um Hilfe zu bitten. Wir gingen zur Information und fragen, ob uns jemand sagen könne, wo es ein Restaurant in der Nähe gäbe. Wieder starrten uns ausdruckslose Augen entgegen, bevor wir ein Nein zu hören bekamen. Wir fragten weiter, doch ohne Erfolg. Letzten Endes mussten wir auf eigene Faust aufbrechen und unser Glück in den Straßen Kyotos versuchen.
Keine 100 Meter weiter fanden wir an einer großen Kreuzung ein einsames Restaurant, vor dem eine kleine Menschentraube stand. Es war Mittagszeit, es war viel los. Einige der Leute entschieden sich, dass sie nicht länger warten wollten und gingen weiter. Wir wollten dieses Risiko nicht eingehen, zumal die Speisekarte draußen vielversprechend aussah. So warteten wir nur wenige Minuten, bevor ein Keller heraussprang, uns nach der Anzahl fragte und uns herein bat.
Leider waren derzeit nur Plätze an der Theke frei, weshalb wir in einer Reihe nebeneinander saßen und uns nicht so gut unterhalten konnten. Aber wir waren vorwiegend wegen des Essens hier, so dass es letzten Endes nicht so schlimm war. Die Speisekarte bot Nudelsuppenvariationen in Hülle und Fülle, doch ich befürchtete, dass es für meinen ausgehungerten Magen nicht genug sein würde. Also bestellte ich neben meiner Portion Ramen noch Gyoza und frittiertes Hähnchen dazu – selbstverständlich für alle.

Es war hervorragend, deliziös. Wir bekamen unsere Bestellung sehr schnell, sie war heiß und gut abgeschmeckt. Außerdem beinhaltete die Portion alles, was ich zu dem Zeitpunkt begehrte. Mein Lob an den Chef.
Da wir gerade wieder beim Thema Essen sind, hole ich jetzt weiter aus, was meine Gewohnheiten in Kyoto betraf.
Im Gegensatz zu anderen Orten, an denen wir während unserer Reise verweilt hatten, kochten wir in Japan überhaupt nicht. Das, was Kochen am nächsten kommt, war die tägliche Zubereitung von Tee. In den Supermärkten nicht weit von OKI’s Inn gab es eine recht gute Auswahl an Fertiggerichten, die man wahlweise warm oder kalt essen konnte. Zum Frühstück holten wir uns meist irgendetwas Sushi-Artiges, während ich abends mal dies, mal das kaufte. Auch wenn ich das Essen nicht schlechtreden möchte, so erfüllte es doch nicht so ganz meine Standards, was vor allem an der Temperatur lag. Ich hatte mich dermaßen an glühend heiße Speisen gewöhnt, dass mir der kalte – oder im besten Fall lauwarme – Reis langweilig vorkam. Selbst wenn ich mir die Gerichte aufwärmte, was der Einfachheit halber in der Mikrowelle geschah, boten sie kein nennenswertes Geschmackserlebnis. Ich versuchte verschiedene Variationen und Kombinationen, doch letzten Endes vermisste ich frisches Bibimbap.

Um die Ecke gab es allerdings eine europäische Bäckerei, die – im Gegensatz zu Tous les Jours – diese Bezeichnung tatsächlich verdiente. Wir holten uns zwei Teilchen aus Blätterteig, die mit Früchten belegt waren.

Natürlich kamen wir nicht umhin die japanische Burgerkette, Mos Burger genannt, zu unseren Mahlzeiten zu zählen. Was sofort auffiel, war die Tatsache, dass die Burger viel zu klein waren. Das reichte ja gerade mal als Vorspeise.

Es gab Teriyaki-Burger, weil diese von uns als Synonym für das Land betrachtet wurden. Kurze Zeit später musste ich noch etwas mehr essen.
Mittlerweile war uns Spiel „Finde die Koreaner“ ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, doch wir fügten eine neue Dimension hinzu. In Kyoto trafen wir auf immer mehr Asiaten, die weder koreanisch, japanisch, noch chinesisch aussahen. Etwas stimmte nicht. Es ergab irgendwie keinen Sinn – bis wir sie reden hörten. Es handelte sich bei diesem Typ offensichtlich um Amerikaner asiatischer Herkunft. Das machte die Sache wieder einfach.
Wir besuchten ebenfalls den Yasaka Schrein, der unweit unserer Herberge war. Dort fanden wir Gebäude verschiedener Stilrichtungen nebeneinander aufgestellt. Am Eingang begrüßte uns ein großes rot-weißes Tor, das hoch erhoben auf einer Treppe stand. Eine Löwenstatue hielt mahnend alles Böse fern.

Dahinter fand man allerdings viele Gebäude, die aus dunkelbraunem Holz bestanden und mit Gold verziert waren. Einige kleinere Bauwerke waren nur lose zusammengezimmerte Bretterbuden, bei denen wir Angst hatten, dass sie bald auseinanderfallen würden. Wiederum andere Bauten hingegen mischten beide Stile.

Wir drehten eine große Runde, liefen Treppen rauf, Treppen hinunter, gingen um Hauptgebäude herum, um uns Verstecktes anzusehen, beobachteten Leute, wie sie beteten, fanden den Zugang zum Park, um festzustellen, dass dieser den Schrein mit dem Chion-in Tempel verband, drehten wieder um und verließen das Gelände wieder.
Wir fanden eine Straße, auf der es zu beiden Seiten relativ breite Fußgängerwege gab. Geschäfte verschiedener Art säumten den Fahrbahnrand, während eine schöne Dekoration zum Schlendern einlud. Die Dächer erlaubten es zudem bei Wind und Wetter von Geschäft zu Geschäft zu bummeln. Franziska fand einen Hello Kitty Laden, den sie unbedingt von innen sehen wollte. Allerdings überraschte es mich sehr, wie wenige Restaurants wir trotz so viele Einkaufsmöglichkeiten vorfanden.

Wir machten uns recht frühzeitig Gedanken darüber, wie wir von Kyoto nach Tokyo kommen würden. Ursprünglich war eine Fahrt mit der Bahn angedacht, doch nach unserer Erfahrung mit der JR und den horrenden Preisen erwogen wir Alternativen. Franziska fand in einem Internetforum, dass Busse durchaus günstiger als die JR waren, leider aber auch länger brauchten. Der Shinkanzen mag schnell sein, günstig ist er auf keinen Fall. Das japanische Äquivalent eines Inter City Buses klang auf einmal recht verlockend. Nach weiterer Recherche fand meine Reisebegleitung allerdings nur einen Busanbieter, der seine Website auch in englischer Sprache gestaltet hatte, so dass uns eine Buchung möglich wurde. Das war doch arg suspekt. Wir fragten freundlich bei unseren Herbergsbesitzern nach, doch diese bestätigten uns, dass es sich um eine seriöse und zuverlässige Seite handelte. In Japan schien sie bekannt zu sein.
Somit fiel unsere Wahl auf den Willer Express Busdienst. Wir folgten den Anweisungen auf der Website, buchten unsere Tickets, bekamen eine Bestellbestätigung und dachten uns, dass wir damit einfach zur Bezahlung fortschreiten könnten. Wir vergaßen offensichtlich, dass wir es mit einem japanischen Verkehrsunternehmen zu tun hatten.
Als Ausländer hatte man bei der Wahl der Zahlungsmethoden nur eine äußerst eingeschränkte Wahl, nämlich keine. Es sei denn, ein Freund zahlte. Da wir keine solchen Freunde in Kyoto hatten, blieb uns nichts anderes übrig, als die Zahlung per Einzahlung an einem bestimmten Automaten in einem gewissen Geschäft, 7/11, vorzunehmen. Als wir am nächsten Tag unterwegs waren, wollten wir das unbedingt schnell erledigen, weshalb wir in ein 7/11 einkehrten und es dort versuchten. Wir hatten immerhin die Buchungsnummer dabei.
Das Problem fing aber schon damit an, dass der Automat genauso viel Englisch konnte, wie der durchschnittliche Japaner. Wir klickten uns durch das Menü, bis wir einen passend scheinenden Punkt fanden. Dort sollten wir die Buchungsnummer eingeben. Das klang machbar. Gesagt, getan, wir kamen zum nächsten Menüpunkt. Jetzt wollte das Gerät unsere Festnetznummer. Auch diese hatten wir wohlweislich mitgenommen, weil wir sie schon bei der Buchung brauchten. Allerdings war die Sache nicht ganz so einfach, denn es gab zwei Felder, in die man etwas eintrag en konnte, und keines davon hatte eine englische Überschrift. An diesem Punkt fragen wir eine der Verkäuferinnen, weil wir nun wirklich nicht wussten, was wir hier angeben sollten.
Das darauf folgende Problem bestand darin, eine Verkäuferin zu finden, die Englisch sprach. Wir brachten den ganzen Laden in Aufruhr, weil die Angestellten uns zum einen helfen wollten, es zum anderen wegen der Sprachbarriere nicht konnten. Endlich fand sich eine junge Dame, die zumindest einige zusammenhängende Sätze zustanden brachte, so dass sie an die Front geschickt wurde. Sie zeigte Franziska, wie der Automat funktionierte.
Es begann mit demselben Menü, das meine Reisebegleitung auch schon selbst gefunden hatte. Sie gaben gemeinsam die Buchungsnummer ein, es erschien wieder die Aufforderung eine Telefonnummer einzutippen. Die Verkäuferin versuchte es ohne und erzielte einen Abbruch. Es ging von vorne los. Diesmal gab sie sie in eines der Felder ein, doch das führte dazu, dass man seine ganze Adresse eingeben musste. Diese hatten wir nicht. Es ging einige Male hin und her, die Verkäuferin versuchte verschiedene Fälder, wir hatten verschiedene Nummern (Buchungs- und Belegnummer), doch nichts half. Früher oder später kamen wir an einen Punkt, an dem uns Daten fehlten. Dass der Automat nicht auch noch unser Sternzeichen wissen wollte, war alles. Es ging so weit, dass ein Kunde sich dazu gesellte und uns zu helfen versuchte.
Nach einer Viertelstunde gaben wir auf. Wir bedankten uns recht freundlich bei der Verkäuferin, holten uns noch einen Snack, um uns erkenntlich zu zeigen, und zogen wieder von dannen. Das Ziel war das Hostel, um uns zu erkundigen, wie wir denn nun die Tickets bezahlen konnten. Der Einfachheit halber fragten wir die gerade anwesende Inhaberin. Sie meinte, dass es für gewöhnlich sehr einfach sei, man aber unbedingt Bargeld brauche. Wir sahen uns verwirrt an.
An diesem Punkt ging Franziska noch einmal die Mail durch. Irgendwo im Text fand sie dann einen Passus, der besagte, dass man die Buchung erst via angegebenem Link bestätigen musste, bevor die Buchungsnummer aktiviert wurde. Also taten wir dies. Wenige Minuten später brachen wir zum nächsten 7/11-Markt auf, um unsere Tickets endlich käuflich zu erwerben. Wir standen vor dem Automaten und stellten fest, dass er gar kein Bargeld annahm. Es gab nur einen Schlitz für eine Karte. Bevor wir jetzt irgendetwas falsch machten, stapften wir entmutigt und frustriert zurück ins Hostel.
Eben in dieser Verfassung schlugen wir vor der Inhaberin auf. Um dieses Mal ganz sicher zu gehen, dass nichts schiefging, baten wir unsere Retterin in Not, dass sie uns doch zum nächsten 7/11 begleitete – er war eh um die Ecke.
Wir kamen also in den nächsten Laden reinspaziert, gingen zielgerichtet zum Automaten, stellten uns dämlich davor und begannen von neuem unser Ticket zu bestellen. Genauer gesagt war es unsere hilfreiche Begleitung, die dies alles erledigte: Buchungsnummer, Telefonnummer, plötzlich änderte sich der Bildschirm, so weit waren wir beim letzten Mal nicht gekommen. Ich fühlte mich, als hätte ich ein neues Level in einem Videospiel freigespielt. Unsere Herbergsmutter tippte noch schnell auf einige Buttons, die auf dem Bildschirm aufpoppten, und dann waren wir wieder am Anfang. Tickets hatten wir immer noch nicht.
Versiert in diesen Angelegenheiten bückte sie sich und holte aus einem Fach einen Beleg hervor. Das war immer noch nicht das Busticket, sondern der Buchungsbeleg, mit dem wir zum Verkäufer gehen mussten. Erst als wir an der Kasse den ausstehenden Betrag beglichen hatten, druckte dieser uns die Fahrkarten aus. Wir waren fertig. Aber immerhin stand unserer Reise nach Tokyo nichts mehr im Wege. Damit auch nichts mehr schief ging, packten wir die Fahrkarten sorgsam weg.
Selbstverständlich lernten wir nichts aus unseren bisherigen Abenteuern mit den japanischen öffentlichen Verkehrsmittel und beschlossen daher einen Ausflug zu einem etwas weiter entlegenen Schrein zu unternehmen. Des Komforts wegen entschieden wir uns für den Schienenweg, um unserem Ziel wenigstens ein bisschen näher zu kommen. Es war drückend heiß an diesem Tag, die Sonne schien von einem herrlich blauen Himmel auf uns herab und weit und breit war keine Klimatisierung in Sicht. Dennoch wollten wir uns dieses Wunderwerk nicht entgehen lassen. Immerhin wurde der Fushimi Inari-Taisha Schrein immer wieder lobenswert erwähnt und von vielen Reisenden sowie Einheimischen empfohlen.
Leider lag dieser Schrein nur ein ganz klein bisschen außerhalb des vergrößerten Bereiches auf unserer Stadtkarte, weshalb wir zwar wussten, an welcher Haltestelle wir auszusteigen hatten. Aber die Strecke von der Haltestelle bis zum tatsächlichen Schrein war ein kleines Rätsel für uns. Darüber hinaus nahmen wir die U-Bahn anstatt der JR-Linie, wodurch wir noch ein kleines bisschen weiter von unserem Ziel entfernt ankamen. Wir verließen uns einfach auf unserem Orientierungssinn.
Als wir an der Haltestelle ankamen, begrüßte uns nichts. Kein Schild, kein Hinweis, kein Wegweiser, keine Touristeninfo, nichts, das in irgendeiner Weise hilfreich gewesen wäre, diesen Schrein zu finden. Wahrscheinlich rechnete hier, so weit von der Sehenswürdigkeit, niemand mit einem neugierigen Touristen. Also schlugen wir irgendeine Richtung ein und stolperten über leere Straßen. Auch wenn die Karte nicht jede einzelne Gasse und Straße aufzeigte, hatten wir doch eine grobe Richtung, in der wir uns orientieren konnten.
Nach einiger Zeit, einigem Irren und keinem Menschen, dem wir unterwegs begegneten, kamen wir in einen belebteren Teil der Stadt, der schon eher den einen oder anderen Touristen gesehen hatte. Kleine Läden zierten hier die bürgersteiglosen Straßen. Wir überquerten Gleise und sahen die JR-Haltestelle unweit. Es schien der richtige Weg zu sein.
Als wir auf eine belebte Fußgängerzone stießen, war jeder Zweifel verflogen. So folgten wir nunmehr dem mehr als deutlichen Weg zusammen mit den Menschenmassen, die sich langsam ansammelten. Unser Weg zum Fushimi Inari-Taisha Schrein war geebnet.
Einige Worte zu eben diesem Schrein. Das Besondere an ihm ist die schiere Anzahl an hintereinander platzierten roten Toren. Sie drängen sich so dicht an dicht, dass man stellenweise durch einen roten Tunnel geht, der nur durch wenige Lücken ein bisschen Sonnenlicht durchlässt. Diese Tore gibt es in verschiedenen Größen. Einige sind nur so klein, dass sie über einem Grabstein stehen; andere sind so groß, dass eine Kutsche hindurchpassen würde. Das ganze Konstrukt stand auf einem Berg.
Am Anfang begrüßte uns ein riesiges Tor. (Nein, dies war nicht der Haupteingang.)

Ohne Unterbrechung zogen wir weiter, um uns diese Sehenswürdigkeit zu Gemüte zu führen. So stapften wir Steigungen empor, erklommen Treppenstufen, passierten Bäume, Skulpturen, ausgetrocknete Bachläufe und bestaunten die wirklich endlos scheinende Flut an roten Toren. Irgendwo in der Mitte gab es einen Friedhof neben einem See, um den herum einige Souvenirläden angelegt waren. Wir entschieden uns für eine Pause.

Leute kamen uns entgegen, Leute gingen wieder. An manchen Stellen gab es zwei verschiedene Wege, einen für jene die rauf gingen, den anderen für jene, die wieder runter kamen. Aber größtenteils geriet man einfach immer wieder in den Gegenverkehr.
Während wir einer Schildkröte beim Schwimmen zusahen, überdachten wir unsere Situation. Es war heiß, wir waren erschöpft, ich bekam Hunger, und obwohl es Läden in unmittelbarer Nähe gab, bot keiner davon eine gute Mahlzeit an. Dabei hatten wir erst die Hälfte der Strecke hinter uns gelassen. Man musste bedenken, dass wir die gleiche Anzahl von Schritten, die wir gekommen waren, auch wieder zurückgehen mussten. So entschieden wir uns für den Rückweg, denn unten gab es Restaurants und Eisdielen. Nach einer kurzen Erfrischung zogen wir weiter, denn leider fanden wir in der Nähe des Schreins kein Lokal, das uns ansprach.
In der Innenstadt gab es einen Bereich, der auf der Karte hervorgehoben war. Dort fanden sich Geschäfte und Einkaufspassagen. Es war unser nächstes Ziel. In der Hoffnung ein interessantes Restaurant zu finden, begaben wir uns zum Nishiki Food Markt. Eine kurze Fahrt mit der Bahn, einige Schritte zu Fuß gelaufen, schon waren wir da und schlenderten durch eine teils überdachte Einkaufspassage.
Leider bestand der Nishiki Food Market hauptsächlich aus Geschäften, die Essen in ihrer rohen Form verkauften. Außer einigen Snacks fanden wir nichts, was wir hätten sofort verzehren können. Die Suche ging also weiter. Ich gestehe ehrlich, dass ich an diesem Punkt nicht mehr so ganz aufnahmefähig war, da mein Magen mir das Zepter aus der Hand nahm und einen klaren Kurs steuerte.
Wir verlagerten unsere Suche auf eine Parallelstraße, auf der wir zwar viele prunkvolle Gebäude, aber nur wenige Lokale fanden. Was dies Gebäude beherbergten, vermochte ich nicht herauszufinden, da ich stark abgelenkt war.

Doch wir weigerten uns aufzugeben. Irgendwo hier musste es doch etwas zu essen geben. Mittlerweile hätte ich mich sogar mit McDonald’s zufrieden gegeben. Glücklicherweise musste es nicht so weit kommen, denn wir fanden die japanische Alternative, Mos-Burger.
Nach dieser Stärkung war meine Abenteuerlust von neuem entfacht und ich sah mich in der Lage, dem Trubel dieser Großstadt entgegenzutreten. Franziska hatte herausgefunden, dass sich in der Nähe ein Bento-Shop befand, den sie gerne persönlich aufsuchen wollte. Wir kannten die ungefähre Lage und hatten eine Stadtkarte dabei – Es konnte nichts mehr schief gehen. Nach einigem hin und her, standen wir in dem gesuchten Laden und meine Reisebegleitung schaute sich neugierig um.
Als nächstes kehrten wir in die angrenzende, überdachte Einkaufspassage, um uns dort die verschiedenen Geschäfte anzusehen.

Bei dieser Gelegenheit kehrte ich in eine der zahlreichen Pachinko-Hallen ein. Für all jene, die nicht im Bild sind: Pachinko ist ein Glücksspiel, bei dem man kleine Metallkugeln in einen Automaten wirft. Je nachdem, wo sie landen, kann man etwas gewinnen. In Spielhallen stehen dutzende, ja sogar hunderte dieser Automaten nebeneinander, so dass ein enormer Lärm entsteht. Aus eben diesem Grund wollte ich einmal in so ein Geschäft gehen. Besagte Halle hatte zwei Eingänge, die beide durch solide Glastüren geschlossen waren. Ich betrat die Halle durch Eingang 1 und verließ sie wieder durch Eingang 2. Der ganze Weg war nicht mehr als fünf Meter lang, trotzdem hatte ich nach dieser kurzen Zeit bereits Schwierigkeiten mit meinem Gehör. Als ich wieder in der verhältnismäßig ruhigen Einkaufspassage war, brauchte ich einem Moment, um mich zurechtzufinden. Glücklicherweise war meine Reisebegleitung nicht einfach zu übersehen. Ich verstehe nicht, wie Leute es über mehrere Stunden in solchen Hallen aushalten.
Glücklicherweise war die Einkaufspassage unweit vom OKI’s Inn entfernt, so dass wir uns zu Fuß auf den Heimweg begaben. Nun gut, vielleicht übertreibe ich hier ein bisschen. Immerhin waren wir noch 20 Minuten zu Fuß unterwegs, aber das war für uns keine nennenswerte Entfernung.
Während unseres Aufenthaltes in Kyoto trug es sich zu, dass ein Taifun Japan streifte. Schon tags zuvor verdunkelten dräuende Wolken die Ankunft dieses Wetterphänomens. An besagtem Tag war es denn dunkel, schwarze Wolken hingen tief, Regen fiel, starker Wind machte Ausflüge zu einer Qual, es kühlte merklich ab – und der Sturm traf Kyoto nicht einmal, denn es war nur ein Ausläufer. Weiter im Süden hatten die Leute mit der prallen Gewalt des Taifuns zu kämpfen. Also entschlossen wir uns den Tag im Hostel zu verbringen und nur raus zu gehen, um etwas zu essen zu kaufen. Auch so war es ein angenehmer Tag. Wir saßen im geräumigen Wohnzimmer und unterhielten uns mit fast allen Gästen. Bei der Gelegenheit lernten wir auch die Katzen der Hostelinhaber kennen.
Ninja Museum
Ganz groß auf unserer To Do-Liste Japan stand „Iga“. Besser gesagt das Ninja-Haus, das dort stand und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Leider befürchteten wir zwischendurch immer wieder, dass wir dort nie ankommen würden, weil wir den Passierschein A38 nicht erhalten hatten. Glücklicherweise waren die Instruktionen, also die Verbindung, die die Managerin unseres Hostels rausgesucht hatte, Gold wert. Es stand alles drauf, was wir wissen mussten, so dass wir uns dazu entschlossen, dieses Abenteuer in Angriff zu nehmen (siehe oben).
So brachen wir eines Morgens auf, um diese Fahrt von mehr als zwei Stunden auf uns zu nehmen, um einem Mythos hinterher zu jagen, der uns hoffentlich in vollem Ausmaß amüsieren würde. Da die Umsteigezeiten nicht sonderlich lang waren, was man durchaus auch als Vorteil verstehen konnte, fragten wir bei jeder Gelegenheit nach, welchen Zug wir denn nun tatsächlich nehmen mussten – um auf jeden Fall anzukommen. Dieses Bedürfnis hatte ich nie in Seoul oder Busan verspürt, aber hier waren wir schließlich in Japan.


Nach einer langen Fahrt, auf der wir entschieden zu viel Spaß auf Kosten der Japaner hatten, kamen wir am Bahnhof Uenoshi an. Von dort aus mussten wir unseren Weg zu Fuß fortsetzen. Das war nur halb so wild, dachten wir uns, zumal wir eine Touristeninformation nicht weit vom Bahnhof fanden. Dort bekamen wir auch eine Karte mit eingezeichnetem Weg zum Museum – allerdings war diese ausschließlich auf Japanisch. Nicht so schlimm, denn es fanden sich überall Hinweise darauf, ob wir noch auf dem richtigen Weg waren. Es gab Schaufensterpuppen, die wie Ninjas gekleidet waren und sich gut sichtbar versteckten; Ninjas waren an Wände gepinselt; sogar auf und in dem Zug, der nach Iga führte, waren überall Ninjas drauf. Wir brauchten nur einen kurzen Anstoß in die richtige Richtung. Außerdem musste man nur 10 Minuten zu Fuß den Berg rauf gehen.


Oben angekommen legten wir erst einmal eine kurze Rast mit Snacks ein. Dann begaben wir uns zu Ticketschalter, nur um weiteren Fragen gegenübergestellt zu werden. Da gab es verschiedene Eintrittskarten für verschiedene Sehenswürdigkeiten. Was uns hauptsächlich interessierte, war das Ninja-Haus, das Museum dazu nahmen wir gerne noch mit. Das Uneo Schloss hingegen stand nicht sonderlich weit auf unserer Prioritätenliste, tatsächlich wussten wir bis dahin gar nicht, dass es da stand. Die Ninja-Show fand ich nicht zwingend notwendig, doch da man dafür eh separat bezahlen musste, wollten wir uns spontan entschließen. Noch war genug Zeit, sich ganz und gar dem Museum zu widmen.
Was hier so einfach als Aufschlüsselung aller möglichen Optionen aufgeführt ist, war tatsächlich hart erarbeitet, denn keine der beiden Damen am Schalter sprach genug Englisch, um uns die aufkommenden Fragen zu beantworten. Ich fühlte mich wie in der Touristeninformation in Hongdae. Wir wollten doch nur wissen, welches Ticket wir kaufen mussten. Nachdem sie unsere Frage verstanden hatten, versuchten sie es mit Händen und Füßen sowie einigen Informationsmaterialien – und hatten Erfolg. Wir erfuhren, was wir wissen mussten.
So stürzten wir uns ins Abenteuer und Vergnügen. Es begann damit, dass uns eine Tüte für unsere Schuhe in die Hand gedrückt wurde – natürlich muss man Schuhe im Haus ausziehen. In diesem Ninja-Haus, das aus nur zwei Räumen bestand, gab es jede Menge zu sehen. Da wir die einzigen beiden (sichtbaren) Ausländer dieser Gruppe waren, machte sich niemand die Mühe irgendetwas auf Englisch zu erklären. Somit kann ich wenig zum Inhalt der Ansagen machen. Aber für die visuellen Demonstrationen brauchte man wenige Sprachkenntnisse.
Es war alles dabei, was einem den Tag versüßt: Verstecke hinter Wänden, Regale, die zu Leitern umfunktioniert wurden, Geheimtüren, falsche Böden, Verstecke unterm Fußboden. Es war herrlich. Die Damen wussten schon, was sie taten, auch wenn internationale Präsentationen nicht zu ihren Stärken zählten.
Sie begann damit, dass sie nonchalant gegen eine Wand lief – und hinter ihr verschwand. Es war eine Drehtür, die als Wand getarnt war. Bis in die kleinsten Details, Maserung und Kratzer, waren beide Seiten dieser Wand-Tür identisch. So plötzlich, wie die Dame verschwunden war, tauchte sie auch wieder auf. Dabei war es nicht nur wichtig zu wissen, wo die Wand war und dass sie sich bewegte, sondern auch wann man sie wieder zum Reinrasten bringen musste. Denn sie bewege sich sanft und geräuschlos in ihren Angeln.
Die Dame zeigte uns Verstecke hinter den Wänden, aus denen man den ganzen Raum überblicken konnte, ohne selbst gesehen zu werden. Eine Garderobe konnte zu einer Leiter umfunktioniert werden und wenn man oben im Zwischenboden verschwunden war, zog man sie einfach wieder hoch.
Ein Teil einer Außenwand schien stabil, doch trog dieser Eindruck. Denn wenn man zwei Bolzen kurz anhob, hatte man eine Tür. Aus einer vermeidlichen Sackgasse wurde ein Weg in die Freiheit. Mehr und mehr solcher Kleinigkeiten wurden uns dargeboten. Es machte Spaß den geübten Darstellern zuzusehen, wie sie mühelos verschwanden, auftauchten und Sachen aus dem Nichts herzauberten. Als sie mit ihrer Demonstration fertig waren, vierließen wir das Haus auf der anderen Seite wieder.
Dann begaben wir uns in das tatsächliche Museum, in dem verschiedene Ausstellungsstücke und Erläuterungen dem Besucher das Leben der Ninjas näher erläuterten. Wie viel davon Tatsachen und wie viel Fiktion waren, kann ich nicht beurteilen. Jedenfalls war es äußerst interessant.
Da der Tag noch jung war und wir sonst nicht mehr viel zu tun hatten, beschlossen wir uns die Ninja-Show doch noch anzusehen. Eine gute Wahl. Wir bekamen einen guten Platz in zweiter Reihe, so dass wir eine hervorragende Sicht auf die Bühne hatten. Zu Anfang erklärte ein Ninja irgendetwas, aber wir waren mal wieder außen vor. Erst bei den Anweisungen bezüglich Fotografie und Filmen schnappten wir genug englische Begriffe auf, um zu wissen, dass man bitte kein Blitzlicht verwenden sollte und Filmen gänzlich untersagt wäre. Irgendwann während der Show fragte uns einer der Artisten, ob wir irgendetwas auf Japanisch verstanden. Wir guckten groß und schüttelten den Kopf, woraufhin er einige Erklärungen auf Englisch abgab. Das war äußerst hilfreich, allerdings bestand sein Englisch auch mehr aus Händen und Füßen als aus zusammenhängenden Sätzen. Trotzdem war ich froh über seine Bemühungen.
Allgemein war es für die Show nicht notwendig, da man auch mit gesundem Menschenverstand und den Informationen aus dem Museum sehr weit kam. Bevor alles allerdings richtig losging, warnte Franziska mich, ich solle mich gefälligst mit meinem Gelächter zurückhalten. Schon kurze Zeit nach Beginn der Show wurde deutlich, dass das gar nicht möglich gewesen wäre, weil diese Artisten sich selbst oder die Ninjas in keiner Weise ernst nahmen.
Es begann mit einem einfachen Shinobi, der sich traditionell verbeugte, verschiedene Handzeichen machte, sein Schwert in den Gürtel steckte und erst einmal zwei Tamashegiri fachmännisch zerteilte.

Bereits bei diesem Ereignis waren Franziska und ich enttäuscht. Nicht von der Vorstellung, nein, sie war sehr amüsant. Es waren die Zuschauer, die uns negativ auffielen. In Korea wäre dieser Mann mit einem Schwall erstaunter „Ohhs“ und „Ahhs“ belohnt worden. Aber die Japaner nickten nur und gafften weiter. Sogar der Applaus war verhalten. Obwohl ich doch eher überrascht sein sollte, dass ich überhaupt noch überrascht war. Immerhin hatten die Japaner die Vorführung im Ninja-Haus ebenso trocken hingenommen. Es erinnerte mich stark an eine Vorführung in Deutschland, bei der man auch bis zum Ende wartet, bis man seine Freude an der Vorstellung am Schluss durch Applaus kundtun durfte – und ich stockte. Noch so ein Punkt, in dem diese beiden Länder sich so gut verstanden. Mir war es zu steril.
Daraufhin folgte eine Demonstration von Kletterkünsten, indem ein junger Mann sein Schwert als Kletterhilfe benutzte. Er war wirklich gut. Natürlich hätte man für die Höhe keine Hilfe benötigt, aber es ging hier um eine Demonstration.

Ein Showkampf zwischen zwei Ninja entlockten den Japanern dann doch das eine oder andere Lachen, doch befürchte ich, dass wir dummen Ausländer doch den ganzen Laden mit unseren amüsierten und sehr lauten Zwischenrufen aufmischten. Spätestens jetzt wurde deutlich, dass die ganze Vorstellung allein der Unterhaltung diente – historische Richtigkeit stand definitiv nicht an erster Stelle, wobei ich nicht unterstellen möchte, dass sie hier einem einen Bären aufbanden.

Erst als ein großer Ninja zwei bis drei Shuriken auf einmal in eine Holzwand warf, hörte man erste anerkennende Ausdrücke des Erstaunens. Endlich kam auch Gelächter auf, als ein Ninja sich als Straßenkünstler verkleidete und mit seinen Kunststückchen anfing. Er schaffte es nicht nur einen Ball auf seinem Schirm zu balancieren und darüber rollen zu lassen, nein, er vollführte das gleiche Spielchen mit einer Münze. Es war wirklich beeindruckend. Koreaner wären spätestens an dieser Stelle vor Bewunderung von den Stühlen gefallen.

Als nächstes kam eine Dame auf die Bühne, die in einer geschmeidigen Bewegung ihre Querflöte in ein Blasrohr verwandelte. Sie ließ einen Ballon zerplatzen, erklärte einiges zu ihrem Instrument (natürlich in japanischer Sprache) und suchte sich jemanden aus dem Publikum, um an der Demonstration teilzunehmen. Mich.
Da stand ich nun, ich armer Tor, und wusste nicht, wie mir geschah. Vor allem wusste ich nicht so recht, was sie von mir wollten. Man erklärte langsam – sowohl an mich als auch ans Publikum gewandt –, dass ich nun ebenfalls versuchen sollte, einen Luftballon mit Hilfe des Blasrohrs zum Platzen zu bringen. Die Dame fragte mich, woher ich käme, also antwortete ich wahrheitsgemäß. Dann zeigte sie mir, was ich tun sollte. So nahm ich Aufstellung, befolgte die Anweisungen des Personals und pustete. Leider verfehlte mein Geschoss den Luftballon um ein gutes Stück – aber ich traf die Matte. Im nächsten Anlauf durfte ich näher dran. Dieses Mal traf ich den Ballon, allerdings prallte das Geschoss daran ab und landete auf dem Boden. Ich hätte mich vor Lachen beinahe weggeschmissen, riss mich dann aber lieber am Riemen. Es war eine urkomische Situation.
Als Geschenk erhielt ich einen Gutschein für das Werfen mit Wurfsternen, also Shuriken. Vorerst durfte ich mich allerdings auf meinen Platz setzen und den Rest der Show genießen.
Es folgte eine Darbietung mit Seil vs. Schwert. Der Ninja mit dem Seil gewann gegen sein Schwert schwingendes Pendant, was dank einer ausgefallenen Choreographie dramatisch und überzeugend wirkte.

Zu Schluss traten noch zwei Schwertkämpfer gegeneinander an. Auch hier waren die einstudierten Bewegungen sehr gut gemacht und hervorragend in Szene gesetzt. Allerdings bin ich davon überzeugt, dass der Verlierer so viele Hiebe, Stiche und Schnitte nicht überlebt hätte. Wenn er spätestens beim zweiten Streich noch immer Stand, verstand sein Gegner sein Handwerk nicht. Wie dem auch sei, der junge Mann starb lang, gekonnt und theatralisch. Es war eine Augenweide. Ich war begeistert und dankte Franziska mehrfach für diese grandiose Idee.
Natürlich löste ich meinen Gutschein ein. Beim „Schießstand“ gab es verschiedene „Klassen“. Da gab es einen Wurfstand für Kinder, der den Kleinen je nach Alter und / oder Größe eine andere Entfernung zum Ziel zumutete. Es war erstaunlich, wie wenige Berührungsängste die Japaner mit dieser Waffe hatten. Da wurden Knirpse von unter einem Meter und bestimmt weniger als acht Jahren an den Stand gelassen, als ob man Süßigkeiten verteilen würde. Gleichzeitig wuselten die Kleinen neben den Erwachsenen, während diese ihre Geschosse abwarfen. Niemand schien sich Sorgen um die Sicherheit zu machen.
Bei den Erwachsenen unterschied man zwischen Männern und Frauen. So stellte ich mich brav in die Damenreihe, die nur aus mir bestand, nickte bei den Instruktionen des Einweisers dumm, weil ich kein einziges Wort verstand, wog einen Stern nach dem anderen in der Hand und warf sie der Reihe nach auf die Zielscheibe. Zwar traf ich nie ins Schwarze, war mit 70 Punkten aber besser dabei als die meisten anderen.
Im Nachhinein erfuhr ich dann, dass man bei Erreichen einer gewissen Punktzahl ein Poster geschenkt bekommen hätte. Das kommt davon, wenn man die Sprache nicht spricht und kein Wort versteht. Trotzdem war es ein riesiger Spaß.
Damit erklärten wir den Tag für beendet und machten uns auf den Rückweg. Gerade zur richtigen Zeit, wie sich herausstellte, denn kaum saßen wir im Zug, setzte der Regen ein.

... link (0 Kommentare) ... comment
Sonntag, 14. Februar 2016
Osaka – August 2015
atimos, 09:30h
Wie bei allen temporären Aufenthalten musste auch unsere Zeit in Busan zu Ende gehen. Als es eines Tages dann so weit war, brachen wir zeitig auf, um unseren Flug auf die Nachbarinsel zu erwischen. Belle kam extra einige Minuten früher zur Arbeit, um sich gebührend von uns zu verabschieden. Tags zuvor hatte sie uns noch den Weg erklärt, damit wir auf jeden Fall sicher an unserem Ziel ankamen. Es war auch ganz einfach – wir mussten nur zweimal umsteigen. Dank T-Money-Karte und einer hervorragenden Beschilderung war aber auch das kein Problem.
Die letzte Bahn, die wir nehmen mussten, war eine vollautomatische Schienenbahn. Das heißt, es gab keinen Fahrer. Man konnte an beiden Enden des kurzen Zuges durch die weiten Fenster gucken. Dieser Streckenabschnitt war allerdings nicht lang genug, als dass wir es uns hätten gemütlich machen können.
Nach mehr als einer Stunde Gesamtfahrt waren wir am Flughafen von Busan angekommen und zogen aus ins nächste Abenteuer in einem anderen Land. Im Gegensatz zu dem Flughafen von Seoul war jener in dieser Stadt wesentlich übersichtlicher. Wir gingen hinein, gaben unser Gepäck ab, zeigten auch hier unser Ausreiseticket aus Japan vor (die Dame am Schalter war allerdings nett und erklärte uns von vornherein, was sie sehen wollte), erhielten unser Bordkarten und durften wieder tatenlos warten. So beschlossen wir einen Rundgang durch die doch kleine Halle. Es stellte sich heraus, dass sogar am Flughafen ein Seolbing war, also ein Bingsuladen, mit dem wir die besten Erinnerungen verbanden. Da wir noch einige Won in der Tasche hatten, beschlossen wir diese sinnvoll zu investieren: Es gab zwei Pappbecher mit Omija-Tee.

Natürlich war es ein bisschen teurer als beim letzten Mal, aber wir waren nun einmal an einem Flughafen. Außerdem fühlte ich mich nicht so ganz ausgenommen, weil dieser Tee immer teurer als seine schwarzen Pendants ist und der Preis hier genau gleich war – nur die Portion war kleiner. Ähnliches vermutete ich für das Bingsusortiment. Jedenfalls war es ein gebührender Abschied von diesem fremden und gleichzeitig doch so vertrauten Land.
Auf der oberen Etage entdeckten wir mehrere Restaurants, die verschiedene Speisen anboten. Im Gegensatz zu vielen anderen Flughäfen, die ich bereits gesehen hatte, sahen diese wesentlich gemütlicher und einladender aus. Ich vermute, es hing stark mit der Bedeutung von Essen für die koreanische Kultur ab.
Diese Mal flogen wir mit dem Luftfahrtunternehmen Peach – das seltsamerweise Pink zur Unternehmensfarbe gewählt hatte. Wie dem auch sei, der Flug war von kurzer Dauer, weniger als eine Stunde, weshalb wir uns fragten, was wir in der kurzen Zeit anfangen sollten. Es war der kürzeste Flug auf unserer gesamten Reise und schien irgendwie vernachlässigbar. Da es zudem eine Billigairline war, gab es weder Snacks noch Getränke geschweige denn heiße Handtücher. Allerdings bekamen wir die Plätze am Notausgang, weshalb wir uns zusätzlicher Beinfreiheit erfreuen durften.
Kaum gestartet, setzten wir schon wieder zum Landeanflug an. Dank eines Schwalls an Menschen aus mehreren Flugzeugen und einem ungewohnt hohen Grad an Gemütlichkeit der Sachbearbeiter dauerte die Einreise allerdings ziemlich lange. Die Zeit nutzten wir so gut wir konnten, um uns ein bisschen umzusehen. Piktogramme machten deutlich, dass man keine Fotos machen durfte; dennoch hielten viele Leute sich nicht daran. Von ungefähr zwanzig Schaltern waren nur vier besetzt. Ein Einweiser wies die Leute dem Schalter mit den wenigsten Leuten zu. Besonders auffällig waren allerdings die Wärmebildkameras inklusiver großer Warnungen vor MERS. Zwar war seit Wochen keine neue Ansteckung in Südkorea verzeichnet worden, aber die Japaner wollten wohl ganz sicher gehen, denn schließlich hatte es im Nachbarland eine Epidemie gegeben.
Nach mehr als einer Stunde hatten wir es endlich problemlos durch den Zoll geschafft, nur um dabei zuzusehen, wie ein Flughafenmitarbeiter gerade unsere Rucksäcke auf einen Gepäcktrolli beförderte, um sie wegzuschaffen. Ich lief auf ihn zu, blieb vor ihm stehen und klärte die Situation auf. So stürzten wir uns in ein neues Abenteuer in einem neuen Land.
Jetzt galt es zum Hostel zu gelangen. Der erste Schritt bestand darin, vom Ankunftsterminal zum Hauptgebäude zu kommen, was mit Shuttlebussen einfach zu bewerkstelligen war. Die Wegbeschreibung vom Flughafen hatten wir, mussten also nur noch den richtigen Zug finden. Es stellte sich allerdings heraus, dass eben dies die Herausforderung des Abends sein würde. Südkorea hatte uns in diesem Punkt stark verwöhnt. Fahrkarte kaufen, einsteigen, losfahren, umsteigen, Schildern folgen, ankommen. Es war so simpel. Nicht in Japan.
Erst einmal mussten wir zum richtigen Schalter, weil die Leute links nur Tickets für den einen Zug verkauften, während man rechts Fahrkarten für JR-Züge bekam. Damit nicht genug. Anstatt eines einfachen, leicht zu überblickenden Nummernsystems hatte jede Bahnlinie ihren eigenen – natürlich – japanischen Namen. Um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, ging die Linie, mit der wir fahren mussten, in eine andere über, so dass wir nicht umsteigen mussten, wenn wir vor 22 Uhr fuhren, aber nach 22 Uhr schon. Ich war verwirrt, bevor ich in den Zug einstieg. Als wir dann aber an dem richtigen Schalter für den richtigen Zug standen, trafen wir auf einen Mitarbeiter, der es in sich hatte – im äußerst positiven Sinn. Nicht nur, dass er sehr gut Englisch sprach, nein, er war auch noch fix. Wir erklärten ihm, was wir wollten, er plapperte drauf los, das ist diese Linie, sie müssen dieses Ticket kaufen, das macht so und so viel, zahlen Sie getrennt?, ja, gut, das macht so und so viel pro Person, vielen Dank, hier sind ihre Fahrkarten, gute Reise. Danach musste ich kurz durchatmen.
Als wir dann endlich unser Ticket und die richtige Schranke durchschritten hatten (es gab ja zwei separat operierende Bahnunternehmen mit unterschiedlichen Gleisen), standen wir immer noch vor der Frage, mit welchem Zug wir nun fahren sollten. Um keinen Fehler zu machen und irgendwo im Nirgendwo anzukommen, fragten wir den Schaffner des gerade eingefahrenen Zuges. Dieser war nicht unserer. Auf dem Gleis gegenüber stand bereits ein Zug und der freundliche Mitarbeiter verwies uns dorthin. Leider gab es keine Streckenverlaufspläne am Gleis, keine Hinweisschilder, die mir aufgefallen wären, keine Hilfe, mit der ich mich besser zurecht gefunden hätte. Meine Güte, es war einfach nur kompliziert. Plötzlich fühlte ich mich an die Heimat erinnert – und schauderte.
Ich erinnere mich nicht daran, dass ich bei meinem ersten Aufenthalt in Japan, Tokyo, derart aufgeschmissen gewesen wäre. Lag es an Osaka? Lag es an der Gruppe, mit der ich letztes Mal unterwegs gewesen bin? Oder hatte ich mich an die Einfachheit des koreanischen Systems gewöhnt? Wie dem auch sei, glücklicherweise kamen wir letzten Endes dort an, wo wir sein mussten.
Im Zug begegnete uns eine Gestalt, die ich unbedingt erwähnen muss. Es war ein gewöhnlicher Japaner, wage ich zu behaupten. Allerdings waren wir seit Monaten nur noch den Anblick von Koreanern gewohnt, weshalb uns dieses Exemplar an Asiate so fremd vorkam. Kurzum, er sah aus wie eine Fleisch gewordene Anime- oder Mangafigur. Die Haare standen ihm in stacheligen Strähnen vom Kopf ab; die Kleidung hing lose an ihm herunter; die Hose war viel zu weit; Kettchen zierten den Gürtel; zu allem Überfluss bestand der Junge nur aus Haut und Knochen. Wir nannten ihn „dünnes Hemdchen“, entschieden uns im Laufe der Zeit allerdings dafür, dass der Name zu lang war, weshalb wir uns auf die Bezeichnung „Masa“ (aufgrund von Zuskas Freund) einigten. Im Laufe der kommenden Tage liefen wir vielen Masas über den Weg.
Das Hostel, in dem wir für drei Nächte abstiegen, war klasse. Wir entschieden uns für das J-Hoppers Osaka Guesthouse, das recht zentral aber gleichzeitig ruhig gelegen, sauber war, freundliches Personal, Gemeinschaftsräume, kostenloses Internet, gemütliche Betten hatte. Zur Begrüßung bekamen wir sogar ein kleines Geschenk. Wir hatten die Wahl zwischen einem Postkartensatz und einem Beutel voll Snacks. In Anbetracht meines Appetits, meiner Neugier auf neues Essen sowie dem Wunsch, meine Postkarten gezielt auszusuchen, fiel mir die Wahl nicht schwer. Es gab Snacks.

Auch hier waren die Betten außerordentlich hart, allerdings waren sie anders als die koreanische Variante gestaltet. Es war einfach nur ein Futon auf Holzbrettern, während die Betten in Korea harten Matratzen ähnelten. Wie dem auch sei, ich schlief recht gut. Was mich ein bisschen störte, war die Tatsache, dass die Kissen immer niedriger wurden, je weiter wir von Seoul entfernt waren. Ich fand es allerdings äußerst lustig, dass die einzelnen Betten Bilder mit Bildern von Zeichentrickfiguren geschmückt waren. Mein Bett war mit Winnie Puh geziert.
Lustiger Weise war es keine Herausforderung, auch im J-Hoppers einige Koreaner ausfindig zu machen, die wir sofort schockierten, indem wir sie ansprachen. Es war ein amüsanter Anblick. Einige von ihnen versuchten sogar, uns zu antworten.
Am ersten Abend in Japan bestanden unsere einzigen Anliegen in Grundbedürfnissen: etwas Leckeres zu essen und schlafen. Nicht weit vom Hostel fand sich ein CoCo Curry und wir entschlossen uns kurzerhand, dass wir eine neue Tradition ins Leben rufen wollten. CoCo Curry in jedem Land probieren, in dem wir es antrafen. Als wir in dem Laden saßen, war ich von der Inneneinrichtung doch ein bisschen überrascht. Wir bekamen eine gut verständliche Karte, ja, die Kellner waren äußerst zufriedenstellend, (Masas), aber an die Idee eines Manga-Ladens in einem Restaurant konnte ich mich in dem Moment nicht gewöhnen.

Dennoch, das Essen war lecker, wie wir es erwartet hatten, und die Portion reichte hervorragend aus. Dies waren genug Abenteuer für einen Tag.
Bevor wir am nächsten Morgen in die Straßen der Stadt hinausströmten, um uns nach einem leckeren Frühstück umzusehen, legten wir uns erst einmal einen Plan zurecht. Dank Umgebungskarte inklusive Legende und Beschreibungen konnten wir uns auch als Ortsfremde ein wenig orientieren und verschiedene Frühstücksmöglichkeiten abwägen. Wir entschieden uns für ein traditionell japanisches Frühstück. Das war ein Fehler – meiner Ansicht nach jedenfalls. Es gab Reis, daneben Nori-Blätter, Miso-Suppe, Reisschleim, Omlette. Das meiste davon war kalt.

Franziska hatte eine ähnliche Konstellation, allerdings bekam sie noch geräucherten Fisch und ein rohes Ei. Vor die Wahl gestellt, würde ich es nicht noch einmal essen.
Bereits beim Einchecken hatten die Dame an der Rezeption uns mitgeteilt, dass wir an einem kurzen Ausflug durch die Region teilnehmen konnten. Ein älterer Herr namens Mr. Yano machte dies kostenlos – man musste nur für den Eintritt bei den Sehenswürdigkeiten und das Essen im Anschluss aufkommen. Da wir keine konkreten Pläne oder Ziele in Osaka hatten, beschlossen wir kurzerhand daran teilzunehmen, denn wir witterten eine einmalige Gelegenheit.
Um punkt 10 Uhr tauchte ein Mann mit grauem Haar in der Küche unseres Hostels auf. Er war offen, höflich, gut gelaunt und amüsant. Die Tour begann mit einem Gruppenfoto und der Frage, ob irgendjemand Japanisch sprach. Alle verneinten, woraufhin Mr. Yano mit Händen, Füßen und Gesten erklärte, dass er nur über rudimentäre Englischkenntnisse verfüge. Das sollte uns jetzt nicht davon abhalten eine gute Zeit zu verbringen, denn er machte wirklich das Beste draus.
Zu Beginn stapften wir durch die Straße, auf der unser Gasthaus stand. Vor dem einen oder anderen Geschäft blieb Mr. Yano stehen und erzählte eine lustige Anekdote oder empfahl einen Leckerbissen. Trotz der Sprachbarriere schaffte der alte Mann es gekonnt seine Botschaft zu vermitteln und sein Publikum zu unterhalten – das ist eine Kunst.
An der Haltestellte brachte Mr. Yano uns die ersten japanischen Worte bei.
Dieser Kontakt mit einem Einheimischen machte mir aber auch sehr deutlich, wie stark die koreanische Mentalität sich von der japanischen unterschied. Auch wenn ich ohne jegliche Sprachkenntnisse in beide Länder reiste (tatsächlich verstand ich mehr Worte auf Japanisch als auf Koreanisch, was mit einer langjährigen Faszination für Anime und Manga zusammenhing), schnappte ich das ein oder andere auf. Dies ist besonders dann einfach, wenn die Leute um einen herum sich zu Privatlehrern erklären. Während das erste Wort, das mir unsere koreanische Gastfamilie beibringen wollte „Hallo“ war, betonte Mr. Yano immer wieder, wie wichtig es war das japanische Wort für „Entschuldigung“ zu kennen. Japaner benutzen es unentwegt. Die Mitarbeiter an der Rezeption entschuldigten sich beim Gast, wenn dieser ihr Etablissement betrat, nur um ein Beispiel zu nennen. Nach zwei Monaten Koreaaufenthalt wusste ich immer noch nicht, was „Entschuldigung“ oder „tut mir leid“ hieß. Ich konnte fluchen, Männlein wie Weiblein in meiner Umgebung gleichermaßen beleidigen, aber nicht um Verzeihung bitten. Es war mir auch nicht aufgefallen, dass Koreaner sich viel entschuldigten – stattdessen bedankten sie sich oft. Ein wesentlicher kultureller Unterschied
Als nächstes fuhren wir ein bisschen mit der Bahn, bis wir eine wirklich sehr lange, überdachte Einkaufspassage erreichten. Mr. Yano erklärte uns, dass man eine Stunde zu Fuß brauchte, um sie von einem Ende zum anderen zu durchqueren.

Dort trafen wir auf ein interessantes japanisches Phänomen, das unser Reiseführer uns folgendermaßen erklärte: Japaner wollten anscheinend überall Geld sparen, so dass sie die besten Schnäppchen suchten, auch wenn es um Lebensmittel ging. Leider hatten sie ein ganz anderes Verständnis von preiswert als ich, denn für sie war das beste Angebot schon erreicht, wenn es 10-20 Yen (das entspricht 10-20 Cent) günstiger als der Höchstpreis war, selbst wenn die Qualität darunter stark litt. In meinen Augen kein sonderlich guter Tausch. Darüber hinaus nahmen Japaner es gerne auf sich, in einer Schlange zu stehen, weil dies für die Kochkünste des Restaurants sprach. Getreu dem Motto: „Wenn andere es mögen, wird es sehr lecker sein, also warte ich lieber auch hier.“

Eigentlich wollten wir das Osaka Museum of Housing and Living am Nachmittag aufsuchen, aber dann erfuhren wir, dass es schon im Programm inbegriffen war, was uns positiv überraschte. Mit 600 Yen war der Eintrittspreis durchschnittlich, doch bot sich einem auch ein durchdachtes Konzept mit einem schönen Schauspiel. Die Zeitreise in die Edo-Periode begann mit einem Blick aus der Vogelperspektive. Die Dächer dieses Stadtteils waren detailgetreu nachgebaut worden, inklusive Dachterrassen und Katzen.

Zwischen den verschiedenen Häusern schlängelten sich andere Besucher entlang, doch es dauerte nicht lange, bis wir uns dazu gesellten. In der Zwischenzeit versuchte Mr. Yano uns einige japanische Begriffe beizubringen, was zur allgemeinen Erheiterung beitrug. Es ging um alltägliche Gegenstände, die einen Bezug zu diesem Dorf hatten.
Unten angekommen war ich von dem Ambiente begeistert. Leute – vorwiegend Touristen – in Kimonos schlenderten durch die engen Gassen, während rechts und links auf alt getrimmte Gebäude den Flair längst vergangener Jahrhunderte wieder aufleben ließen. Einige Gebäude konnte man sogar betreten und sich in eine andere Ära versetzen lassen. In anderen Häusern fand man dekorative Schaufenster.

Es gab Spielzeug von früher, das unsere ganze Ausflugsgruppe in Aufregung und Staunen versetzte. Da gab es einen Stock mit zwei Tellern an der Seite und einer Spitze vorne dran. An seinem Ende war ein Ball an einer Schnur befestigt. Ziel war es, den Ball durch richtiges Drehen des Handgelenks entweder auf einen der beiden Teller zu hieven oder direkt auf der Spitze aufzuspießen. Wir hatten lange unseren Spaß damit. Dann gab es noch einige Holztäfelchen, die miteinander verbunden waren. Drehte man sie in eine Richtung, entstand ein Dominoeffekt und alle klapperten der Reihe nach um. Drehte man sie in die andere Richtung, geschah es wieder. Bei jedem Dreh änderte sich das Bild.
Darüber hinaus zeigte uns Mr. Yano einige Ausstellungsgegenstände näher, auch wenn ganz groß drauf stand, dass man es nicht anfassen durfte. Es schien den Japaner kein bisschen zu stören. Stattdessen schob er das Schild beiseite und zog sein Ding durch. Er erzählte uns, wie der Alltag eines Japaners früher wohl abgelaufen war und wozu die einzelnen Gegenstände benutzt worden waren. Es war sehr informativ.

Die Halle, in der das Museum stand, war auch klasse konzipiert. Man hatte alles abgedunkelt und abgeschirmt, so dass man sogar die Tageszeit und das Wetter „beeinflussen“ konnte. Plötzlich wurde es dunkel, Lichteffekte simulierten Blitze, während die Lautsprecher Regenplätschern spielten. Unsere Gruppe suchte sogar Unterschlupf, um nicht nass zu werden. Nach dem Gewitter wurde es Nacht und nur wenige Laternen erleuchteten die Wege. Es war sehr schön inszeniert. Dies war der Moment, den Mr. Yano nutzte, um uns in ein verlassenes Haus zu führen und seine Weisheiten mit uns zu teilen. Wir erfuhren einiges über Traditionen und Gepflogenheiten im alten Japan, hatten dabei aber immer viel Spaß. Es war ein gelungener Museumsbesuch.
Damit war der Ausflug als solcher allerdings noch nicht abgeschlossen. Nicht weit vom Museum war ein kleines Restaurant, das Mr. Yano uns noch unbedingt vorstellen wollte. Grundlegender Gedanke hierbei war es, uns die japanische Küche näher zu bringen, indem er uns frisch gemachtes Okonomiyaki serviert – besser noch: wir durften es zu einem großen Teil selbst machen. Die Plätze für uns waren schon reserviert, die Dame in der Küche wusste Bescheid, wir nahmen an zwei Tischen Platz und warteten gespannt. Vor uns war wenig Tisch, dafür aber viel heiße Platte, einige kleine Teller und große Pfannenwender.
Es begann damit, dass zwei große Klekse der Teigmasse auf diese heiße Platte gegossen wurden, gefolgt von jeweils einem breiten Streifen Speck. Nach einiger Zeit des Bratens war es an uns zu entscheiden, ob die Pfannkuchen so weit waren gewendet zu werden und es dann auch selbst zu machen. Es gab ein Gemetzel. Der erste Okonomiyaki überlebte die Prozedur nicht in einem Stück, der zweite schaffte es gerade so dank vereinter Kräfte. Als diese riesigen Leckerbissen auf beiden Seiten knusprig gebraten waren, folgten die Saucen. Zuerst die dunkle, bei der ich keine Ahnung habe, woraus sie bestand, dann die helle, die einfach nur Mayonnaise war. Darauf wurde ein bisschen Noripulver gestreut. Um dem Gebilde die Krone aufzusetzen, streut man normalerweise noch Fischflocken drüber, aber da Franziska und ich dieses Erfahrung bereits in Sydney hinter uns gebracht hatten, verzichteten wir dieses Mal dankend darauf. Die anderen beiden Mädels an unserem Tisch hatten nichts daran auszusetzen.

Dieses Okonomiyaki weckte gemischte Gefühle in mir. Einerseits war ich begeistert von der Idee, es größtenteils selbst zubereiten zu dürfen und mit der heißen Platte sowie Pfannenwendern zu spielen. Andererseits sah ich es als große Folter an, weil es die ganze Zeit vor mir war, ich es aber bis zum Schluss nicht essen durfte. Jedenfalls war es ein Gaumenschmaus, als es endlich fertig war.
Hierbei muss ich noch eine Kleinigkeit zu einem Mädel aus dieser illustren Runde erzählen. Sie war eine US-Amerikanerin aus New York, sehr freundlich, guter Gesprächspartner, schick gekleidet. Allerdings fiel mir etwas an ihrer Bluse auf, das mir den halben Vormittag zu denken gab. Ein großes A in einem Kreis war auf die rechte Seite ihres Kragens gestickt, während die linke Seite von dem Wort „Assemble“ geziert wurde. Zweifel nagten an mir. Sie saß mir gegenüber und ich starrte diese Symbole an. Letzten Endes hielt ich es nicht mehr aus und fragte sie gerade heraus, ob es ein Fan-Shirt der Avengers war. Daraufhin lächelte sie mich an und bejahte fröhlich, wobei sie hinzufügte, dass sie sich freue endlich jemanden gefunden zu haben, der es erkannte.
Mit diesem leckeren Mahl war der Ausflug abgeschlossen und wir durften frei unserer Wege ziehen. Mr. Yano bot sich aber noch an, uns durch verschlungene Gassen zurück zur Metrohaltestellte zu führen und weitere Geschichtchen über die Nachbarschaft sowie japanische Eigenarten zu erzählen. So ließ er uns beispielsweise wissen, dass einige Leute nachts volle Wasserflaschen auf die Straße stellten, um Katzen abzuschrecken.
Noch frisch von den Eindrücken eines anderen Landes geprägt entwickelten Franziska und ich ein neues Spiel, das wir überall, jederzeit spielen konnten, ohne jemandem auf den Schlips zu treten. Es heißt: „Finde die Koreaner.“ Wer auch immer die Behauptung aufgestellt hat, dass alle Asiaten gleich aussähen, ist blind durchs Leben gelaufen. Hier in Japan merkte man besonders deutlich, dass Koreaner sich ganz anders kleideten, stylten und gebaut waren als die Einwohner dieses Inselstaates. Und es war erschreckend, wie japanische die Japaner waren.
An dieser Stelle möchte ich erwähnen, dass wir beide zu diesem Zeitpunkt unter einem tiefen Kulturschock litten, weshalb ich mich für jegliche eventuellen und tatsächlichen Gemeinheiten gegenüber dem Lande der aufgehenden Sonne und seinen Bewohnern entschuldigen möchte. Es hat weniger mit Japan zu tun, als mit der Tatsache, dass wir gerade aus Korea kamen. Wenn man gerade aus Deutschland kommt und Japan zum ersten Mal betrachtet, fallen einem bestimmt all die Unterschiede auf. Es ist wesentlich sauberer, die Städte sind riesig, die Menschen sehen anders aus, kleiden sich anders, das Essen ist anders, und, und, und. Wenn man allerdings gerade aus Korea kommt, fallen einem eher die Gemeinsamkeiten zu Deutschland auf, weil Korea sich nicht nur deutlich von meinem Heimatland, sondern auch von Japan unterscheidet. Zumindest war es bei uns beiden so. Es war in gewisser Weise ein Eigenkulturschock. Ich möchte es hier erwähnen und später Bezug wiederholt darauf nehmen, indem ich an einigen Beispielen festmache, inwiefern Japaner und Deutsche sich ähneln.
Fußläufig von unserem Hostel gab es nicht wirklich nennenswerte Sehenswürdigkeiten, aber das hießt nicht, dass man sich nicht welche geschaffen hätte. Da gab es ein großes Gebäude, auf das man – gegen Gebühr – hochfahren durfte, um einen Blick auf Osaka von oben zu werfen. 800 Yen fanden wir dann für eine Fahrt mit dem Aufzug doch zu happig, wollten dieses Bauwerk jedoch einmal aus der Nähe betrachten. Es stellte sich heraus, dass es ein riesiger Glaspalast mit verspiegelter Außenfront war.

Kaum waren wir am Fuße dieser Konstruktion angekommen, präsentierte sich uns eine Überraschung deutscher Natur: Die Japaner in Osaka feierten hier gerade Octoberfest.
Ich war baff. Auf einem kleinen Platz direkt unterhalb dieses Gebäudes hatte man Pavillons, Holzbänke und –tische aufgestellt, es gab jede Menge Verkaufsstände, die deutsche Spezialitäten anboten und eine Bühne für Livemusik. Es dauerte einige Minuten, bis ich diesen Anblick verarbeitet hatte, doch selbst dann wich das Grinsen nicht so schnell von meinem Gesicht. Dieses Schauspiel war zu absurd! Da liefen Kellnerinnen in Dirndln rum; männliches Personal war an der Lederhose zu erkennen; und ein besonders ausgelassener Japaner hatte sogar einen Filzhut auf dem Kopf. So viel Keckheit hätte man diesen Asiaten gar nicht zugetraut!

Da saßen ganze Meuten dieser sonst so zurückhaltenden Inselbewohner in den Bierzelten, dicht an dicht auf langen Holzbänken und schunkelten, was das Zeug hielt. Jaha, sie schunkelten tatsächlich, hakten sogar die Arme ineinander. Sie freuten sich auch über die bekannten deutschen Biermarken wie Acrobräu oder Alprisbacher Klosterbräu. Bei solchen Gaumenfreuden zahlt man gerne 1200 Yen für eine Halbliterflasche (umgerechnet ca. 12EUR) zuzüglich Pfand für das Glas. Ein kostenloser Flyer diente nicht nur als Speise- und Getränkekarte, sondern erklärte zugleich einige Gepflogenheiten, die man kennen musste, wenn man sich den deutschen Traditionen anpassen wollte. Auf der Rückseite fand sich eine Anleitung zum Anstoßen neben einem Lied, das jeder mitsingen durfte.

Ein ordentliches Schunkeln bedeutet natürlich nichts, wenn das Ambiente dafür nicht stimmt. Um für eine passende Stimmung zu sorgen, hatten die Veranstalter eine … wie nenne ich das am besten… Musikgruppe eingeladen, die einen bayrischen Namen sowie oktoberfestliche Kleidung trug, gleichzeitig aber dem asiatischen Kulturraum zuzuordnen war. Als „Maria und Alpenbuam aus Tokyo“ dann auf der Bühne standen, sahen wir uns in der Pflicht, dieses Schauspiel anzusehen, um es nach deutschen Maßstäben bewerten zu können.

Die Musik, die uns hier präsentiert wurde, war definitiv mit den Lederhosen und Dirndln kompatibel. Insbesondere die Frontsängerin überraschte mit einer hervorragenden Aussprache – Bayrisch, versteht sich. Darüber hinaus war ihr Jodeln tadellos. Wie lange sie dafür bei einem deutschen Meister in Lehre gegangen war, vermag ich nicht zu erraten. Jedenfalls schaffte es die sechsköpfige Band die Stimmung zu heben, die Japaner von ihren Sitzen zu reißen und das Fest zu einer wahrhaft ausgelassenen Feier gedeihen zu lassen.
Nachdem sie das Publikum dazu aufgefordert hatten, sich vor der Bühne zu versammeln, um gemeinsam im Takt zu schunkeln, sprangen tatsächlich jede Menge Japaner auf, um dem Vorschlag nachzukommen. Andere wurden von den Kellnerinnen zur Mitarbeit überredet. Es bildete sich eine lange Kette ineinander gehakter Inselbewohner, die von links nach rechts und wieder zurück schunkelten. „Marie und Alpenbuam“ gingen aber so weit, dass sie dem Publikum sogar einige grundlegende Worte beibrachten, die im passenden Moment laut herausgeschrien werden mussten. Darunter fielen Begriffe wie „Prost“, „Die Krüge hoch“ und „Zicke-zacke, zicke-zacke, hoy, hoy, hoy“.
Wir betrachteten das ganze Spektakel mit einer tiefen Faszination, die zwischen Begeisterung und geisteskrankem Lachen hin und her schwankte. Bevor unsere Gemütsverfassung unumkehrbar in eine unerwünschte Richtung ausschlug, verließen wir den Ort des Geschehens wieder. Es war auf jeden Fall ein Erlebnis, das meinen Tag krönte.
In Osaka stand ein Schloss, dessen Besichtigung uns Touristen von Anfang an ans Herz gelegt wurde. Es trug den Namen „Osaka Castle Museum“. Das Prospekt war vielversprechend: acht Etagen, große Parklandschaft drum herum, historische Bauten, vollgepackt mit geschichtlichen Fakten und Figuren, Aussichtsplattform im obersten Stockwerk. Kaum hatten wir davon erfahren, war ein Tag verplant. Bei solch einem Angebot war nicht daran zu denken, nur einen Vor- oder Nachmittag darauf zu verwenden, nein, wir mussten früh anfangen, um auch alles mitnehmen zu können. Gesagt, getan!

Schon von Weitem erkannte man diesen Prachtbau. Auf der Kuppe eines Hügels prangerte das goldbesetzte Bauwerk; man konnte es nicht verfehlen. Umgeben war die ganze Anlage von zwei breiten Wassergräben, mächtig und protzig bildeten sie ein unüberwindliches Hindernis für Fußtruppen. Darüber hinaus versperrten riesige Tore unerwünschten Gästen den Zugang. Glücklicherweise hatte man befestigte Wege darüber hinweg gebaut, um Besucher trockenen Fußes zu ihrem Ziel gelangen zu lassen. Wir ließen das Ambiente auf uns wirken, kamen aber nicht drum herum, so den einen oder anderen Spaß auf dem Weg dorthin zu machen, weil wir am Ende unserer Reise so langsam gar nichts mehr ernst nehmen konnten. Während wir uns in Korea zurückgehalten hatten, brach nun der Schalk vollkommen aus.
Ich schweife ab.
Der Eintritt war mit 600 Yen erträglich, wenn auch im Vergleich zu Korea sehr teuer, aber wir erwarteten auch etwas dafür. Im Osaka Castle Museum ließ man sich nicht dazu herab, die Eintrittskarten von Menschen verkaufen zu lassen, nein, hier hatte man bereits Maschinen dafür eingesetzt. Glücklicherweise konnten diese Englisch. Eine einsame Dame saß allerdings an einem anderen Schalter, um dort die Karten abzureißen und uns eintreten zu lassen.
So stapften wir die ersten Stufen empor, die von einem sanften Nebel umhüllt waren, der aus Bestäubungsanlagen entlang der Treppe hervorquoll. Diese hatten den Zweck die hitzegeplagten Besucher zumindest vorübergehend von ihrem Leid zu erlösen und eine gewisse Linderung zu schaffen. Am Kopf der Treppe gab es zwei Schlangen: Die linke führte zum Fahrstuhl, die rechte war für jene gedacht, die sich den Aufstieg zu Fuß zutrauten. Wir waren in hervorragender Form und es war noch früh, also nahmen wir den langen Aufstieg in Angriff. Später fanden wir heraus, dass das Museum eine Besichtigung von oben nach unten empfahl – das war irgendwann im dritten Stockwerk. Ergo behielten wir die Tradition der Reise bei und handelten den Kuratorenwünschen zuwider.
Besonders lustig war, dass es bestimmte Treppen gab, die man entweder nur hinauf- oder hinuntergehen durfte. Viele Schilder und Pfeile wiesen energisch darauf hin, ob man sich auf dem richtigen Pfad befand. Es war schon fast eine Selbstverständlichkeit, dass die meisten Leute sich tatsächlich daran hielten und sogar umdrehten, wenn ihnen auffiel, dass sie die falsche Treppe zu besteigen versuchten. Diejenigen, die es nicht interessierte, kamen offensichtlich aus dem Westen.
Von innen war das Schloss grundlegend modernisiert worden, was dem ganzen Gebilde einen obskuren Anstrich verlieh. Allerdings verstanden die Japaner das mit der Klimaanlage nicht so gut wie die Koreaner, denn obwohl es welche gab und sie liefen, war es viel zu warm in dem Gebäude. Ob es daran lag, dass sie veraltet waren und den Besuchermassen sowie Außentemperaturen nicht mehr Herr wurden oder ob sie einfach eine höhere Temperatur erzeugen sollten, kann ich nicht beurteilen. Natürlich hatte das Schloss den Zweiten Weltkrieg nicht unbeschadet überstanden und war daher ein Nachbau, aber trotzdem fanden wir beide es enttäuschend, dass man nur die Fassade historisch belassen hatte, während das Innere alltäglich aussah. Da das Innere nicht sonderlich fotogen war und es zudem in weiten Teilen verboten war, Bilder der Ausstellung zu machen, werde ich zwischendurch einfach das Äußere zeigen.

Was die Ausstellung dieses Museums betraf, waren wir auch unzufrieden. Im Erdgeschoss konnte man sich in einem kleinen Kino einige Informationsvideos zur Bauweise, Restauration und Besonderheiten des Schlosses sowie der umgebenden Anlagen ansehen. In der Etage darüber fanden sich einige Informationen über das Schloss in historischem Kontext sowie die Meiji Periode. Allerdings waren es nur einfache Informationstafeln, die lieblos in der Gegend standen. Die zweite Etage ließ den Besucher einen Blick auf einige Schwerte, Rüstungen und bemalte Faltwände werfen. Ich fand die Darstellung aus dem Kontext gerissen und deplatziert. Das dritte Stockwerk bot die Lebensgeschichte von Hideyoshi Toyotomi in lustigen, kleinen Holographieaufnahmen. Leider hatten die Kuratoren dieses Teils eine ganz andere Vorstellung von Geschichte als wir beiden, denn das meiste, was dort berichtet wurde bezog sich auf Mythen und Legenden. Faktenwissen war nur spärlich gesät. Letzten Endes hatten wir, nachdem wir die ganze Reihe gesehen hatten, mehr Fragen als vorher. Ganz oben gab es für uns die Möglichkeit auf einen Balkon hinaus zu gehen und in alle vier Himmelsrichtungen Osakas zu blicken. Die Aussicht fand ich klasse. Wir drehten eine Runde, genossen die frische Luft und begannen den Abstieg.

Dennoch möchte ich dieses Museum nicht weiterempfehlen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt nicht. Ich fühlte mich nach Neuseeland zurückversetzt, als hätte ich gerade die Tore von Te Papa verlassen, nur dass ich dieses Mal dafür bezahlen musste.
Diesem kargen Aufbau entsprechend schnell waren wir mit der Besichtigung auch durch. Wir hatten den ganzen Vormittag für das Schloss eingeplant, standen nach zwei Stunden aber vor der Frage, was wir nun machen sollten. So entschlossen wir uns für einen Spaziergang durch das angrenzende Parkgelände gefolgt von einem Lunch.

Das Mittagessen stellte uns allerdings vor eine mittlerweile ganz vergessene Herausforderung: ein Lokal finden. Vom Angebot in Seoul und Busan verwöhnt, stellten wir in Osaka fest, dass es nur bestimmte Einkaufsstraßen oder vereinzelte, einsame Restaurants auf den Straßen gab. Cafés waren noch seltener zu sehen. Man musste sich schon auskennen, um zu wissen, in welche Straße man abbiegen musste, um etwas zu essen zu finden. Anfangs waren wir wirklich erstaunt darüber, bis uns einfiel, dass es in Deutschland genauso war. Es war das erste Mal seit Monaten, dass ich ganze Häuserzeilen sah, in denen Unten nur Wohnungen waren. Kein kleiner Laden, kein Café, kein Restaurant, nein, nur Wohnungen. In diesem Moment war es nicht nur befremdlich, sondern auch erschreckend. Wir brauchten mehr als eine halbe Stunde, um ein Restaurant zu finden. Damit meine ich kein Lokal in unserer Preisklasse, sondern überhaupt eins. In der näheren Umgebung der Palastanlagen waren nur Wohn-, Büro- und Industriegebäude, aber keinerlei Einkaufsmöglichkeiten. Gar keine. Wir fanden lediglich eine Tankstelle mit dazugehörigem Shop.
So etwas wiedersprach der grundlegenden Geisteshaltung eines Koreaners: Im näheren Umkreis jeder Sehenswürdigkeit, die wir besucht hatten, fand sich zumindest ein Essensstand. Das Korean Folk Village, das weit außerhalb Seouls lag, hatte zu diesem Zweck eine eigene Restaurantecke integriert, um den Kunden auf jeden Fall etwas zu Essen anbieten zu können.
Nun fühlte ich mich vollkommen unvorbereitet. Ich hatte kein Lunchpaket vorbereitet, hatte keinen Snack dabei, nicht einmal ein Stück Obst, keinen Müsliriegel, gar nichts.
Auf unserer endlos scheinenden Suche drangen wir anscheinend ins Büroviertel vor, denn um uns herum türmten sich mittlerweile die glasverkleideten Wolkenkratzer. Dort fanden wir einen Gebäudekomplex, in dessen Erdgeschoss einige Geschäfte zu finden waren, darunter auch Restaurants. Ohne weiter darüber nachzudenken, gingen wir hinein. Wir hatten Hunger. Ich war äußerst erstaunt darüber, dass man in japanischen Restaurants rauchen durfte. Das hatte ich seit Jahren nicht mehr gesehen. Es gab noch nicht einmal abgeschirmte Raucherbereiche, nein, die Leute rauchten einfach so nach dem Essen ihre Zigarette. Jedenfalls war es in diesem Lokal so.

Als wir dann endlich zum Essen kamen, bestellten wir uns leckeres Katsu Don, das auch sehr gut schmeckte. Dennoch gab es einige Kuriositäten, wie beispielsweise die Tatsache, dass es auch hier ein rohes Ei in Franziskas Mahl gab. Die Japaner essen wohl alles roh. Historisch mag das durchaus zu erklären sein, aber meinen Geschmack trifft es nicht zur Gänze.

Gefolgt wurde dieses Mahl von einem Nachtisch der besonders ungesunden Art. Wir kehrten in einen Mr. Doughnut ein, um einige Leckereien käuflich zu erwerben.

Doch damit war unser Tag noch nicht abgeschlossen. Immerhin mussten wir jetzt noch den Weg zurück ins Hostel finden. In unserer Unwissenheit wähnten wir uns guter Dinge, denn immerhin gab es den Eingang zu einer Metro-Haltestelle direkt neben dem Gebäude, in dem wir uns gerade befanden. Doch kaum waren wir unten angekommen und warfen einen Blick auf den Netzplan, als unsere Hoffnung schwand. Dies war die U-Bahn. Wir brauchten aber das JR-Netz, um zurück zu unserer Herberge zu gelangen. Wir irrten mehr oder weniger zielsicher durch die Straßen, denn auch wenn ich es schaffe, mich in der Lotte Mall zu verlaufen, so ist mein Orientierungssinn im freien hervorragend. So gingen wir zurück zur Haltestelle, an der wir angekommen waren, auch wenn es ein bisschen länger dauerte. Letzten Endes war es gut, dass wir den ganzen Tag für den Ausflug eingeplant hatten, da doch einige unerwartete Herausforderungen auf uns gewartet hatten.

Am zweiten Tag war unser Spiel „Finde die Koreaner“ bereits so langweilig, dass wir Chinesen mit in die Mischung nahmen. Koreaner und Japaner sind grundverschieden und man erkennt sie aus der Entfernung. Dies wurde besonders deutlich, als wir im achten Stockwerk des Palastes auf dem Balkon standen und unten in den Besuchermassen Koreaner herauspickten. Die Tücke mit den Chinesen war für uns, dass wir uns nicht sicher sein konnten, ob es nicht doch Taiwanesen waren, weil wir in keinem der beiden Länder längere Zeit zugebracht hatten. Für so etwas braucht man immer eine Feldstudie.
Langsam frage ich mich, woher das Gerücht aufkommt, Japaner wären modern und auf der Höhe der Zeit. Im Vergleich zu Korea hinkten sie ein Jahrzehnt hinterher. Die Mobiltelefone waren älter, kleiner, primitiver; die Kleidung war irgendwann in den 1970ern stehen geblieben; die Frisuren haben sich auch seit dem ersten Manga kaum verändert; WiFi gab es nur in den wenigsten Lokalen. Und so etwas fällt MIR auf.
Die letzte Bahn, die wir nehmen mussten, war eine vollautomatische Schienenbahn. Das heißt, es gab keinen Fahrer. Man konnte an beiden Enden des kurzen Zuges durch die weiten Fenster gucken. Dieser Streckenabschnitt war allerdings nicht lang genug, als dass wir es uns hätten gemütlich machen können.
Nach mehr als einer Stunde Gesamtfahrt waren wir am Flughafen von Busan angekommen und zogen aus ins nächste Abenteuer in einem anderen Land. Im Gegensatz zu dem Flughafen von Seoul war jener in dieser Stadt wesentlich übersichtlicher. Wir gingen hinein, gaben unser Gepäck ab, zeigten auch hier unser Ausreiseticket aus Japan vor (die Dame am Schalter war allerdings nett und erklärte uns von vornherein, was sie sehen wollte), erhielten unser Bordkarten und durften wieder tatenlos warten. So beschlossen wir einen Rundgang durch die doch kleine Halle. Es stellte sich heraus, dass sogar am Flughafen ein Seolbing war, also ein Bingsuladen, mit dem wir die besten Erinnerungen verbanden. Da wir noch einige Won in der Tasche hatten, beschlossen wir diese sinnvoll zu investieren: Es gab zwei Pappbecher mit Omija-Tee.

Natürlich war es ein bisschen teurer als beim letzten Mal, aber wir waren nun einmal an einem Flughafen. Außerdem fühlte ich mich nicht so ganz ausgenommen, weil dieser Tee immer teurer als seine schwarzen Pendants ist und der Preis hier genau gleich war – nur die Portion war kleiner. Ähnliches vermutete ich für das Bingsusortiment. Jedenfalls war es ein gebührender Abschied von diesem fremden und gleichzeitig doch so vertrauten Land.
Auf der oberen Etage entdeckten wir mehrere Restaurants, die verschiedene Speisen anboten. Im Gegensatz zu vielen anderen Flughäfen, die ich bereits gesehen hatte, sahen diese wesentlich gemütlicher und einladender aus. Ich vermute, es hing stark mit der Bedeutung von Essen für die koreanische Kultur ab.
Diese Mal flogen wir mit dem Luftfahrtunternehmen Peach – das seltsamerweise Pink zur Unternehmensfarbe gewählt hatte. Wie dem auch sei, der Flug war von kurzer Dauer, weniger als eine Stunde, weshalb wir uns fragten, was wir in der kurzen Zeit anfangen sollten. Es war der kürzeste Flug auf unserer gesamten Reise und schien irgendwie vernachlässigbar. Da es zudem eine Billigairline war, gab es weder Snacks noch Getränke geschweige denn heiße Handtücher. Allerdings bekamen wir die Plätze am Notausgang, weshalb wir uns zusätzlicher Beinfreiheit erfreuen durften.
Kaum gestartet, setzten wir schon wieder zum Landeanflug an. Dank eines Schwalls an Menschen aus mehreren Flugzeugen und einem ungewohnt hohen Grad an Gemütlichkeit der Sachbearbeiter dauerte die Einreise allerdings ziemlich lange. Die Zeit nutzten wir so gut wir konnten, um uns ein bisschen umzusehen. Piktogramme machten deutlich, dass man keine Fotos machen durfte; dennoch hielten viele Leute sich nicht daran. Von ungefähr zwanzig Schaltern waren nur vier besetzt. Ein Einweiser wies die Leute dem Schalter mit den wenigsten Leuten zu. Besonders auffällig waren allerdings die Wärmebildkameras inklusiver großer Warnungen vor MERS. Zwar war seit Wochen keine neue Ansteckung in Südkorea verzeichnet worden, aber die Japaner wollten wohl ganz sicher gehen, denn schließlich hatte es im Nachbarland eine Epidemie gegeben.
Nach mehr als einer Stunde hatten wir es endlich problemlos durch den Zoll geschafft, nur um dabei zuzusehen, wie ein Flughafenmitarbeiter gerade unsere Rucksäcke auf einen Gepäcktrolli beförderte, um sie wegzuschaffen. Ich lief auf ihn zu, blieb vor ihm stehen und klärte die Situation auf. So stürzten wir uns in ein neues Abenteuer in einem neuen Land.
Jetzt galt es zum Hostel zu gelangen. Der erste Schritt bestand darin, vom Ankunftsterminal zum Hauptgebäude zu kommen, was mit Shuttlebussen einfach zu bewerkstelligen war. Die Wegbeschreibung vom Flughafen hatten wir, mussten also nur noch den richtigen Zug finden. Es stellte sich allerdings heraus, dass eben dies die Herausforderung des Abends sein würde. Südkorea hatte uns in diesem Punkt stark verwöhnt. Fahrkarte kaufen, einsteigen, losfahren, umsteigen, Schildern folgen, ankommen. Es war so simpel. Nicht in Japan.
Erst einmal mussten wir zum richtigen Schalter, weil die Leute links nur Tickets für den einen Zug verkauften, während man rechts Fahrkarten für JR-Züge bekam. Damit nicht genug. Anstatt eines einfachen, leicht zu überblickenden Nummernsystems hatte jede Bahnlinie ihren eigenen – natürlich – japanischen Namen. Um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, ging die Linie, mit der wir fahren mussten, in eine andere über, so dass wir nicht umsteigen mussten, wenn wir vor 22 Uhr fuhren, aber nach 22 Uhr schon. Ich war verwirrt, bevor ich in den Zug einstieg. Als wir dann aber an dem richtigen Schalter für den richtigen Zug standen, trafen wir auf einen Mitarbeiter, der es in sich hatte – im äußerst positiven Sinn. Nicht nur, dass er sehr gut Englisch sprach, nein, er war auch noch fix. Wir erklärten ihm, was wir wollten, er plapperte drauf los, das ist diese Linie, sie müssen dieses Ticket kaufen, das macht so und so viel, zahlen Sie getrennt?, ja, gut, das macht so und so viel pro Person, vielen Dank, hier sind ihre Fahrkarten, gute Reise. Danach musste ich kurz durchatmen.
Als wir dann endlich unser Ticket und die richtige Schranke durchschritten hatten (es gab ja zwei separat operierende Bahnunternehmen mit unterschiedlichen Gleisen), standen wir immer noch vor der Frage, mit welchem Zug wir nun fahren sollten. Um keinen Fehler zu machen und irgendwo im Nirgendwo anzukommen, fragten wir den Schaffner des gerade eingefahrenen Zuges. Dieser war nicht unserer. Auf dem Gleis gegenüber stand bereits ein Zug und der freundliche Mitarbeiter verwies uns dorthin. Leider gab es keine Streckenverlaufspläne am Gleis, keine Hinweisschilder, die mir aufgefallen wären, keine Hilfe, mit der ich mich besser zurecht gefunden hätte. Meine Güte, es war einfach nur kompliziert. Plötzlich fühlte ich mich an die Heimat erinnert – und schauderte.
Ich erinnere mich nicht daran, dass ich bei meinem ersten Aufenthalt in Japan, Tokyo, derart aufgeschmissen gewesen wäre. Lag es an Osaka? Lag es an der Gruppe, mit der ich letztes Mal unterwegs gewesen bin? Oder hatte ich mich an die Einfachheit des koreanischen Systems gewöhnt? Wie dem auch sei, glücklicherweise kamen wir letzten Endes dort an, wo wir sein mussten.
Im Zug begegnete uns eine Gestalt, die ich unbedingt erwähnen muss. Es war ein gewöhnlicher Japaner, wage ich zu behaupten. Allerdings waren wir seit Monaten nur noch den Anblick von Koreanern gewohnt, weshalb uns dieses Exemplar an Asiate so fremd vorkam. Kurzum, er sah aus wie eine Fleisch gewordene Anime- oder Mangafigur. Die Haare standen ihm in stacheligen Strähnen vom Kopf ab; die Kleidung hing lose an ihm herunter; die Hose war viel zu weit; Kettchen zierten den Gürtel; zu allem Überfluss bestand der Junge nur aus Haut und Knochen. Wir nannten ihn „dünnes Hemdchen“, entschieden uns im Laufe der Zeit allerdings dafür, dass der Name zu lang war, weshalb wir uns auf die Bezeichnung „Masa“ (aufgrund von Zuskas Freund) einigten. Im Laufe der kommenden Tage liefen wir vielen Masas über den Weg.
Das Hostel, in dem wir für drei Nächte abstiegen, war klasse. Wir entschieden uns für das J-Hoppers Osaka Guesthouse, das recht zentral aber gleichzeitig ruhig gelegen, sauber war, freundliches Personal, Gemeinschaftsräume, kostenloses Internet, gemütliche Betten hatte. Zur Begrüßung bekamen wir sogar ein kleines Geschenk. Wir hatten die Wahl zwischen einem Postkartensatz und einem Beutel voll Snacks. In Anbetracht meines Appetits, meiner Neugier auf neues Essen sowie dem Wunsch, meine Postkarten gezielt auszusuchen, fiel mir die Wahl nicht schwer. Es gab Snacks.

Auch hier waren die Betten außerordentlich hart, allerdings waren sie anders als die koreanische Variante gestaltet. Es war einfach nur ein Futon auf Holzbrettern, während die Betten in Korea harten Matratzen ähnelten. Wie dem auch sei, ich schlief recht gut. Was mich ein bisschen störte, war die Tatsache, dass die Kissen immer niedriger wurden, je weiter wir von Seoul entfernt waren. Ich fand es allerdings äußerst lustig, dass die einzelnen Betten Bilder mit Bildern von Zeichentrickfiguren geschmückt waren. Mein Bett war mit Winnie Puh geziert.
Lustiger Weise war es keine Herausforderung, auch im J-Hoppers einige Koreaner ausfindig zu machen, die wir sofort schockierten, indem wir sie ansprachen. Es war ein amüsanter Anblick. Einige von ihnen versuchten sogar, uns zu antworten.
Am ersten Abend in Japan bestanden unsere einzigen Anliegen in Grundbedürfnissen: etwas Leckeres zu essen und schlafen. Nicht weit vom Hostel fand sich ein CoCo Curry und wir entschlossen uns kurzerhand, dass wir eine neue Tradition ins Leben rufen wollten. CoCo Curry in jedem Land probieren, in dem wir es antrafen. Als wir in dem Laden saßen, war ich von der Inneneinrichtung doch ein bisschen überrascht. Wir bekamen eine gut verständliche Karte, ja, die Kellner waren äußerst zufriedenstellend, (Masas), aber an die Idee eines Manga-Ladens in einem Restaurant konnte ich mich in dem Moment nicht gewöhnen.

Dennoch, das Essen war lecker, wie wir es erwartet hatten, und die Portion reichte hervorragend aus. Dies waren genug Abenteuer für einen Tag.
Bevor wir am nächsten Morgen in die Straßen der Stadt hinausströmten, um uns nach einem leckeren Frühstück umzusehen, legten wir uns erst einmal einen Plan zurecht. Dank Umgebungskarte inklusive Legende und Beschreibungen konnten wir uns auch als Ortsfremde ein wenig orientieren und verschiedene Frühstücksmöglichkeiten abwägen. Wir entschieden uns für ein traditionell japanisches Frühstück. Das war ein Fehler – meiner Ansicht nach jedenfalls. Es gab Reis, daneben Nori-Blätter, Miso-Suppe, Reisschleim, Omlette. Das meiste davon war kalt.

Franziska hatte eine ähnliche Konstellation, allerdings bekam sie noch geräucherten Fisch und ein rohes Ei. Vor die Wahl gestellt, würde ich es nicht noch einmal essen.
Bereits beim Einchecken hatten die Dame an der Rezeption uns mitgeteilt, dass wir an einem kurzen Ausflug durch die Region teilnehmen konnten. Ein älterer Herr namens Mr. Yano machte dies kostenlos – man musste nur für den Eintritt bei den Sehenswürdigkeiten und das Essen im Anschluss aufkommen. Da wir keine konkreten Pläne oder Ziele in Osaka hatten, beschlossen wir kurzerhand daran teilzunehmen, denn wir witterten eine einmalige Gelegenheit.
Um punkt 10 Uhr tauchte ein Mann mit grauem Haar in der Küche unseres Hostels auf. Er war offen, höflich, gut gelaunt und amüsant. Die Tour begann mit einem Gruppenfoto und der Frage, ob irgendjemand Japanisch sprach. Alle verneinten, woraufhin Mr. Yano mit Händen, Füßen und Gesten erklärte, dass er nur über rudimentäre Englischkenntnisse verfüge. Das sollte uns jetzt nicht davon abhalten eine gute Zeit zu verbringen, denn er machte wirklich das Beste draus.
Zu Beginn stapften wir durch die Straße, auf der unser Gasthaus stand. Vor dem einen oder anderen Geschäft blieb Mr. Yano stehen und erzählte eine lustige Anekdote oder empfahl einen Leckerbissen. Trotz der Sprachbarriere schaffte der alte Mann es gekonnt seine Botschaft zu vermitteln und sein Publikum zu unterhalten – das ist eine Kunst.
An der Haltestellte brachte Mr. Yano uns die ersten japanischen Worte bei.
Dieser Kontakt mit einem Einheimischen machte mir aber auch sehr deutlich, wie stark die koreanische Mentalität sich von der japanischen unterschied. Auch wenn ich ohne jegliche Sprachkenntnisse in beide Länder reiste (tatsächlich verstand ich mehr Worte auf Japanisch als auf Koreanisch, was mit einer langjährigen Faszination für Anime und Manga zusammenhing), schnappte ich das ein oder andere auf. Dies ist besonders dann einfach, wenn die Leute um einen herum sich zu Privatlehrern erklären. Während das erste Wort, das mir unsere koreanische Gastfamilie beibringen wollte „Hallo“ war, betonte Mr. Yano immer wieder, wie wichtig es war das japanische Wort für „Entschuldigung“ zu kennen. Japaner benutzen es unentwegt. Die Mitarbeiter an der Rezeption entschuldigten sich beim Gast, wenn dieser ihr Etablissement betrat, nur um ein Beispiel zu nennen. Nach zwei Monaten Koreaaufenthalt wusste ich immer noch nicht, was „Entschuldigung“ oder „tut mir leid“ hieß. Ich konnte fluchen, Männlein wie Weiblein in meiner Umgebung gleichermaßen beleidigen, aber nicht um Verzeihung bitten. Es war mir auch nicht aufgefallen, dass Koreaner sich viel entschuldigten – stattdessen bedankten sie sich oft. Ein wesentlicher kultureller Unterschied
Als nächstes fuhren wir ein bisschen mit der Bahn, bis wir eine wirklich sehr lange, überdachte Einkaufspassage erreichten. Mr. Yano erklärte uns, dass man eine Stunde zu Fuß brauchte, um sie von einem Ende zum anderen zu durchqueren.

Dort trafen wir auf ein interessantes japanisches Phänomen, das unser Reiseführer uns folgendermaßen erklärte: Japaner wollten anscheinend überall Geld sparen, so dass sie die besten Schnäppchen suchten, auch wenn es um Lebensmittel ging. Leider hatten sie ein ganz anderes Verständnis von preiswert als ich, denn für sie war das beste Angebot schon erreicht, wenn es 10-20 Yen (das entspricht 10-20 Cent) günstiger als der Höchstpreis war, selbst wenn die Qualität darunter stark litt. In meinen Augen kein sonderlich guter Tausch. Darüber hinaus nahmen Japaner es gerne auf sich, in einer Schlange zu stehen, weil dies für die Kochkünste des Restaurants sprach. Getreu dem Motto: „Wenn andere es mögen, wird es sehr lecker sein, also warte ich lieber auch hier.“

Eigentlich wollten wir das Osaka Museum of Housing and Living am Nachmittag aufsuchen, aber dann erfuhren wir, dass es schon im Programm inbegriffen war, was uns positiv überraschte. Mit 600 Yen war der Eintrittspreis durchschnittlich, doch bot sich einem auch ein durchdachtes Konzept mit einem schönen Schauspiel. Die Zeitreise in die Edo-Periode begann mit einem Blick aus der Vogelperspektive. Die Dächer dieses Stadtteils waren detailgetreu nachgebaut worden, inklusive Dachterrassen und Katzen.

Zwischen den verschiedenen Häusern schlängelten sich andere Besucher entlang, doch es dauerte nicht lange, bis wir uns dazu gesellten. In der Zwischenzeit versuchte Mr. Yano uns einige japanische Begriffe beizubringen, was zur allgemeinen Erheiterung beitrug. Es ging um alltägliche Gegenstände, die einen Bezug zu diesem Dorf hatten.
Unten angekommen war ich von dem Ambiente begeistert. Leute – vorwiegend Touristen – in Kimonos schlenderten durch die engen Gassen, während rechts und links auf alt getrimmte Gebäude den Flair längst vergangener Jahrhunderte wieder aufleben ließen. Einige Gebäude konnte man sogar betreten und sich in eine andere Ära versetzen lassen. In anderen Häusern fand man dekorative Schaufenster.

Es gab Spielzeug von früher, das unsere ganze Ausflugsgruppe in Aufregung und Staunen versetzte. Da gab es einen Stock mit zwei Tellern an der Seite und einer Spitze vorne dran. An seinem Ende war ein Ball an einer Schnur befestigt. Ziel war es, den Ball durch richtiges Drehen des Handgelenks entweder auf einen der beiden Teller zu hieven oder direkt auf der Spitze aufzuspießen. Wir hatten lange unseren Spaß damit. Dann gab es noch einige Holztäfelchen, die miteinander verbunden waren. Drehte man sie in eine Richtung, entstand ein Dominoeffekt und alle klapperten der Reihe nach um. Drehte man sie in die andere Richtung, geschah es wieder. Bei jedem Dreh änderte sich das Bild.
Darüber hinaus zeigte uns Mr. Yano einige Ausstellungsgegenstände näher, auch wenn ganz groß drauf stand, dass man es nicht anfassen durfte. Es schien den Japaner kein bisschen zu stören. Stattdessen schob er das Schild beiseite und zog sein Ding durch. Er erzählte uns, wie der Alltag eines Japaners früher wohl abgelaufen war und wozu die einzelnen Gegenstände benutzt worden waren. Es war sehr informativ.

Die Halle, in der das Museum stand, war auch klasse konzipiert. Man hatte alles abgedunkelt und abgeschirmt, so dass man sogar die Tageszeit und das Wetter „beeinflussen“ konnte. Plötzlich wurde es dunkel, Lichteffekte simulierten Blitze, während die Lautsprecher Regenplätschern spielten. Unsere Gruppe suchte sogar Unterschlupf, um nicht nass zu werden. Nach dem Gewitter wurde es Nacht und nur wenige Laternen erleuchteten die Wege. Es war sehr schön inszeniert. Dies war der Moment, den Mr. Yano nutzte, um uns in ein verlassenes Haus zu führen und seine Weisheiten mit uns zu teilen. Wir erfuhren einiges über Traditionen und Gepflogenheiten im alten Japan, hatten dabei aber immer viel Spaß. Es war ein gelungener Museumsbesuch.
Damit war der Ausflug als solcher allerdings noch nicht abgeschlossen. Nicht weit vom Museum war ein kleines Restaurant, das Mr. Yano uns noch unbedingt vorstellen wollte. Grundlegender Gedanke hierbei war es, uns die japanische Küche näher zu bringen, indem er uns frisch gemachtes Okonomiyaki serviert – besser noch: wir durften es zu einem großen Teil selbst machen. Die Plätze für uns waren schon reserviert, die Dame in der Küche wusste Bescheid, wir nahmen an zwei Tischen Platz und warteten gespannt. Vor uns war wenig Tisch, dafür aber viel heiße Platte, einige kleine Teller und große Pfannenwender.
Es begann damit, dass zwei große Klekse der Teigmasse auf diese heiße Platte gegossen wurden, gefolgt von jeweils einem breiten Streifen Speck. Nach einiger Zeit des Bratens war es an uns zu entscheiden, ob die Pfannkuchen so weit waren gewendet zu werden und es dann auch selbst zu machen. Es gab ein Gemetzel. Der erste Okonomiyaki überlebte die Prozedur nicht in einem Stück, der zweite schaffte es gerade so dank vereinter Kräfte. Als diese riesigen Leckerbissen auf beiden Seiten knusprig gebraten waren, folgten die Saucen. Zuerst die dunkle, bei der ich keine Ahnung habe, woraus sie bestand, dann die helle, die einfach nur Mayonnaise war. Darauf wurde ein bisschen Noripulver gestreut. Um dem Gebilde die Krone aufzusetzen, streut man normalerweise noch Fischflocken drüber, aber da Franziska und ich dieses Erfahrung bereits in Sydney hinter uns gebracht hatten, verzichteten wir dieses Mal dankend darauf. Die anderen beiden Mädels an unserem Tisch hatten nichts daran auszusetzen.

Dieses Okonomiyaki weckte gemischte Gefühle in mir. Einerseits war ich begeistert von der Idee, es größtenteils selbst zubereiten zu dürfen und mit der heißen Platte sowie Pfannenwendern zu spielen. Andererseits sah ich es als große Folter an, weil es die ganze Zeit vor mir war, ich es aber bis zum Schluss nicht essen durfte. Jedenfalls war es ein Gaumenschmaus, als es endlich fertig war.
Hierbei muss ich noch eine Kleinigkeit zu einem Mädel aus dieser illustren Runde erzählen. Sie war eine US-Amerikanerin aus New York, sehr freundlich, guter Gesprächspartner, schick gekleidet. Allerdings fiel mir etwas an ihrer Bluse auf, das mir den halben Vormittag zu denken gab. Ein großes A in einem Kreis war auf die rechte Seite ihres Kragens gestickt, während die linke Seite von dem Wort „Assemble“ geziert wurde. Zweifel nagten an mir. Sie saß mir gegenüber und ich starrte diese Symbole an. Letzten Endes hielt ich es nicht mehr aus und fragte sie gerade heraus, ob es ein Fan-Shirt der Avengers war. Daraufhin lächelte sie mich an und bejahte fröhlich, wobei sie hinzufügte, dass sie sich freue endlich jemanden gefunden zu haben, der es erkannte.
Mit diesem leckeren Mahl war der Ausflug abgeschlossen und wir durften frei unserer Wege ziehen. Mr. Yano bot sich aber noch an, uns durch verschlungene Gassen zurück zur Metrohaltestellte zu führen und weitere Geschichtchen über die Nachbarschaft sowie japanische Eigenarten zu erzählen. So ließ er uns beispielsweise wissen, dass einige Leute nachts volle Wasserflaschen auf die Straße stellten, um Katzen abzuschrecken.
Noch frisch von den Eindrücken eines anderen Landes geprägt entwickelten Franziska und ich ein neues Spiel, das wir überall, jederzeit spielen konnten, ohne jemandem auf den Schlips zu treten. Es heißt: „Finde die Koreaner.“ Wer auch immer die Behauptung aufgestellt hat, dass alle Asiaten gleich aussähen, ist blind durchs Leben gelaufen. Hier in Japan merkte man besonders deutlich, dass Koreaner sich ganz anders kleideten, stylten und gebaut waren als die Einwohner dieses Inselstaates. Und es war erschreckend, wie japanische die Japaner waren.
An dieser Stelle möchte ich erwähnen, dass wir beide zu diesem Zeitpunkt unter einem tiefen Kulturschock litten, weshalb ich mich für jegliche eventuellen und tatsächlichen Gemeinheiten gegenüber dem Lande der aufgehenden Sonne und seinen Bewohnern entschuldigen möchte. Es hat weniger mit Japan zu tun, als mit der Tatsache, dass wir gerade aus Korea kamen. Wenn man gerade aus Deutschland kommt und Japan zum ersten Mal betrachtet, fallen einem bestimmt all die Unterschiede auf. Es ist wesentlich sauberer, die Städte sind riesig, die Menschen sehen anders aus, kleiden sich anders, das Essen ist anders, und, und, und. Wenn man allerdings gerade aus Korea kommt, fallen einem eher die Gemeinsamkeiten zu Deutschland auf, weil Korea sich nicht nur deutlich von meinem Heimatland, sondern auch von Japan unterscheidet. Zumindest war es bei uns beiden so. Es war in gewisser Weise ein Eigenkulturschock. Ich möchte es hier erwähnen und später Bezug wiederholt darauf nehmen, indem ich an einigen Beispielen festmache, inwiefern Japaner und Deutsche sich ähneln.
Fußläufig von unserem Hostel gab es nicht wirklich nennenswerte Sehenswürdigkeiten, aber das hießt nicht, dass man sich nicht welche geschaffen hätte. Da gab es ein großes Gebäude, auf das man – gegen Gebühr – hochfahren durfte, um einen Blick auf Osaka von oben zu werfen. 800 Yen fanden wir dann für eine Fahrt mit dem Aufzug doch zu happig, wollten dieses Bauwerk jedoch einmal aus der Nähe betrachten. Es stellte sich heraus, dass es ein riesiger Glaspalast mit verspiegelter Außenfront war.

Kaum waren wir am Fuße dieser Konstruktion angekommen, präsentierte sich uns eine Überraschung deutscher Natur: Die Japaner in Osaka feierten hier gerade Octoberfest.
Ich war baff. Auf einem kleinen Platz direkt unterhalb dieses Gebäudes hatte man Pavillons, Holzbänke und –tische aufgestellt, es gab jede Menge Verkaufsstände, die deutsche Spezialitäten anboten und eine Bühne für Livemusik. Es dauerte einige Minuten, bis ich diesen Anblick verarbeitet hatte, doch selbst dann wich das Grinsen nicht so schnell von meinem Gesicht. Dieses Schauspiel war zu absurd! Da liefen Kellnerinnen in Dirndln rum; männliches Personal war an der Lederhose zu erkennen; und ein besonders ausgelassener Japaner hatte sogar einen Filzhut auf dem Kopf. So viel Keckheit hätte man diesen Asiaten gar nicht zugetraut!

Da saßen ganze Meuten dieser sonst so zurückhaltenden Inselbewohner in den Bierzelten, dicht an dicht auf langen Holzbänken und schunkelten, was das Zeug hielt. Jaha, sie schunkelten tatsächlich, hakten sogar die Arme ineinander. Sie freuten sich auch über die bekannten deutschen Biermarken wie Acrobräu oder Alprisbacher Klosterbräu. Bei solchen Gaumenfreuden zahlt man gerne 1200 Yen für eine Halbliterflasche (umgerechnet ca. 12EUR) zuzüglich Pfand für das Glas. Ein kostenloser Flyer diente nicht nur als Speise- und Getränkekarte, sondern erklärte zugleich einige Gepflogenheiten, die man kennen musste, wenn man sich den deutschen Traditionen anpassen wollte. Auf der Rückseite fand sich eine Anleitung zum Anstoßen neben einem Lied, das jeder mitsingen durfte.

Ein ordentliches Schunkeln bedeutet natürlich nichts, wenn das Ambiente dafür nicht stimmt. Um für eine passende Stimmung zu sorgen, hatten die Veranstalter eine … wie nenne ich das am besten… Musikgruppe eingeladen, die einen bayrischen Namen sowie oktoberfestliche Kleidung trug, gleichzeitig aber dem asiatischen Kulturraum zuzuordnen war. Als „Maria und Alpenbuam aus Tokyo“ dann auf der Bühne standen, sahen wir uns in der Pflicht, dieses Schauspiel anzusehen, um es nach deutschen Maßstäben bewerten zu können.

Die Musik, die uns hier präsentiert wurde, war definitiv mit den Lederhosen und Dirndln kompatibel. Insbesondere die Frontsängerin überraschte mit einer hervorragenden Aussprache – Bayrisch, versteht sich. Darüber hinaus war ihr Jodeln tadellos. Wie lange sie dafür bei einem deutschen Meister in Lehre gegangen war, vermag ich nicht zu erraten. Jedenfalls schaffte es die sechsköpfige Band die Stimmung zu heben, die Japaner von ihren Sitzen zu reißen und das Fest zu einer wahrhaft ausgelassenen Feier gedeihen zu lassen.
Nachdem sie das Publikum dazu aufgefordert hatten, sich vor der Bühne zu versammeln, um gemeinsam im Takt zu schunkeln, sprangen tatsächlich jede Menge Japaner auf, um dem Vorschlag nachzukommen. Andere wurden von den Kellnerinnen zur Mitarbeit überredet. Es bildete sich eine lange Kette ineinander gehakter Inselbewohner, die von links nach rechts und wieder zurück schunkelten. „Marie und Alpenbuam“ gingen aber so weit, dass sie dem Publikum sogar einige grundlegende Worte beibrachten, die im passenden Moment laut herausgeschrien werden mussten. Darunter fielen Begriffe wie „Prost“, „Die Krüge hoch“ und „Zicke-zacke, zicke-zacke, hoy, hoy, hoy“.
Wir betrachteten das ganze Spektakel mit einer tiefen Faszination, die zwischen Begeisterung und geisteskrankem Lachen hin und her schwankte. Bevor unsere Gemütsverfassung unumkehrbar in eine unerwünschte Richtung ausschlug, verließen wir den Ort des Geschehens wieder. Es war auf jeden Fall ein Erlebnis, das meinen Tag krönte.
In Osaka stand ein Schloss, dessen Besichtigung uns Touristen von Anfang an ans Herz gelegt wurde. Es trug den Namen „Osaka Castle Museum“. Das Prospekt war vielversprechend: acht Etagen, große Parklandschaft drum herum, historische Bauten, vollgepackt mit geschichtlichen Fakten und Figuren, Aussichtsplattform im obersten Stockwerk. Kaum hatten wir davon erfahren, war ein Tag verplant. Bei solch einem Angebot war nicht daran zu denken, nur einen Vor- oder Nachmittag darauf zu verwenden, nein, wir mussten früh anfangen, um auch alles mitnehmen zu können. Gesagt, getan!

Schon von Weitem erkannte man diesen Prachtbau. Auf der Kuppe eines Hügels prangerte das goldbesetzte Bauwerk; man konnte es nicht verfehlen. Umgeben war die ganze Anlage von zwei breiten Wassergräben, mächtig und protzig bildeten sie ein unüberwindliches Hindernis für Fußtruppen. Darüber hinaus versperrten riesige Tore unerwünschten Gästen den Zugang. Glücklicherweise hatte man befestigte Wege darüber hinweg gebaut, um Besucher trockenen Fußes zu ihrem Ziel gelangen zu lassen. Wir ließen das Ambiente auf uns wirken, kamen aber nicht drum herum, so den einen oder anderen Spaß auf dem Weg dorthin zu machen, weil wir am Ende unserer Reise so langsam gar nichts mehr ernst nehmen konnten. Während wir uns in Korea zurückgehalten hatten, brach nun der Schalk vollkommen aus.
Ich schweife ab.
Der Eintritt war mit 600 Yen erträglich, wenn auch im Vergleich zu Korea sehr teuer, aber wir erwarteten auch etwas dafür. Im Osaka Castle Museum ließ man sich nicht dazu herab, die Eintrittskarten von Menschen verkaufen zu lassen, nein, hier hatte man bereits Maschinen dafür eingesetzt. Glücklicherweise konnten diese Englisch. Eine einsame Dame saß allerdings an einem anderen Schalter, um dort die Karten abzureißen und uns eintreten zu lassen.
So stapften wir die ersten Stufen empor, die von einem sanften Nebel umhüllt waren, der aus Bestäubungsanlagen entlang der Treppe hervorquoll. Diese hatten den Zweck die hitzegeplagten Besucher zumindest vorübergehend von ihrem Leid zu erlösen und eine gewisse Linderung zu schaffen. Am Kopf der Treppe gab es zwei Schlangen: Die linke führte zum Fahrstuhl, die rechte war für jene gedacht, die sich den Aufstieg zu Fuß zutrauten. Wir waren in hervorragender Form und es war noch früh, also nahmen wir den langen Aufstieg in Angriff. Später fanden wir heraus, dass das Museum eine Besichtigung von oben nach unten empfahl – das war irgendwann im dritten Stockwerk. Ergo behielten wir die Tradition der Reise bei und handelten den Kuratorenwünschen zuwider.
Besonders lustig war, dass es bestimmte Treppen gab, die man entweder nur hinauf- oder hinuntergehen durfte. Viele Schilder und Pfeile wiesen energisch darauf hin, ob man sich auf dem richtigen Pfad befand. Es war schon fast eine Selbstverständlichkeit, dass die meisten Leute sich tatsächlich daran hielten und sogar umdrehten, wenn ihnen auffiel, dass sie die falsche Treppe zu besteigen versuchten. Diejenigen, die es nicht interessierte, kamen offensichtlich aus dem Westen.
Von innen war das Schloss grundlegend modernisiert worden, was dem ganzen Gebilde einen obskuren Anstrich verlieh. Allerdings verstanden die Japaner das mit der Klimaanlage nicht so gut wie die Koreaner, denn obwohl es welche gab und sie liefen, war es viel zu warm in dem Gebäude. Ob es daran lag, dass sie veraltet waren und den Besuchermassen sowie Außentemperaturen nicht mehr Herr wurden oder ob sie einfach eine höhere Temperatur erzeugen sollten, kann ich nicht beurteilen. Natürlich hatte das Schloss den Zweiten Weltkrieg nicht unbeschadet überstanden und war daher ein Nachbau, aber trotzdem fanden wir beide es enttäuschend, dass man nur die Fassade historisch belassen hatte, während das Innere alltäglich aussah. Da das Innere nicht sonderlich fotogen war und es zudem in weiten Teilen verboten war, Bilder der Ausstellung zu machen, werde ich zwischendurch einfach das Äußere zeigen.

Was die Ausstellung dieses Museums betraf, waren wir auch unzufrieden. Im Erdgeschoss konnte man sich in einem kleinen Kino einige Informationsvideos zur Bauweise, Restauration und Besonderheiten des Schlosses sowie der umgebenden Anlagen ansehen. In der Etage darüber fanden sich einige Informationen über das Schloss in historischem Kontext sowie die Meiji Periode. Allerdings waren es nur einfache Informationstafeln, die lieblos in der Gegend standen. Die zweite Etage ließ den Besucher einen Blick auf einige Schwerte, Rüstungen und bemalte Faltwände werfen. Ich fand die Darstellung aus dem Kontext gerissen und deplatziert. Das dritte Stockwerk bot die Lebensgeschichte von Hideyoshi Toyotomi in lustigen, kleinen Holographieaufnahmen. Leider hatten die Kuratoren dieses Teils eine ganz andere Vorstellung von Geschichte als wir beiden, denn das meiste, was dort berichtet wurde bezog sich auf Mythen und Legenden. Faktenwissen war nur spärlich gesät. Letzten Endes hatten wir, nachdem wir die ganze Reihe gesehen hatten, mehr Fragen als vorher. Ganz oben gab es für uns die Möglichkeit auf einen Balkon hinaus zu gehen und in alle vier Himmelsrichtungen Osakas zu blicken. Die Aussicht fand ich klasse. Wir drehten eine Runde, genossen die frische Luft und begannen den Abstieg.

Dennoch möchte ich dieses Museum nicht weiterempfehlen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt nicht. Ich fühlte mich nach Neuseeland zurückversetzt, als hätte ich gerade die Tore von Te Papa verlassen, nur dass ich dieses Mal dafür bezahlen musste.
Diesem kargen Aufbau entsprechend schnell waren wir mit der Besichtigung auch durch. Wir hatten den ganzen Vormittag für das Schloss eingeplant, standen nach zwei Stunden aber vor der Frage, was wir nun machen sollten. So entschlossen wir uns für einen Spaziergang durch das angrenzende Parkgelände gefolgt von einem Lunch.

Das Mittagessen stellte uns allerdings vor eine mittlerweile ganz vergessene Herausforderung: ein Lokal finden. Vom Angebot in Seoul und Busan verwöhnt, stellten wir in Osaka fest, dass es nur bestimmte Einkaufsstraßen oder vereinzelte, einsame Restaurants auf den Straßen gab. Cafés waren noch seltener zu sehen. Man musste sich schon auskennen, um zu wissen, in welche Straße man abbiegen musste, um etwas zu essen zu finden. Anfangs waren wir wirklich erstaunt darüber, bis uns einfiel, dass es in Deutschland genauso war. Es war das erste Mal seit Monaten, dass ich ganze Häuserzeilen sah, in denen Unten nur Wohnungen waren. Kein kleiner Laden, kein Café, kein Restaurant, nein, nur Wohnungen. In diesem Moment war es nicht nur befremdlich, sondern auch erschreckend. Wir brauchten mehr als eine halbe Stunde, um ein Restaurant zu finden. Damit meine ich kein Lokal in unserer Preisklasse, sondern überhaupt eins. In der näheren Umgebung der Palastanlagen waren nur Wohn-, Büro- und Industriegebäude, aber keinerlei Einkaufsmöglichkeiten. Gar keine. Wir fanden lediglich eine Tankstelle mit dazugehörigem Shop.
So etwas wiedersprach der grundlegenden Geisteshaltung eines Koreaners: Im näheren Umkreis jeder Sehenswürdigkeit, die wir besucht hatten, fand sich zumindest ein Essensstand. Das Korean Folk Village, das weit außerhalb Seouls lag, hatte zu diesem Zweck eine eigene Restaurantecke integriert, um den Kunden auf jeden Fall etwas zu Essen anbieten zu können.
Nun fühlte ich mich vollkommen unvorbereitet. Ich hatte kein Lunchpaket vorbereitet, hatte keinen Snack dabei, nicht einmal ein Stück Obst, keinen Müsliriegel, gar nichts.
Auf unserer endlos scheinenden Suche drangen wir anscheinend ins Büroviertel vor, denn um uns herum türmten sich mittlerweile die glasverkleideten Wolkenkratzer. Dort fanden wir einen Gebäudekomplex, in dessen Erdgeschoss einige Geschäfte zu finden waren, darunter auch Restaurants. Ohne weiter darüber nachzudenken, gingen wir hinein. Wir hatten Hunger. Ich war äußerst erstaunt darüber, dass man in japanischen Restaurants rauchen durfte. Das hatte ich seit Jahren nicht mehr gesehen. Es gab noch nicht einmal abgeschirmte Raucherbereiche, nein, die Leute rauchten einfach so nach dem Essen ihre Zigarette. Jedenfalls war es in diesem Lokal so.

Als wir dann endlich zum Essen kamen, bestellten wir uns leckeres Katsu Don, das auch sehr gut schmeckte. Dennoch gab es einige Kuriositäten, wie beispielsweise die Tatsache, dass es auch hier ein rohes Ei in Franziskas Mahl gab. Die Japaner essen wohl alles roh. Historisch mag das durchaus zu erklären sein, aber meinen Geschmack trifft es nicht zur Gänze.

Gefolgt wurde dieses Mahl von einem Nachtisch der besonders ungesunden Art. Wir kehrten in einen Mr. Doughnut ein, um einige Leckereien käuflich zu erwerben.

Doch damit war unser Tag noch nicht abgeschlossen. Immerhin mussten wir jetzt noch den Weg zurück ins Hostel finden. In unserer Unwissenheit wähnten wir uns guter Dinge, denn immerhin gab es den Eingang zu einer Metro-Haltestelle direkt neben dem Gebäude, in dem wir uns gerade befanden. Doch kaum waren wir unten angekommen und warfen einen Blick auf den Netzplan, als unsere Hoffnung schwand. Dies war die U-Bahn. Wir brauchten aber das JR-Netz, um zurück zu unserer Herberge zu gelangen. Wir irrten mehr oder weniger zielsicher durch die Straßen, denn auch wenn ich es schaffe, mich in der Lotte Mall zu verlaufen, so ist mein Orientierungssinn im freien hervorragend. So gingen wir zurück zur Haltestelle, an der wir angekommen waren, auch wenn es ein bisschen länger dauerte. Letzten Endes war es gut, dass wir den ganzen Tag für den Ausflug eingeplant hatten, da doch einige unerwartete Herausforderungen auf uns gewartet hatten.

Am zweiten Tag war unser Spiel „Finde die Koreaner“ bereits so langweilig, dass wir Chinesen mit in die Mischung nahmen. Koreaner und Japaner sind grundverschieden und man erkennt sie aus der Entfernung. Dies wurde besonders deutlich, als wir im achten Stockwerk des Palastes auf dem Balkon standen und unten in den Besuchermassen Koreaner herauspickten. Die Tücke mit den Chinesen war für uns, dass wir uns nicht sicher sein konnten, ob es nicht doch Taiwanesen waren, weil wir in keinem der beiden Länder längere Zeit zugebracht hatten. Für so etwas braucht man immer eine Feldstudie.
Langsam frage ich mich, woher das Gerücht aufkommt, Japaner wären modern und auf der Höhe der Zeit. Im Vergleich zu Korea hinkten sie ein Jahrzehnt hinterher. Die Mobiltelefone waren älter, kleiner, primitiver; die Kleidung war irgendwann in den 1970ern stehen geblieben; die Frisuren haben sich auch seit dem ersten Manga kaum verändert; WiFi gab es nur in den wenigsten Lokalen. Und so etwas fällt MIR auf.
... link (0 Kommentare) ... comment
Sonntag, 7. Februar 2016
Busan – August 2015
atimos, 22:59h
Nach unseren Abenteuer in Neuseeland hatten wir für den Rest des Jahres erst einmal genug von Busfahrten, weshalb wir gerne einige Won mehr investierten, um die Strecke zwischen Seoul und Busan mit dem Zug zurückzulegen. Allerdings erlaubte unser Budget es nicht, dass wir den super schnellen KTX nahmen, weshalb wir uns mit der Tingelbahn begnügten, die fünfeinhalb Stunden fuhr. Das Zugticket hatten wir schon in der Tasche, die Strecke zur Seoul Station war uns bekannt, also brachen wir auf, nachdem wir uns von allen gebührend verabschiedet hatten. Seol Hee drückte uns als Abschiedsgeschenk koreanische Fläggchen in die Hand.
Es dauerte genau fünf Schritte, bis wir unsere Gastgeber vermissten und die Fahrt nach Busan bereuten.
Als Mahlzeit für zwischendurch besorgten wir uns Kimbap bei Mapu Mandu sowie einige Teilchen bei Tous les Jours. Darüber hinaus hatten wir noch einige Knabbereien. Gut gerüstet zogen wir also wieder in die große, weite Welt, um unseren Horizont zu erweitern und Neues zu erleben.
Fast schon selbstverständlich war alles hervorragend ausgeschildert: Zugnummer, Wagon und Sitzplatz standen auf unseren Fahrkarten (zu allem Überfluss hatte die Dame am Schalter die wichtigsten Informationen mit einem Buntstift eingekreist), während die Anzeige uns deutlich machte, wohin wir uns wenden mussten, um unseren Zug zu bekommen. Dieser war auch noch pünktlich.
Der Zug war wesentlich breiter als in Deutschland, wobei ich nur einen Vergleich mit einem Regionalexpress erstellen kann. Man hatte breite Sitze und genug Platz im Mittelgang. Auch Beinfreiheit war gegeben. Selbstverständlich war das Abteil klimatisiert, was bei 36° Außentemperatur zwingend erforderlich war.
Allerdings war die Klimaanlage den Gegebenheiten nicht so ganz gewachsen. Auf einem Abschnitt der Strecke, als der Wagon mit so vielen Menschen vollgepackt war, dass man nicht einmal mehr durch den Gang gehen konnte, ohne überall anzurempeln, merkte man zwar die sachte Brise, die von der Anlage ausging, sie brachte allerdings keinerlei Linderung. Letzten Endes musste eine Schaffnerin die Fahrgäste mit Fächern und kaltem Wasser versorgen. Trotzdem blieben alle Leute ruhig und gelassen. Zuvor war noch ein Mitarbeiter durch die Wagons gegangen und hatte eine Ansage gemacht, aber wir verstanden nicht genug davon, außer dem Wort für Wasser tatsächlich gar nichts. Er hätte uns auch eine Geschichte vom Reiher, der auf den Mond flog, erzählen können.
Vielleicht setzte er die Fahrgäste auch darüber in Kenntnis, warum der Zug doch unerwartet Verspätung hatte. An einer Haltestelle stand er fast dreißig Minuten, was den Zeitplan völlig durcheinander brachte. Bis Busan weitete sich diese Verzögerung auf fünfzig Minuten aus.
Die Strecke zwischen Seoul und Busan war allerdings recht sehenswert. Erst hier wurde uns deutlich, wie bergig das Land tatsächlich war, wodurch ich mich fragte, ob Seoul an der einzigen flachen Stelle innerhalb der Grenzen erbaut wurde. Es war hier so grün und unberührt, das es doch stark an Neuseeland erinnerte.

Trotz dieser widrigen Umstände kamen wir irgendwann endlich in unserer neuen Heimatstadt an. Hulk hatte uns den Weg zum Hostel in wenigen Worten erklärt, uns die Metrolinie genannt, mit der wir fahren mussten, den Haltestellennamen in Hangul aufgeschrieben und uns alle notwendigen Informationen mitgeliefert. Auf diese Weise fanden wir das Popcorn Hostel Nampo problemlos.
Mein erster Eindruck von Busan beschränkte sich auf die Fahr zur Herberge, so dass ich mir wie in einer Kleinstadt vorkam. Die Anzahl der Metrolinien war übersichtlich und die Strecken kurz. Aber schon zu Anfang wurde deutlich, dass Hupen in dieser 3,5 Millionenmetropole einen wesentlich größeren Stellenwert einnahm als in Seoul. Innerhalb von 100 Metern hatten wir so viele Leute hupen hören wie in drei Wochen in der Hauptstadt.
Im Hostel angekommen wurden wir freundlich von Belle und Zuska begrüßt, die von unserem bevorstehenden Aufenthalt wussten und unsere Namen errieten, bevor wir uns vorstellten. Weniger gesprächig war Mango, die Hostel eigene Perserkatze, die uns eher gelangweilte Blicke zuwarf, wenn sie sich überhaupt dazu herabließ, das gemeine Volk anzusehen. Sogleich führten die Damen uns in unser neues Zimmer.

Zuska war Tschechin, die ihren Urlaub nicht zum ersten Mal in Busan verbrachte. Sie war ein angenehmer Zeitgenosse, der gerne einen Spaß mitmachte und lustige Geschichten zu erzählen hatte. Ebenso reisefreudig wie wir hatte sie bereits zahlreiche Freunde außerhalb der Heimat. Sie war auch äußerst hilfreich, was die Verständigung betraf, denn im Gegensatz zu unserer Gastgeberin sprach sie fließend Englisch und ein bisschen Koreanisch. Allerdings hatten wir nur ein kurzes Vergnügen miteinander, da sie wenige Tage nach unserer Ankunft zu weiteren Abenteuern aufbrach. Zuerst führte sie ihre Reise nach Japan, bevor sie für eine Nacht zurückkam, um dann nach Seoul und schließlich in die Heimat zu fahren. An ihrer statt kam Steve. Dazu später mehr
Auch wenn die Treppe bei Hulk spektakulär war, so machte mir dieses Konstrukt, das die verschiedenen Stockwerke miteinander verband, wesentlich mehr zu schaffen. Die Stufen waren unterschiedlich hoch, einige waren schon ausgetreten, andere krumm und schief, so dass sie in verschiedenen Winkeln abfielen. Die eine Stufe fiel nach vorne ab, die nächste nach hinten, zwei Stufen weiter ging es nach links und irgendwann bestimmt auch nach rechts. Vielleicht war die Treppe als solche ausgeglichen und plan, aber das war nur dank eines Mittelwertes der einzelnen Stufen der Fall. Allein am ersten Tag stolperte ich zweimal über diese Hindernisse, und bin froh, dass nichts passierte. Ich machte es mir zur Priorität, die Stufen langsam zu begehen, insbesondere dann, wenn ich nur Arbeitslatschen trug.
Was mir am Popcorn Hostel besonders gefiel, war die Tatsache, dass man in den Räumen barfuß laufen durfte / musste. Am Eingang gab es ein kleines Treppchen, vor dem man gefälligst die Schuhe ausziehen musste. Somit blieben die Räume sauberer als mit Schuhen. Für empfindliche Besucher oder die kalte Jahreszeit stellte das Hostel Pantoffeln zur Verfügung. Ich liebe dieses Konzept und finde, dass es unbedingt in Deutschland eingeführt werden sollte.
Es gab dieses Mal keine Mitarbeiterquartiere, so dass wir gezwungen waren in einem Achtbettzimmer mit Gästen zu nächtigen. Glücklicherweise hatte ich noch keinen Koreaner getroffen, der laut schnarchte. Unglücklicherweise sollte sich das eben in Busan ändern. Aber nur ein unvorbereiteter Globetrotter macht sich ohne eine ausreichende Menge Ohrstöpsel auf den Weg.

Unser erster Arbeitstag begann um 12, was für mich nun wirklich viel zu spät war. Bis dahin hatte ich schon wieder Hunger und hätte viel lieber etwas gegessen, als erst mit dem Aufräumen anzufangen. Es änderte sich auch während unseres Aufenthaltes nicht. Was sich änderte, war meine Essgewohnheit, denn ich nahm einfach noch einen Snack direkt vor der Arbeit ein. Dies war besonders wichtig, weil die Arbeit hier mehr Zeit einnahm als im Inno Hostel.
Man merkte schnell, dass Hulk hier gelernt hatte. Die Putzroutine war ähnlich, aber in einigen Details dann doch anders. Allerdings verstehe ich bis heute nicht, was die Koreaner an Putzbürsten mit langen Stielen auszusetzen hatten. Um den Boden zu putzen mussten wir immer auf den Knien rumrobben, in der Hocke sein oder uns bücken. Gründlichkeit schön und gut, aber das gleiche Ergebnis hätten Borsten an einem langen Stiel gebracht.
Besonders schlimm war es mit einem Besen inklusive Handfeger, den man für die Treppen benutzen sollte. Der Besen hatte einen Stiel, ja, aber er war so kurz, dass sogar ein koreanisches Großmütterchen sich hätte bücken müssen, um damit fegen zu können. Es gibt so viel sinnvollere Erfindungen.
Ich verstand ebenso wenig, warum wir angehalten waren in Räumen zu putzen, die bereits sauber waren und von niemandem benutzt wurden. Die Türen waren zu, nicht einmal die Katze hatte eine Pfote hinein gesetzt. Aber es war nicht meine Aufgabe mit den vorherrschenden Strukturen zu brechen. Ebenso wenig Sinn ergab es, die Böden in den Bädern nach dem Schrubben trocken zu wischen, weil die Waschbecken in den Bädern keinen Abfluss hatten. Stattdessen tropfte das benutzte Wasser auf den gerade abgetrockneten Boden, um dann in den Abfluss zu fließen. Es war mir ein Rätsel. Hier zeigte sich aber deutlich, wieso es in koreanischen Badezimmern Badelatschen gab: Alles andere hätte zum einen einen Saustall hinterlassen, da es letzten Endes immer nass in ihnen war; zum anderen um keine nassen Füße zu bekommen, weil man in den Räumlichkeiten dieses Hostels eh nur in Socken ein durfte.
Was mir allerdings den Rest gab, war das hiesige Putzzeug. Schon nach fünf Minuten sehnte ich mich nach Two Ways zurück, denn was auch immer sie mir hier in einer weißen Sprühflasche servierten, es war wesentlich schlimmer. Giftig beschreibt es wahrscheinlich am besten. Bei dieser chemischen Wunderwaffe war es nicht einmal mehr nötig, das fein gestäubte Mittelchen versehentlich einzuatmen. Die Dämpfe allein reichten aus, um einen Elefanten umzuhauen. Wahrscheinlich war es pures Chlor oder so etwas Ähnliches. Ich fragte Belle nach einem Mundschutz, aber sie hatte keinen. Immerhin gab es Gummihandschuhe. Trotzdem brauchte ich nach jedem geputzten Badezimmer erst einmal frische Luft, um wieder einen klaren Kopf zu bekommen.
Zu unseren Aufgaben zählte es auch nun, die Bettdecken und –laken zu waschen und zum Trocknen aufzuhängen. Darin zeigte sich schon ein grober Fehler in der Planung, denn es gab nur zwei Waschmaschinen, die maximal drei Teile fassen konnten (sowohl die Decken als auch die Laken waren recht dick), und das bei rund 40 Betten, also 80 Teilen. Ein Waschgang dauerte ungefähr 20 Minuten, wobei die Maschinen stellenweise eine eigene Zeitrechnung an den Tag legten. Glücklicherweise gab es wenige Tage, an denen wir so viele Betten machen mussten, dass uns etwas ausging.
Ein besonders großes Problem stellten Regentage dar, weil wir dann einfach nicht in der Lage waren, Wäsche zu machen. Die Waschmaschinen standen auf dem Dach in einem kleinen Unterstand, während die Leinen zum Trocknen unter freiem Himmel waren. Dummerweise gab es auch keinen ausreichenden Vorrat, um auf diese Weise für Ersatz zu sorgen. In diesem Fall griffen wir auf die chemische Lösung zurück. Es war aber wirklich nur der letzte Ausweg. Es war auch deshalb ärgerlich, weil man an bewölkten Tagen auch immer darauf achten musste, ob es nun regnete oder nicht.
Ähnliche Probleme gab es mit den Handtüchern. Zum einen fand ich diese viel zu klein, auch wenn jeder Gast zwei erhielt. Sie waren nicht viel größer als ein DIN A4 Blatt. Jedenfalls führte diese Rechnung dazu, dass wesentliche mehr Handtücher verbraucht wurden. Die Wäsche der Handtücher übernahm ein externer Dienst, dessen Qualität mit jedem Tag mehr und mehr zu wünschen übrig ließ. Nicht nur, dass die Lieferung jeden Tag später kam, nein, manchmal gab uns der Lieferant auch das falsche Paket. Ende vom Lied war, dass wir an so manchem Tag ohne frische Handtücher standen. Ein Alptraum für jeden Douglas Adams-Fan.
Nachdem wir mit unseren Aufgaben fertig waren, stand die Vorbereitung des Essens im Vordergrund. Anders als in Seoul wurden wir hier nicht mit fertigen, köstlichen Mahlzeiten versorgt, sondern nur mit den Zutaten. Der Rest oblag uns. Manchmal mussten wir auch zuerst einkaufen. Wehmütig erinnerte ich mich an den Luxus der vergangenen Herberge. Insbesondere weil ich ohne Rezepte nur drei Sachen kochen kann: Curry, Pfannkuchen Chili con carne.
In erster Linie war Zuska unsere Ansprechpartnerin für alle Belange, was vor allem daran lag, dass sie wesentlich besser Englisch konnte als der durchschnittliche Koreaner. Aber auch weil sie schon seit einigen Wochen in dem Hostel tätig war und so oder so wusste, was wohin gehörte und was wo zu finden war. Auch wenn es um Besorgungen jeglicher Natur ging, kannte Zuska sich im Viertel aus. Sie wusste, wo der nächste, günstige Supermarkt war, wo man Delikatessen erstehen konnte und wo es Kuriositäten zu sehen gab. Auch bei der Planung von Besichtigungen rund um Touristenstandorte war sie eine große Hilfe.
Bereits am ersten Tag nahm sie mich in den nächsten Supermarkt mit, doch dieser war nicht, wie ich es erwartet hatte. Ich dachte an etwas im Stil von HomePlus, wurde aber von einer Mischung aus Basar und Rewe begrüßt. Während im Erdgeschoss Frischwaren feilgeboten wurden, fand man im ersten Stock alle abgepackten Lebensmittel sowie Haushaltsgegenstände. Unten gab es tatsächlich Verkäufer, die ihre Ware lautstark anpriesen, was auf mich sonderbar wirkt. Dann ergab sich für mich noch die Schwierigkeit, dass die meisten Sachen gar keine Übersetzung hatten, so dass ich doch ziemlich verloren durch die Gänge schlenderte. Selbstverständlich war ich darauf bedacht, meine Begleitung nicht aus den Augen zu lassen.
Biff-Plaza / Marktstände
Direkt gegenüber von unserem Hostel befand sich der Biff Plaza. Dies war eine große Fußgängerzone, die vor Geschäften und Straßenbuden nur so überquoll. Morgens kamen die Verkäufer langsam zu ihren Ständen, um dann allerlei skurrile Köstlichkeiten anzubieten. In den Boden waren die Handabdrücke bedeutender koreanischer Schauspieler mit ihren Unterschriften eingelassen. Nachts wurde der Platz in bunten Farben erleuchtet. Mehrere Bögen zierten einen Teil des Platzes, so dass man abends den Eindruck hatte, durch einen Regenbogen zu schlendern. Diesen schmückenden Umstand hatten wir dem Busan International Film Festival zu verdanken, für das die Stadt sich jedes Mal herausputzte und auch außerhalb der Zeit Touristen anlocken wollte.

Auch wenn ich kein großer Fan davon war, mir das Zimmer mit fünf Fremden zu teilen (drei der Betten waren schließlich von Personal belegt), ergaben sich dadurch ganz neue Möglichkeiten der Interaktion mit Einheimischen. Sie waren zumeist von äußerst kurzer Natur, aber das tat der Intensität dieser Begebenheiten keinen Abbruch. Davon abgesehen gab es nur wenige Tage, an denen dieses Zimmer voll belegt war.
Wir hatten einen Heidenspaß dabei, die erschrockenen Gesichter von Koreanern zu betrachten, weil sie uns sahen. Es war wirklich nicht mehr dabei. Wir saßen nach getaner Arbeit im Zimmer auf unseren Betten, machten unseren alltäglichen Kram und ab und zu kamen eben Kunden herein, um die Nacht mit uns in einem Zimmer zu verbringen. Jeder zweite Gast blieb in der Tür stehen, sah uns mit großen Kulleraugen an (wie Koreaner es eben konnten), verbeugte sich und schlurfte zu einem freien Bett. Aber es waren genau diese Leute, die sich nicht trauten, auch nur ein Wort mit uns zu wechseln. Es ging so weit, dass ich mich stellenweise unwohl fühlte.
Dann war da der Abend, an dem Kwan Min und Kwan Yun uns zu einer kleinen Feier einluden. Kwan Yun hatte gerade Urlaub von seinem Militärdienst bei der Luftwaffe und nutzte die Gelegenheit, um seinen jüngeren Bruder, Kwan Min, durch das Land zu schleifen. Beide schienen dabei viel Spaß zu haben. Aufgrund ihres doch nicht allzu hohen Budgets teilten sie sich das Zimmer mit uns. So kam abends Kwan Min hinein, um Franziska und mich nach unten ins Wohnzimmer einzuladen, wo die beiden gerade eine kleine Party anberaumten. Es dauerte allerdings einige Zeit, bis wir seine Intention verstanden, denn Kwan Min gab sich größte Mühe, Jae Won in seinem Englischkenntnissen zu unterbieten. Es gelang nur mäßig. Schließlich teilten wir dem Jungen mit, dass wir gleich zu ihnen stoßen würden, hier nur noch einige Kleinigkeiten abschließen wollten.
Es dauerte keine fünf Minuten, da war Kwan Min wieder im Zimmer. Ich bin mir nicht sicher, ob er uns nicht verstanden hatte, ob er glaubte, wir hätten ihn nicht verstanden oder ob unser „Gleich“ ihm einfach zu lange dauerte. Jedenfalls hielt er eine große, ganze Wassermelone vor der stolzgeschwellten Brust, aus der das Fruchtfleisch gekratzt worden war. Stattdessen gluckerte nun eine große Menge Sojo im Inneren der grünen Schale. Wir schickten den breit grinsenden Jungen raus, bevor wir ihm folgten. Unten warteten schon sein Bruder, Zusaka, Belle und noch ein weiblicher Gast auf uns.
Das Eis mit den Gebrüdern Kwan hatten wir gebrochen, als wir uns über Kwan Yuns Tattoo (das nicht permanent, sondern nur ein Aufkleber war) amüsiert äußerten, denn er hatte sich für die Worte „Gott ist tot“ entschieden. Er hingegen war aus dem Häuschen, dass er jemanden gefunden hatte, der es tatsächlich verstand. So kamen wir schnell ins holprige Gespräch. Ich rechne es allerdings jedem einzelnen Koreaner hoch an, dass die Leute sich tatsächlich Mühe gaben, mit ihren Touristen zu kommunizieren.
Bei der bevorstehenden Party versuchten uns unsere neu gewonnen koreanischen Freunde mit einigen einheimischen Trinkspielen vertraut zu machen. Es stellte sich allerdings schon bald heraus, dass ich sogar in nüchternem Zustand nicht in der Lage war, diese zu begreifen. Was auch immer wir machten, es klappte nicht. Es hatte irgendetwas mit klatschen und Namen zu tun oder mit Zahlen und ich war völlig durcheinander. Wahrscheinlich muss man damit großwerden, um es zu verinnerlichen. Ich gab schnell auf. Stattdessen holte irgendjemand ein Gesellschaftsspiel hervor. Es ging darum verschiedene Zutaten auf einer wackeligen Pizza zu platzieren, ohne dass der Haufen runterfiel. Auf dem Bild sah es sehr einfach aus, doch hatte ich nach kurzer Zeit das Gefühl, dass die Fotografen einen Pakt mit dem Teufel geschlossen hatten, um die Gesetze der Physik außer Kraft zu setzen. Das oder sie wussten mit Photoshop umzugehen. Jedenfalls gelang es uns nie so viel auf die Pizza zu legen, wie es auf dem Beispielbild war, obwohl wir einen versteckten Profi in unserer Mitte hatten.

Unsere Koreaner machten auch daraus ein Trinkspiel. Es gab auch einen kleinen Snack für Zwischendurch, auch wenn ich mich nicht mehr daran erinnere, was es war.
Wieder stießen wir auf blankes Unverständnis, als wir diesen Koreanern erklärten, dass man sich in Deutschland zu einem Bier zusammensetzen durfte, ohne dabei zu essen oder ein Spiel zu spielen.
Alles zusammen betrachtet nahm der Abend einen äußerst erheiternden Lauf. Die Koreanerin, die noch mit von der Partie war, war sogar so begeistert, dass sie uns zum Abschied drückte. Auch wenn die Kommunikation ein bisschen schwierig war, weil wir – wie so oft – nicht die gleiche Sprache sprachen, schafften wir es irgendwie einen bleibenden Eindruck bei ihr zu hinterlassen. Sie gab Franziska eine Gesichtsmaske, welche diese am selben Abend noch ausprobierte. Leider erlaubte meine Reisebegleitung mir nicht, ein Foto davon zu machen, da sie befürchtete, man würde sie mit einem Geist verwechseln. Zurecht!
Es gibt ein koreanisches Phänomen, das mich bis heute beschäftigt und königlich amüsiert: junge, männliche Koreaner. Sie sind in vielerlei Hinsicht so anders als ihre europäischen Pendants, dass ich es am Beispiel von Kwan Min deutlich machen will.
Als Kwan Min mit seinem Bruder das Hostel betrat, stolperten die beiden zwangsläufig über Mango, die sich gerade genüsslich vor dem Empfang räkelte. Während der ältere Bruder dank monatelanger Militärausbildung gerade noch so die Fassung bewahren konnte, tat sich der jüngere nicht den geringsten Zwang an. Es dauerte genau zwei Sekunden, bis er alle Hemmungen fallen ließ, mit seiner Stimme drei Oktaven nach oben sprang, so dass er sein zehn Jahre jüngeres Ich imitierte, große Kulleraugen bekam und sich freudestrahlend auf das pelzige Wollknäuel stürzte, um es ordentlich durch zu knuddeln. Hier möchte ich noch erwähnen, dass Kwan Min, obwohl schon 20, noch immer wie 14 aussah. Es war ein Bild, das mich ein bisschen perplex in der Gegend stehen ließ und gleichzeitig den Charakter junger Koreaner hervorragend einfing. Die sind nun einmal so. Egal ob Freude, Trauer oder Begeisterung, sie können ihre Gefühle einfach so ausleben. Einfach nur goldig.
Obwohl ich schon eine perfekte Geburtstagsüberraschungsparty in Seoul feiern durfte, fand mein tatsächlicher Geburtstag in Busan statt. Also galt es, diesen zu gestalten und in vollen Zügen zu genießen.
Er begann damit, dass ich mir an diesem Tag frei nahm. Frühstück ans Bett konnte ich wohl von niemandem erwarten, weil ich eh zuerst wach war. Ein bisschen schlecht fühlte ich mich schon, weil ich den Mädels nicht aus dem Weg gehen konnte, während sie putzten. Aber ich blieb stark, sah sie nur groß an, wenn sie um mich herum wuselten, und beschäftigte mich mit anderen Dingen.
Wir unternahmen einen kleinen Spaziergang durch das Viertel, suchten die Touristeninformation auf, in der die Mitarbeiter tatsächlich Englisch sprachen und uns helfen konnten, drehten einen Runde durch die belebte Fußgängerzone und statteten der Lotte Mall einen kurzen Besuch ab. (Wir erinnern uns hier noch einmal daran, dass Lotte nicht omnipräsent war.) Zurück ging es entlang des Fischmarktes, der allerlei lebendige Kuriositäten feilbot. Ein Oktopus wollte sich seinem Schicksal nicht kampflos geschlagen geben, krabbelte aus dem Wasserbecken, platschte auf den Boden und versuchte davon zu robben – bis die Verkäuferin ihn sah und gelassen wieder ins Becken beförderte. Auch wenn die Waren jetzt noch frisch waren und auf Eis lagen, waren wir uns sicher, dass wir sie bis zum Abend würden riechen können, weil wieder einmal mehr als 30° prophezeit worden waren.
Nachdem die Mädels ihre Arbeit getan hatten, stand Mittagessen auf dem Programm. Ich durfte mir etwas wünschen, also bestand ich auf Jjajangbap, das ich bisher nur einmal hatte, aber doch sehr schmackhaft fand. Wir riefen bei einem Lieferservice an, um zu bestellen, erfuhren aber, dass sie gerade Urlaub machten. Also ließ Belle uns ausziehen, damit wir in einem Restaurant zu meinem Wunschgericht kamen. Dort angekommen sagte man uns, dass sie nur Jjajangyeom hatten. Das ist dieselbe Sauce, aber auf Nudeln statt auf Reis. Wir stellten aber fest, dass sie Reis als Beilage anboten, weshalb Zuska es so drehte, dass man mir nur eine Portion der Sauce bracht und ich mir den Reis drunter mischen konnte. Es war den Köchen nicht ganz so lieb, aber sie spielten mit, was ich ihnen sehr hoch anrechne. Dazu bestellten wir eine mittlere Platte frittierter Schweinefleischstreifen. Es war ein köstliches Mahl.

Vollgefuttert rollten wir von dannen. Da die meisten ausländischen Filme in Südkorea mit Untertiteln unterlegt sind, steht einem Kinobesuch wenig im Wege. Allerdings wollten wir die Minions sehen und wussten nicht, wann die letzte Vorstellung lief. Immerhin war es ein Kinderfilm. Wir unternahmen einen Spaziergang zum Lotte Kino (Lotte ist nicht omnipräsent), nur um festzustellen, dass die einzige nicht synchronisierte Fassung um acht Uhr morgens lief. Aus dem Vorhaben wurde für heute nichts. (Aus dem Vorhaben wurde auch später nichts, weil es einfach unmöglich wurde, so viele Leute um diese frühe Uhrzeit aus dem Bett zu schütteln.)
Aber auf uns warteten noch andere Verpflichtungen. Nachdem wir über die Portion des Mittagessens hinweggekommen waren, machten wir uns auf den Weg in ein Café, um ein Geburtstagsbingsu zu verspeisen. Natürlich gab es so etwas nicht, weil man keinen Anlass braucht, um ein tolles Bingsu zu essen, aber es war mein Geburtstag, es war ein kunstvoll drapiertes Bingsu, also nenne ich es Geburtstagsbingsu. Ich entschied mich für ein schokoladenes Schokobingsu. Es war vorzüglich!

Auch wenn dies nicht nach besonders viel klingen mag, war es aus meiner Sicht ein hervorragender Geburtstag. Schmackhaftes Essen in Hülle und Fülle macht mich nun einmal glücklich. Und Bingsu krönt jeden Tag.
Unsere Gastgeberin Belle überraschte mich noch mit einem kleinen Geburtstagsgeschenk. Es war etwas, womit ich nichts anzufangen wusste, auch wenn die beigelegte Gebrauchsanweisung in Bildern international verständlich war. Es sah aus wie ein überdimensionales Pflaster, das man auf der Rückseite eines Mobiltelefons befestigen sollte. Zu diesem Zweck hatte dieser Gegenstand zwei Klebestreifen. Nachdem ich es also angebracht hatte, stand ich mit meinem neuerlangten Zierrat dar und wusste immer noch nicht ein noch aus. Als Belle meine Verwirrung sah, erklärte sie mir den Zweck dieses Gegenstandes. Wenn man dieses „Pflaster“, wie ich es unbeholfen nannte, aufklappte, hatte man ein praktisches Standbein für das Smartphone, so dass man es nicht die ganze Zeit halten musste, um beispielsweise ein Video zu sehen. Gleichzeitig konnte man es einklappen, wenn man es gerade nicht brauchte und so immer mit sich führen, ohne dass es im Weg war. Zur Körnung des ganzen Spaßes war es noch kunterbunt mit den Monstern aus dem Film Monster Universität übersät.

Eines Tages überraschte Zuska uns mit der Ankündigung, dass ein Freund von ihr sie hier im Hostel besuchen würde. Er bliebe nur eine Nacht, reiste dann weiter, was uns aber keinesfalls davon abhalten sollte, Spaß mit ihm zu haben. Diesen Freund hatte sie auf einer vorhergehenden Reise kennengelernt, denn auch er war nur Besucher in diesem Land. Sein Name war Masa und er kam aus Japan eingeflogen, um sich mit Zuska und weiteren Freunden zu treffen. Bei der Gelegenheit gab es eine kleine Feier – wahrscheinlich nur aus dem Grund, weil Koreaner gerne feierten und jeden Anlass dafür nutzten. Wir waren von Anfang an überrascht, wie gut Masas Englischkenntnisse waren. In vielerlei Hinsicht wirkte der junge Mann gar nicht japanisch, sondern weltgewandt.
Auch zu dieser Feier gesellte sich ein Koreaner, mit dem wir letzten Endes nichts anzufangen wussten. Er sprach kein einziges Wort mit uns, besorgte aber Essen für alle. Diese Haltung verwirrte mich in außergewöhnlichem Maß, doch ich lernte die Erklärung dafür schon bald. Zum einen ist es in Korea ganz selbstverständlich, dass Gäste etwas mit dem Manager eines Hostels teilen – und umgekehrt. Zum anderen konnte der Kerl nicht genug Englisch, um sich auch nur vorzustellen. Er versicherte Belle aber, dass er einen schönen Abend hatte und die Gesellschaft genoss. Uns blieb nichts anders übrig, als ihm zu glauben.
Während wir also in dieser illustren Runde saßen und ziemlich viel Zeugs ohne Sinn und Verstand erzählten, wurde auch viel Alkohol ausgeschenkt. Dieses Mal verzichteten die Leute aber auf Hochprozentiges und gaben sich mit Bier zufrieden. Allerdings war es mit einer drei Liter Plastikflasche nicht getan, weshalb man noch Nachschub holte. Sowohl Franziska als auch Zuska beschlossen, dass Koreaner kein Bier brauen konnten. Tags darauf verschwand Zuska; dieses Mal sahen wir sie nicht wieder.
Tatsächlich erkannten wir schnell, dass es einige Unterschiede zwischen Seoul und Busan gab, die sich nicht nur auf die Städte, sondern auch auf weitere Aspekte des Lebens ausdehnten. Beispielsweise sahen wir wesentlich mehr übergewichtige Leute hier im Süden als in der Hauptstadt. Darüber hinaus war Busan nicht so gut auf Touristen vorbereitet wie Seoul. Ja, es gab Touristeninformationen mit Broschüren in verschiedenen Sprachen. Aber es gab wesentlich weniger Ausländer und wesentlich weniger Personal, das zumindest einige Brocken Englisch sprach. Auch die Beschilderung war nicht immer in englischer Sprache vorhanden. Dafür fanden wir viele einfache Hinweisschilder an Läden, die in kyrillischer Schrift waren. Wir schafften es trotzdem immer uns zurechtzufinden und wurden von allen Leuten äußerst freundlich behandelt.
Anders als in Deutschland spielen Geister in der koreanischen Kultur bis heute eine wichtige Rolle, was vor allem mit dem Ahnenkult zusammenhängt. Geister zählen nicht zum Aberglauben, sondern sind Teil der Realität in Korea. Punkt. Es hat keinen Sinn mit Koreanern darüber zu diskutieren.
Das heißt nicht, dass es für einen Europäer nicht lustig sein kann, wenn man mal einen koreanischen Geist sieht und die Reaktion von Koreanern auf ihn beobachten darf.
Ich hatte das unvergessliche Privileg bei einem solchen Ereignis zugegen zu sein, das sich folgendermaßen zutrug. Auf dem Weg nach draußen schneite ich an der Rezeption vorbei, um mich nach dem Weg zu erkundigen und kurz abzumelden. Just in diesem Moment sah man auf der Überwachungskamera, wie die Tür des Dachzimmers aufging… und wieder zufiel. Drei gebannte Augenpaare, Belle und zwei Gäste, starrten mit offenen Kinnladen und Ausrufen des Unglaubens auf den Bildschirm. Daneben saß Zuska, gelassen, entspannt; ich stand noch in der Tür. Ausnahmslos alle Koreaner im Raum hielten dies für ein Werk von Geisterhand. Ich schob eher dem starken Wind die Schuld zu. Als ich mich anbot nach oben zu gehen, um die Tür fest zu schließen, schrie einer der Jungs tatsächlich, dass ich nicht gehen solle. Er hatte Angst, dass dort oben ein echter Geist sein Unwesen trieb und mir Böses wollte. Ich bin mir annähernd sicher, dass der junge Mann bereits eine Gänsehaut hatte. Ungeachtet seiner Zweifel bot ich Bell meine Hilfe nochmals an, weil ich nicht wollte, dass sie den ganzen Tag in Angst und Schrecken verbrachten. Nur widerwillig nahm unsere Gastgeberin dieses Angebot an. So stieg ich die Treppen aufs Dach hoch, um die Tür zu schließen. Ich hatte mir Geister gruseliger vorgestellt.
Die Sache mit den Geistern war uns schon in Seoul über den Weg gelaufen, allerdings in einem viel weiteren Ausmaß.
Franziska war dabei gewesen, als Jae Won einen Geist sah. Sie berichtete mir – nicht ohne einen gewissen amüsierten Unterton – wie der Junge an einem offen stehenden Raum vorbei gegangen war, irgendetwas aus dem Augenwinkel gesehen haben musste, wieder rückwärts zurückging, den Raum betrat, sich verwirrt umsah, wieder hinausging, um noch einmal rein zu gehen und dann Jae Woo von einem Geist berichtete. Jae Won soll dabei bleich geworden sein, denn der Raum war beide Male leer gewesen. Aber er wusste die Gestalt aus der anderen Welt genau zu beschreiben. Es war ein Mädchen mit langen, schwarzen Haaren, das vor einem der Betten gestanden haben soll. Jae Woo lachte ihn offen aus. Später versicherte Jae Won mir, dass er keine Angst vor Geistern hätte, was ich aufgrund dieses und anderer Ereignisse nicht so ganz glauben wollte. Aber das verrate ich dem Jungen nicht.
Ein anderes Mal als wir unten in der Lounge des Inno Hostels saßen, lief im Hintergrund ein Film – ein Horrorfilm mit Geistern. Wir sahen nur die Anfangsszene, bevor jemand sich erbarmte und umschaltete. Es ging um irgendeinen weiblichen Geist, der irgendwo in einem Badezimmer spukte. Nach dieser Szene traute sich unser Jüngster für die nächste Stunde nicht mehr aufs Klo, obwohl er genau deshalb aufgestanden war. Martin, der sich anbot mitzukommen, unterbreitete diesen Vorschlag wahrscheinlich nur, weil er sich verantwortlich fühlte. Ganz geheuer schien auch ihm die Sache nicht.
Hulk war ebenso einfach von Geistern zu beeindrucken. Um dem ganzen Spektakel noch die Krone aufzusetzen, sah er sich youtube-Videos mit Geistersichtungen an. Ich möchte hier noch einmal betonen, dass alle drei Kerle ehemalige Navy Seals der Koreanischen Armee waren. Das Argument, das man an dieser Stelle von vielen Koreanern hörte, war, dass man Geister ja nicht schlagen könne, weshalb man keine Möglichkeit habe, sich zur Wehr zu setzen. Erstaunlich logisch.
Busan Tower
Wir unternahmen einen Ausflug zum Busan Tower, der glücklicherweise nicht weit von unserer Herberge entfernt war. Glücklicherweise deshalb, weil das Wetter immer noch sommerlich war. Es war nur ein kurzer Marsch und ein noch kürzerer Aufstieg den Hügel hinauf, auf dem der Turm stand. Den Hügel zu erklimmen war allein deshalb besonders einfach, weil es überall Rolltreppen gab, die einen nicht nur nach oben, sondern auch wohlbehalten und sicher wieder nach unten brachten. Das kam uns nur ganz recht.

Wie immer lag diese Sehenswürdigkeit in einer gepflegten Umgebung. Am Fuße stand ein kleiner Pavillon mit einer großen Glocke darin. Selbst von diesem Hügel aus konnte man schon das Meer sehen. Kein Wunder, wenn die Mauern auf dem Dach unserer Herberge nicht so hoch gewesen wären, hätte man auch von dort bis zum Meer sehen können. Um den Turm herum erstreckte sich ein Park, in dem man behutsam spazieren gehen konnte und in den Genuss von Schatten kam. Wir betrachteten den Turm nur von unten, doch wir besuchten bei der Gelegenheit auch das Busan Tourist Shopping Center, in dem sich sowohl Souvenirs als auch Infostand fanden. Schon beim Betreten des Ladens umwehte uns der Duft von Zahnarztpraxis, was bei mir nicht gerade zu rosiger Stimmung führte. Dennoch drehten wir eine Runde durch die Räumlichkeiten. Tatsächlich fand ich nichts, das meine Aufmerksamkeit für längere Zeit gefesselt hätte.


Dann flanierten wir gelassen durch den Park hinunter, um uns zumindest ein bisschen Bewegung zu gönnen. Wieder unten am Hügel angekommen begaben wir uns in die belebte Fußgängerzone, in der man allerlei kunterbunte Geschäfte, Marktstände und Straßenverkäufer antraf. Es war einfach nur erstaunlich. Selbst in Seoul hatten die Einkaufsstraßen nie so eng und voll gewirkt, obwohl mindestens ebenso viele Menschen unterwegs waren. Hier schienen die Massen einfach konzentrierter zu sein. Wir schlängelten uns durch die Menge, betrachteten die zahllosen Marktstände mit Socken, bevor wir wieder den Heimweg antraten.

Mit der Zeit gewöhnten wir uns auch in Busan ein und lernten bei der Gelegenheit, dass die Hostelkatze doch von einem anderen Stern war. Sie war sehr umgänglich, ließ sich viel gefallen und wehrte sich gegen kaum einen Besucher. Allerdings hatte sie doch eine ungewöhnliche Vorliebe: Sie mochte es ausgesprochen, wenn man ihr sanft auf den Hintern klopfte. Diese eine, kleine Stelle zwischen Schwanzansatz und Rücken war ihre Schwachstelle. Es ging so weit, dass sie begierig um mehr Hiebe bettelte, wenn man auch nur daran dachte kurz aufzuhören. Im Gegenzug belohnte sie ihre menschliche Assistenz damit, dass sie sie abschleckte.
Dank unserer hervorragenden Organisationsfähigkeiten sowie intensiven Netzwerkens nutzten wir die einmalige Gelegenheit Jelle wieder zu sehen. Wir hatten ihn in Franz Josef, Neuseeland, kennengelernt, in Christchurch noch einmal aufgesucht und festgestellt, dass er dieselbe Route zu nehmen gedachte, wie auch wir – allerdings umgekehrt. Er flog nach Tokio, zog dann nach Kyoto, Osaka, Busan und Seoul, bevor er weitere Staaten aufsuchte. Also beschlossen wir, dass es Zeit für ein Wiedersehen war. Nach langen und stellenweise schwierigen Verhandlungen fanden wir endlich einen Tag, der wie geschaffen war.
So zogen wir nach der Arbeit los, um Jelle zu treffen. Wir hatten uns an der Haltestelle der Metro verabredet, sogar den Ausgang genannt, aber dabei vergessen zu erwähnen, wo genau wir stehen würden. Also stolperten wir einige Zeit orientierungslos durch die Gegend, bis wir diesen auffälligen Blondling fanden. Wir unternahmen einen Ausflug in die Lotte Mall, um uns ein bisschen abzukühlen, zogen dann noch weiter durch die Straßen, aßen Bingsu und redeten allerlei wirres Zeug. Jelle war mit seiner bisherigen Reise sehr zufrieden, was wir selbstverständlich gerne hörten. Wir empfahlen ihm einige Sachen in Seoul und rieten von anderen ab. Abends aßen wir noch eine Kleinigkeit zusammen, was für den jungen Mann zu wenig war, weshalb er noch eine Portion Nudeln bekam. Es war ein sehr angenehmes Treffen.
Es ergab sich, dass wir zu Zeiten des Koreanischen Unabhängigkeitstages, 15. August, in Busan verweilten. Zu diesem Anlass hatte die Stadt nicht nur ihr Antlitz gewandelt, sondern auch diverse Veranstaltungen zur Feier des Tages auf die Beine gestellt. Überall fand man die koreanische Flagge, Lampions, Wimpel und dergleichen.

Am Vorabend des tatsächlichen Unabhängigkeitstages fand ein großes Feuerwerk im Hafen von Busan statt. Wir erfuhren recht kurzfristig davon, so dass wir uns sputen mussten, um noch rechtzeitig anzukommen. Von einem guten Platz war schon lange nicht mehr die Rede. Wir kamen rechtzeitig am Wasser an, um den Beginn des Feuerwerks zu sehen, aber leider konnte man wegen eines großen Schiffes nur wenig erkennen. Also zogen wir weiter auf der Suche nach einem besseren Standort.
Nach einigen Minuten hatten wir diesen gefunden und bestaunten mit vielen Koreanern das Spektakel. Koreaner haben wirklich die Angewohnheit ihr Staunen in lauten „Ohhs“ und „Aahs“ kundzutun – ungeachtet des Alters oder Geschlechts. Als es dann richtig losging, hatten wir einen annehmbaren Aussichtspunkt gefunden, so dass wir nicht viel verpassten.

Unzählige Feuerwerkskörper vertrieben die abendliche Dunkelheit mit ihrem bunten Glanz. Dort zischte eine Rakete in die Luft, gefolgt von einem Funkenregen. Es knallte laut. Einige dieser bunten Farbkugeln am Nachthimmel waren schlichtweg riesig, während andere ungewöhnlich waren. Da gab es die einfachen runden Bälle, die man schon gesehen hat. Es gab Ringe und Herzchen. Manche wechselten ihre Farbe nach der Explosion; andere bestanden sofort aus mehreren Farben. Groß neben klein, riesig gefolgt von winzig. Dazwischen fanden sich außergewöhnliche Exemplare, die wie goldene Wasserfälle vom Himmel fielen. Andere wiederum schlängelten sich auf die Zuschauerschaft hernieder, als wolle eine Schlange eine Wendeltreppe hinunterkriechen. Die nächsten wirkten wie ein verpixeltes impressionistisches Gemälde. In der Ferne sah man noch die Spitze von feurigen Fontänen.
Myriaden von Funken in verschiedenen Farben und Formen gesellten sich zu einem farbenprächtigen Tanz. Nach einer dreiviertel Stunde kam der glorreiche Höhepunkt, bei dem Farben, Formen und Intensitäten sich mischten. Es gab kein Entrinnen, der Himmel war taghell. Ein jeder Koreaner, der etwas auf sich hielt, machte Fotos oder gar Videos von dem Ereignis, getreu dem Motto: „Wenn ich es nicht festhalte, hat es nie stattgefunden.“ Einige Leute hielten die ganze Zeit über ihre Mobiltelefone in die Luft, um auch tatsächlich das ganze Schauspiel später mit Freunden und Verwandten zu teilen. Kaum, dass es zu Ende war, löste sich die Menge auch schon auf, und mit ihr zogen wir nach unserer Heimatstatt. Ein phantastischer Abend!
Der Grund, aus dem das Zusammenleben in Korea auch auf engstem Raum reibungslos funktionierte:

Der Platz wurde einfach den dummen Ausländern überlassen, während Koreaner sich mit einem Bett zufrieden gaben, das sie auch noch ordentlich hielten, hegten und pflegten. Vor allem männliche Vertreter dieser Spezies machten dies anstandslos. Insbesondere, wenn sie gerade erst aus dem Militärdienst entlassen worden waren oder gerade im Urlaub waren. Aus diesem Blickwinkel waren 9m² auf einmal ein Schloss mit mehreren Flügeln – insbesondere wenn man ein eigenes Badezimmer zur Verfügung hatte.
Es war wirklich entspannend, wie umgänglich die Jungs waren. Es gab einen Bereich in dem Achtbettzimmern, in dem man große Koffer abstellen konnte, aber außer uns Leuten aus dem Westen machte keiner davon Gebrauch. Wir mussten uns nie an irgendjemandem vorbeidrängeln, wir durften so viel Platz einnehmen wie wir wollten – wenn wir bereit waren den Preis dafür zu zahlen. Dieser bestand im Schminktisch. So lange wir den Jungs morgens genug Platz und Zeit ließen, sich für den Tag zurecht zu machen, durften wir den Rest des Zimmers in Anspruch nehmen. Aber auch hier war Vorsicht geboten, denn es konnte so weit ausarten, dass die Badezimmer für einen längeren Zeitraum nicht mehr zur Disposition standen. Das klingt jetzt besitzergreifender, als es tatsächlich war.
Denn auch in diesem Lebensbereich wussten die Koreaner mit ihren Ressourcen umzugehen, vor allem besagte Jungs. Da sie es nicht anders gewohnt waren, gingen sie gut und gerne in Grüppchen duschen. Als wir eines Abends oben in der geräumigen Küche saßen und uns unterhielten, wollten gerade zwei Jungs, die einen Tag zuvor aus dem Dienst entlassen worden waren, duschen gehen. Wie sie es nicht anders kannten, gingen sie zusammen in ein Badezimmer. Wir beobachteten das eher desinteressiert, denn schließlich hatten wir uns schon akklimatisiert und sahen diese nicht zum ersten Mal. Unseren Gast des Abends, Jelle, verwunderte dieses Verhalten allerdings in großem Maße, weshalb er seinem Erstaunen verbal Ausdruck verlieh. Franziska kommentierte dies nur mit den Worten: „As long as they are quiet, I don’t care what they do.“ („So lange sie ruhig sind, kümmert es mich nicht, was sie machen.“) Wir brachen allesamt in schallendes Gelächter aus.
In diesem Moment sah man Belles Gesicht an, dass die Rädchen in ihrem Gehirn sich langsam in Bewegung setzten. Es dauerte ein, zwei Sekunden, bis die Bedeutung von Franziskas Aussage bis zu ihrem Bewusstsein durchgedrungen war. Mit einem Mal weiteten sich die Augen unserer Gastgeberin, sie sprang hektisch auf, lief den Jungs hinterher, zerrte einen von ihnen am Arm durch die sich bereits schließende Badezimmertür und erklärte ihm, dass es noch ein Badezimmer auf der Etage gab, das gerade auch frei war. Pure Verständnislosigkeit stand in den Gesichtern der ehemaligen Soldaten geschrieben. Aber Belle bestand darauf, dass jeder ein anderes Badezimmer benutzte. Was für ein Anblick!
Während unseres Aufenthaltes in Busan spitzte sich die Lage zwischen Nord- und Südkorea zu. Südkoreanische Soldaten waren in der DMZ auf eine nordkoreanische Mine getreten, woraufhin es Schwerverwundete kam, was natürlich starke Emotionen hervorrief. Jedenfalls behauptete der Süden, dass die Mine in dem sonst sicheren Bereich aus dem Norden stammte. Auch darüber wurde lange Zeit gestritten. Der Süden nahm seine Beschallungsanlagen nach elf stillen Jahren wieder in Betrieb und ergötzte den Norden mit Wettervorhersagen und Popmusik, was von der Obrigkeit im Nachbarstaat mit Empörung entgegengenommen wurde. Hier lohnt sich zu erwähnen, dass die Bauern im Norden von solchen Kleinigkeiten wie einer Wettervorhersagte durchaus profitieren könnten, da sie nicht über die neuste Technik verfügten und es ihnen eventuell hätte helfen können. Vielleicht wurde dies bereits bei der DMZ-Tour deutlich. Über die Musik lässt sich natürlich streiten. Und über das Prinzip, denn darum ging es den Regierungen letzten Endes nur. Der Lautsprecher, von dem hier die Rede ist, wurde daraufhin mit Gewehrschüssen bedacht, Politiker stießen Drohungen aus, Eines führte zum Anderen, und letzten Endes saßen sich beide Seiten am Verhandlungstisch gegenüber, was weltweit mit Wohlwollen begrüßt und mit Spannung verfolgt wurde.
Auch wenn die Angelegenheit in den deutschen Medien aufgebauscht wurde, man sogar von südkoreanischer Propaganda sprach, Panzereinsätze hinzudichtete und eine atomare Eskalation an die Wand malte, bekamen wir in Busan wenig davon mit. Tatsächlich wurden uns die meisten Informationen von deutscher Seite zugespielt, was dazu führte, dass wir Belle nach dem tatsächlichen Ablauf und den Folgen für Südkorea fragten. Einige Soldaten mussten ihre Buchungen absagen, weil sie aus dem Urlaub zurückbeordert worden waren. Ansonsten ging das Leben normal weiter. Erstaunlicherweise machte man sich in Deutschland mehr Sorgen über den Verlauf der Ereignisse als in Korea. Mal davon abgesehen, dass die Berichterstattung stellenweise einfach nur falsch war.
Lotte Mall Gwangbok

Dann gab es noch die Lotte Mall Gwangbok, die hier in allen erdenklichen Einzelheiten aufgeführt werden muss. Nachdem ich den ein oder anderen Spaziergang durch diesen Koloss machen durfte, werde ich Arkaden nie wieder mit denselben Augen betrachten. Nicht einmal Paddy’s Market in Sydney konnte hier mithalten. Nimmt man dann auch noch ein deutsches Pendant dazu, fällt einem die Langeweile meines Heimatlandes erst so richtig auf. Beginnen wir doch am Anfang. Vorher erinnern wir uns nur kurz daran, dass Lotte nicht omnipräsent war.
Als wir die Lotte Mall zum ersten Mal betraten, nahmen wir den unterirdischen Eingang, der von der Metro Shopping Area direkt ins Untergeschoss dieses faszinierenden Gebäudekomplexes führte. Wir schritten durch blank polierte Glastüren mit verchromten und teils vergoldeten Griffen in ein turbulentes Menschengewusel, das sich in Seelenruhe hin und her bewegte. Aus verschiedenen Richtungen wehten unterschiedliche Düfte zu uns her, von denen jeder mir das Wasser im Munde hätte zusammenlaufen lassen, wenn ich nicht gerade erst gegessen hätte. Im diesem Geschoss fand man vor allem Restaurants und Essenstände.
Moment, das ist nicht ganz korrekt. Im Untergeschoss der Aqua Mall fand man diese. Hier lohnt sich eine detaillierte Beschreibung des Gebäudekomplexes Lotte Mall Gwanbok.
Die Lotte Mall Gwangbok bestand aus drei Gebäuden, die auf verschiedenen Ebenen miteinander verbunden waren und mit jeweils elf Etagen ein Shoppingerlebnis für jedermann boten. Es gab, wie bereits erwähnt, die Aqua Mall, dann noch den Department Store sowie das Entertainment Building. Jedes Gebäude hatte eine andere Form, Ausstattung und Einteilung. In diesem Komplex fand sich ungelogen alles, was man brauchte, suchte oder noch nicht kannte.
Es fing damit an, dass der einfache Supermarkt bereits vier Etagen des Entertainment Buildings einnahm. Zahlreiche Geschäfte mit der aktuellen Mode für jeden Stil und Geschmack gaben sich in der Aqua Mall die Hand. Abgewechselt wurde dies – selbstverständlich – durch Cafés und Restaurants, die manchmal nur eingestreut waren, um den Besucher zu einer kurzen Rast einzuladen, manchmal aber auch ganze Etagen in Anspruch nahmen, wie es beispielsweise im vierten oder zehnten Stock der Fall war.
Der Department Store bediente eher die großen Anliegen seiner Besucher. Ob es nun der Kauf der gesamten Wohnungseinrichtung war oder der Maßgeschneiderte Anzug, dies spielte hier eine untergeordnete Rolle. Natürlich gab es auch die Möglichkeit viele waren Duty Free zu bekommen. Internationalen Kunden standen zudem Wechselstube und Geldautomat zur Verfügung, um keine Schwierigkeiten beim Einkaufsspaß aufkommen zu lassen.
Das war bei weitem noch nicht alles. Für unausgelastete Kinder gab es einen Themenpark, in dem man die kleinen Störenfriede unter Aufsicht zurücklassen konnte. Für Erwachsene mit Bewegungsdrang fand sich ein Sportclub. Passend dazu gab es Sportbekleidungsgeschäfte verschiedener Firmen für unterschiedliche Zielgruppen. Nach solch einem anstrengenden Fitnessprogramm gab es doch nichts Besseres, als einen entspannenden Besuch in der Spa. Auch hierfür brauchte man das Gebäude nicht zu verlassen, denn es reichte eine Etage höher zu fahren. Einen Elektronikladen gab es natürlich auch.
Ergänzt wurde dieses Angebot vom kulturellen Teil Lottes, der eine Culture Hall, Galerien und Arbeitsräume für verschiedene Projektgruppen, wie beispielsweise Kochschule, Kunstklasse oder Handwerksraum, umfasste.
Darüber hinaus war es möglich diverse Ereignisse in der Lotte Mall zu zelebrieren, wofür man Eventhallen verschiedener Größen auf diversen Etagen bereitstellte. Mehr als ein junges Pärchen ließ seine Hochzeit in der Lotte Mall Gwangbok ausrichten.
Aber auch der einfachen Unterhaltung konnte vor Ort gefrönt werden: Das hauseigenen Lotte Kino erstreckte sich immerhin über vier Etagen. Ich habe vergessen, warum wir es nie aufsuchten. Es hätte ja nicht unbedingt die 8-Uhr-Vorstellung sein müssen.
Selbstverständlich war Lotte auch um das Wohlergehen seiner Kunden bedacht, weshalb sich einige Arztpraxen (Zahnarzt, Hausarzt, Arzt für orientalische Medizin, Schönheitschirurg) im Gebäude befanden. Richtig: Man konnte sich morgens die Augen vergrößern lassen und gleich danach den nächsten Blockbuster sehen, ohne nach draußen zu gehen.
Zahlreiche Rolltreppen und Aufzüge verbanden die einzelnen Etagen miteinander. Für koreanische Verhältnisse war es nicht wegzudenken, dass sich in jedem Stockwerk mehrere Toiletten und Wasserspender befanden. Die Toiletten verdienen hier eine eigene Erwähnung. In Korea (und vielen anderen Ländern außerhalb Deutschlands) haben die Behörden verstanden, dass es gewisse Bedürfnisse gibt, die der Mensch nicht ewig unterdrücken kann, weshalb man vielerorts saubere, geräumige, kostenlose Toiletten fand. Lotte versprach mehr! – und hielt sein Versprechen.
In der Lotte Mall Gwangbok waren die Toiletten nicht nur gepflegt und kostenlos, sondern auch noch stylisch. Jede Etage hatte ihren eigenen Stil mit verschiedenen Themen und unterschiedlicher, angepasster Musik. Schminktische mit großen Spiegeln waren allgegenwärtig; Wickeltische eine Selbstverständlichkeit. Selbst bei der Konzeption der Waschbecken hatte man sich etwas gedacht: Anstatt eines öden Wasserstrahls gab es in einigen Toiletten einen feinen Nebel, der auf die Hände gestäubt wurde. Wie dekadent!

Lotte wäre aber nicht Lotten, wenn das Unternehmen sich bereits hier zufriedengeben würde. Um das Programm zu vervollständigen und wirklich alle Kundenwunsche (bewusste oder unterbewusste) zu berücksichtigen, nutzte man auch das Flachdach der Mall gekonnt aus. Als wir durch die Tür auf die Dachterrasse gingen, wurden wir von einem Hain umfangen.

Eine hübsche Parklandschaft mit Zierpflanzen und Sitzgelegenheiten schuf eine Oase der Erholung inmitten einer Millionenmetropole. Für den rastlosen Geist gab es auch einen Zen-Garten.

Wir stiegen hinauf zum Beobachtungsdeck, das fast schon einen Rundumblick über die Gegend ermöglichte. Man sah den Busan Tower mit ihm umgebenden Park. Das Meer war nicht weit. Der Fischmarkt fast zum Greifen nah. Dort, wo man auf die Yeongdo Brücke hinuntersehen konnte, fand sich eine Bank, die diese Brücke darstellte – inklusive der aufgemalten Möwen.

Um den Besuchern auch in kalten oder nassen Zeiten ein angenehmes Klima zu bieten, das zum Verweilen einlud, gab es hier hoch oben über der Stadt ein Café mit spektakulärer Aussicht. Außerdem erfreute ein Kleintierzoo Besucher aller Altersklassen. Ja, dieses pflegeintensive Programm stellte Lotte kostenlos seinen Besuchern zur Verfügung.

Und dann gab es noch den Springbrunnen.
Auch für Unterhaltung in koreanischem Stil war in der Lotte Mall gesorgt. Die Aqua Mall verdiente ihren Namen nämlich zurecht aus folgendem Grund: Inmitten des Gebäudes stand der weltgrößte Indoor-Springbrunnen, eine Fontäne, die über vier Etagen ging. Während unten ein Planschbecken mit mehreren Fontänen Wasser in die Höhe schossen, fielen von oben Wasserstrahlen hinunter.

Manchmal bildete das Wasser nur einen Vorhang oder einfache Muster, die ineinander übergingen oder sich ergänzten, manchmal aber schrieben die Verantwortlichen auch diverse Sachen in die Luft. Den Höhepunkt bildete allerdings die Wassershow, die mehrmals täglich anzusehen war und ungefähr zehn Minuten dauerte. Eine Wand aus Wasser schob sich im Kreis umher, während Bilder auf sie projiziert wurden. Untermalt wurde das Ganze von klassischer Musik. Als wir es uns ansahen, lief gerade eine Ballettvorführung auf dem Wasservorhang. Ein weitsichtiger Mensch hatte zahlreiche Sitzgelegenheiten am Fuß der Fontäne aufstellen lassen.
In Busan ergab sich auch die Gelegenheit, einige koreanische Spezialitäten zu probieren, die mir in Seoul durch die Lappen gegangen waren. Ich werde klein anfangen.
Da meine Reisebegleitung entschieden weniger aß als meine Wenigkeit, kam es mehr als einmal vor, dass ich in die großen, menschendurchfluteten Straßen Busans zog, um nur eine Kleinigkeit für mich selbst zu erstehen. Wir kochten schon mittags zusammen, also war ich zu faul noch am Abend etwas zuzubereiten. Müsli fand ich nicht in der Preiskategorie, die ich als vertretbar ansah, so dass mir nicht viel anderes übrig blieb, als etwas zu kaufen. Das war gar nicht schlimm, denn das Essen war überall erschwinglich.
Als ich eines Abends hungrig, aber ziellos durch die Straßen schlenderte, um einen Snack vor der Nachtruhe zu mir zu nehmen, stolperte ich über einen ganz kleinen Verkaufsstand, der komische Bällchen verkaufte. Sie waren ungefähr so groß wie meine Faust und mit verschiedenen Zutaten gefüllt. Da ich nicht wusste, was auf mich zukam, beschloss ich einen sanften Anfang und kaufte nur eines dieser Bällchen, auch wenn es wahrscheinlich zu wenig für meinen gierigen Magen sein würde. Es stellte sich heraus, dass das eine Fehlentscheidung war.

Ich fand diesen Snack so lecker, dass ich in der kurzen Zeit unseres Aufenthaltes in Busan zu einem Stammkunden des Geschäfts wurde. Ich probierte auch alle Füllungen durch, was bei der geringen Auswahl schnell ging – nur das scharfe Zeug ließ ich aus. Franziska bestätigte mich in meiner Meinung. Da ich zumeist zu später Stunde an dem Laden vorbei ging und sie ihre Lebensmittel gerne loswerden wollten, bekam ich oft noch eine Kleinigkeit kostenlos dazu. Es gab also genug Leckereien für jeden Abend. Tatsächlich war ich am Boden zerstört, als ich an einem Abend an dem Geschäft vorbei ging, um festzustellen, dass sie gerade ihren freien Tag und somit geschlossen hatten. Stattdessen musste ich mir eine Alternative suchen. Ich probierte sogar einen anderen Stand aus, nur um festzustellen, dass diese Teigbällchen zwar auch lecker, aber doch so vollkommen anders waren. Letztere bestanden aus Fishcake, was bei meiner Reisebegleitung auf wenige Gegenliebe stieß.
Immer noch der Auffassung, dass am Spieß alles besser schmeckte, kaufte ich einmal Hähnchen am Spieß. Es war in irgendeiner leckeren Marinade, stark angebraten und triefte noch. Das war auch sehr lecker.
Belle und Zuska lehrten uns einiges in Sachen koreanischer Ernährung. Dass man mit wenigen Lebensmitteln im Kühlschrank sehr wohl ein schmackhaftes Mahl zubereiten konnte. Dass man Essig als Erfrischungsgetränk trinken konnte.

Dass kurz angebratener Gim mit einem Schuss Sojo eine hervorragende Ergänzung zu meinem täglichen Mittagessen darstellt. Franziska schaudert an dieser Stelle wahrscheinlich. Und dass man sehr wohl Kartoffeln mit Nudeln und Reis in einem Gericht verarbeiten kann.

Lotte nahm so einen geringen Stellenwert in Busan ein, dass wir fußläufig nur zwei Fastfood-Burger-Läden dieses Unternehmens, Lotteria genannt, erreichen konnten. Wie bereits in Sydney erwähnt war es uns ein persönliches Anliegen Burgerläden aus aller Welt auf Herz und Nieren zu prüfen. Eines Abends zogen wir also aus, um uns bei Lotteria gütlich zu tun. Wir waren gerade eh in der Lotte Mall, so dass der Weg nicht weit war, denn im Untergeschoss gab es eben diesen Laden. Lotteria wusste auch, wie man in Sachen Eigenwerbung den englischsprachigen Kunden den Kopf verdrehte.

Wie nicht anders zu erwarten, waren die Essgewohnheiten auch in Sachen Burger an den koreanischen Gaumen angepasst, so dass es tatsächlich einen Bulgogi-Burger gab. Wie hätten wir daran vorbeigehen können, ohne davon zu kosten? Diese Option gab es schlichtweg nicht.

In diesem Fall beschwerte ich mich nicht einmal über die Wartezeit, denn dieser Burger war wirklich lecker. Außerdem war es mal eine Abwechslung zu den europäischen Varianten, die ich bisher kannte.
Als wir mit Anneena in Seoul unterwegs waren, kamen wir an einem Stand vorbei, der Beondegi verkaufte. Die junge Dame wollte unsere Ekelgrenze testen und uns einen Becher von diesem in Europa doch eher ungewöhnlichem Snack andrehen. Wir lehnten dankend ab. Meinerseits hatte dies nicht das Geringste mit Abscheu zu tun, sondern ich war einfach nur pappsatt. Wie bereits erwähnt, waren wir kurze Zeit zuvor bei einem koreanischen Grill gemästet worden. In Busan ergab sich erneut die Gelegenheit an einem der zahlreichen Lebensmittelstände Beondegi zu holen. Dieses Mal wollte ich es wissen. Zur Erläuterung: Beondegi sind geschmorte Seidenraupenpuppen.

Der Kauf dieses Snacks war schon eine spannende Angelegenheit. Ich schlenderte gemütlich die Buden am Biff Plaza entlang, als mir dieser Stand mit eben diesem Snack ins Auge fiel. Einige Tage zuvor hatte Anneena mich noch damit reizen wollen. Dieses Mal wollte ich mir eine Portion holen. Es verwunderte mich ein wenig, dass der Verkäufer Beondegi und dünne Pommes Frites anbot, aber ich fragte nicht weiter nach. Leider sprach der Mann kein Wort Englisch, weshalb ich mich mit Handzeichen zu verständigen suchte. Es klappte. Allerdings verstand ich seine Antwort nicht. Das war für ihn auch kein großes Hindernis, denn er nahm einige Fritten und drückte sie mir in die Hand, obwohl ich sie nicht bestellt hatte. Verwirrt, aber mit meinem Einkauf zufrieden, ging ich wieder meines Weges – ins Hostel, um Franziska meine Ausbeute zu zeigen.
Sie war von meinem Fund genauso begeistert, wie ich es erwartet hatte. In diesem Moment dachte sie an Zuskas Worte, die unsere Mitarbeiterin schon einige Male gesprochen hatte: „Close your eyes and think of something nice.“ („Schließe die Augen und denke an etwas Schönes.“) Selbstverständlich zwang ich sie nicht mitzuessen. Stattdessen beobachtete sie mich bei meinem Abendmahl. Anfangs war ich ein bisschen skeptisch, weil dieser Snack doch eher außergewöhnlich für mich war, aber ich überwand meine Zweifel und spießte die erste Puppe auf. Es stellte sich heraus, dass Beondegi ein bisschen wie Schwein schmeckten, dabei allerdings wesentlich knuspriger waren. Der Clou waren aber wirklich die Fritten, die der Mann mir dazu gab. Damit schmeckten Beondegi richtig klasse. Außerdem sollte man immer ein Getränk dazu nehmen, weil dieser Snack erstaunlich trocken sein konnte, obwohl er im eigenen Saft schmorte. Nach etwas mehr als einem halben Becher stellte ich fest, dass ich nicht weiteressen konnte. Schließlich hatte ich es hier mit einer großen Portion Eiweiß zu tun und war in diesem Moment übersättigt.
Als ich mich eines Tages ziellos in die Weiten Busan’scher Straßen begab, stolperte ich über allerlei Kuriositäten. Es begann mit der Auskundschaftung der Einkaufsmöglichkeiten zwischen Metro-Station und Oberfläche. Wie sich herausstellte, war der gesamte Bereich von der Haltestelle, wo unser Hostel lag, bis zum Hauptbahnhof Busan unterirdisch begehbar. Es war ein langer Tunnel, der sich unter der Hauptverkehrsstraße hinzog. Um das ganze Gebilde ein bisschen aufzufrischen, gab es zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten, die verschiedene Waren anboten. Kleidung und Accessoires standen dabei deutlich im Vordergrund. Es gab aber auch genug auflockernde Elemente und Bänke, um geschundenen Füßen einen Moment der Ruhe zu gönnen. In einem Teil gab es sogar einen kleinen, künstlichen Garten, der nicht nur dem Körper, sondern auch dem Geist zur Entspannung verhalf.

Meine Neugier obsiegte und ich wollte wissen, wie weit ich kam, ohne nach oben gehen zu müssen. Schon bald änderte sich das Antlitz dieses Tunnels, offensichtlich trat ich in einen älteren Teil, denn die Wände wurden schmuckloser und enger, die Verkaufsstände hier waren nicht mehr integriert, sondern schnell aufgebaute Hütten. Dieser Teil lag näher am Zentrum der Stadt.
Als ich dann irgendwann doch noch an die Oberfläche stieg, um mir die Gegend anzusehen, entdeckte ich das Deutsche Gebäude. Es beherbergte das Goethe Institut, die Lufthansa und das Honorarkonsulat der BRD.

Es gab einige Punkte auf meiner Karte, die ich mir ansehen wollte, also zog ich relativ zielsicher weiter. Schnell bemerkte ich, dass die Karte größer wirkte, als die Stadt war; was ich für eine Wegstrecke von zehn Minuten hielt, absolvierte ich in drei. Ergo gemahnte ich mich zur Vorsicht, um die Sehenswürdigkeiten nicht zufällig zu verpassen. Meine Sorge erwies sich als vollkommen unberechtigt, denn mein Ziel war so prägnant, dass man schon hätte blind sein müssen, um es zu übersehen. Es handelte sich um das Eingangstor zu Chinatown.
Seit Sydney mit diesem Konzept bereits vertraut, erwartete ich ein spannendes Wirrwarr, das vor Leuten überquoll und mich in eine andere Welt eintauchen ließ. Aber es schien, dass ich zur falschen Stunde kam. So früh am Tag war nichts los. Gar nichts. Als ob die Straße noch schlafen würde. Tatsächlich bestand dieses Chinatown aus nur zwei kurzen Straßen, die sich kreuzten. An jedem Eingang war ein Tor, das den Bereich deutlich abgrenzte. Nichtsdestotrotz war es eine Abwechslung zu den restlichen Straßen Busans, die ich in den letzten Tagen gesehen hatte, denn man hatte sich Mühe mit dem Erscheinungsbild dieses kleinen Stadtteilausschnitts gegeben. Die Straße wand sich einer Schlage gleich den kleinen Hügel hoch, während an den Seiten sowie in der Mitte kleines Zierrat einen chinesischen Flair vermitteln sollten.

In der Mitte fand sich ein luftiger Pavillon, der das Nachbarland in stilvoller Weise darstellte. Als ich mich allerdings an der Kreuzung einmal um die eigene Achse drehte, stieg so langsam der Gedanke in mir auf, dass irgendetwas nicht so ganz koscher war. Seit mittlerweile sieben Wochen in Südkorea, machte ich mir nichts mehr draus, dass ich die meisten Schriftzüge nicht lesen konnte. Da Busan noch weniger auf Touristen eingestellt war als Seoul, hatte ich mich damit abgefunden, dass ich einfach meinem gesunden Menschenverstand – falls vorhanden – folgen musste. Egal, in welchem Land ich mich befand, hatte ich auch gewisse Ansprüche an die Schrift, die mir in Chinatown begegnen müsste: Schriftzeichen. Ich erwartete keineswegs, sie zu verstehen, ich wollte nur diese typischen Piktogramme sehen, die man aus dem Land der Mitte kennt. Aber hier stimmte etwas nicht. Nun nagte etwas an meinem Bewusstsein, eine undeutbare Unruhe befiel mich, etwas war definitiv nicht in Ordnung, bis es mir nach mehreren Minuten wie Schuppen von den Augen fiel: Die Schrift vor mir war kyrillisch.

Hier traf ich auf ein weiteres Mysterium, das Franziska immer noch lösen möchte: Wieso gibt es so viele Russen in Busan? Tatsächlich fiel es einem immer wieder auf, dass zahlreiche Geschäfte Hinweisschilder in russischer Sprache hatten, dass es die Touristenbroschüre auch auf Russisch gab, dass man immer wieder über russischsprachige Leute stolperte. Aber Chinatown war mit Abstand der krönende Abschluss.
Ich schlenderte weiter, weil ich auf dem Hinweg ein interessantes Gebäude gesehen hatte, das ich nun zu finden suchte. Es war nicht auf meiner Karte eingezeichnet, aber äußerst prägnant. Es sah aus wie ein überdimensionaler, mehrstöckiger chinesischer Palast – und das wollte ich mir nicht entgehen lassen. An diesem viel zu heißen Tag (jeder Tag in Südkorea war für meine Verhältnisse viel zu heiß, weshalb ich es nicht immer erwähnen möchte) stiefelte ich weiter durch die Gegend. Ich suchte nach kleinen Gassen und Verbindungsstraßen, die mich ungefähr in die Richtung brachten, in der ich das Gebäude vermutete. Fast die ganze Zeit über war es gut sichtbar, weil es offensichtlich auf einer Erhöhung stand. Ich erklomm Hügel, stolperte Treppen rauf und schlurfte Straßen entlang, bis ich endlich vor diesem Gebilde stand. Es stellte sich heraus, dass es ein Hotel war. Trotzdem schmuck anzusehen.

Auch wenn es ihrem Boss nicht sonderlich passte, hatte Belle auch freie Tage. Damit meine ich einen freien Tag in der Woche, der regelmäßig frei war. Ihr Chef äußerte sich tatsächlich verstimmt darüber, dass sie ihn wirklich nahm. Wie dem auch sei. Da kein Ersatz vorhanden war und keiner Aushilfsarbeitskraft so viel Verantwortung zugemutet werden konnte, lernten wir Belles Boss Ray kennen. Er war in Ordnung. Allerdings wurden wir nie richtig warm mit ihm. Er versuchte sich mit Small Talk, hatte gleichzeitig aber viel zu tun, weshalb sein Mobiltelefon manchmal klingelte. An diesem Tag waren wir auf uns alleine gestellt, weil er sich nicht um die Putzroutine kümmerte. Schließlich war er der Boss – oder so ähnlich. Da er keine Lust zu kochen hatte, bestellte er für uns alle ein Mittagsmahl, das aus Jjajamyeong bestand. Es sollte mir recht sein, denn das Essen war gut.
An Belles zweitem freien Tag während unseres Aufenthaltes war eine andere Vertretung da. Welche Rolle er einnahm, weiß ich nicht, jedenfalls war er uns nicht sonderlich sympathisch. Er sprach so gut wie gar nicht mit uns, stellte sich nicht einmal vor, und schien allgemein sehr von sich selbst überzeugt. Wir machten uns nicht die Mühe, ihn in irgendetwas zu involvieren.
Yeondo Brücke und Spaziergang durch die Kkangkkangi Straße
An einem anderen Tag begab ich mich auf eine Tour durch unsere Nachbarschaft. Die Broschüre empfahl einen Rundgang durch den Hafen, bei dem man die Yeongdo Brücke und die Werften sehen konnte. Die Brücke wurde einmal täglich gehoben, doch leider war dies zu unserer Arbeitszeit, weshalb sich keine Gelegenheit ergab, dieses Ereignis zu sehen.

Stattdessen spazierte ich nur einfach drüber und betrachtete die Gegend aus allen Winkeln. Auf der Fahrbahn der Brücke waren überdimensionale Möwen im Flug aufgemalt. Auf der anderen Seite fand sich eine Zeittafel, die die Entwicklung Busans innerhalb der letzten Jahrzehnte dokumentierte. Ich war wirklich erstaunt darüber, wie viel sich verändert hatte. Vor einem Jahrhundert war Busan noch ein armes, kärgliches Fischerdorf, doch heute stand hier eine Metropole mit wichtigen Industriestandorten und –betrieben.
Allerdings bot der Rundgang durch das Werftviertel nur wenige Sehenswürdigkeiten für mich. Ich versuchte der Route in meiner Broschüre so gut es ging zu folgen, aber aus Ermangelung an Straßennamen fand ich nicht immer den richtigen Weg. Letzten Endes weiß ich nicht, ob ich jemals am Yong Schrein vorbeigegangen war oder nicht, doch bewusst nahm ich ihn auf keinen Fall wahr. In meinen Augen war das Viertel unschön und trist. Allerdings gelang es mir einige sehenswerte Bilder vom Fischmarkt zu machen, da dieser direkt gegenüber war.

Außerdem bot sich mir ein phantastischer Blick auf die Lotte Mall von außen.

Was die restlichen Touren der Broschüre betraf, stellten wir fest, dass wir einige davon schon mehr oder weniger erledigt hatten, als wir ziellos durch die Straßen Busans geschlendert waren. Wir kannten den Hügel mit dem Busan Tower ebenso wie die umliegenden Einkaufsstraßen. Aus diesem Grund verzichteten wir auf eine weitere Begehung.
Wir fanden allerdings noch eine kleine Gasse, in der ausschließlich Buchläden zu finden waren.

Trick Eye Museum
Nicht weit von der Herberge entfernt fand sich das Trick Eye Museum, das wir gerne besuchen wollten. Wir teilten unser Anliegen Belle mit, die uns daraufhin einen wertvollen Schein ausstellte. Denn wir erfuhren von ihr, dass lange bleibende Kunden bei dieser Attraktion einen Rabatt bekommen konnten, wenn sie einen Beleg aus dem Hotel / Hostel mitbrachten. Das klang doch hervorragend, insbesondere weil der Rabatt wirklich ansehnlich war.
Also brachen wir in die Nachmittagshitze auf, um uns ein Bild von dieser viel umworbenen Sehenswürdigkeit zu machen. Es stellte sich heraus, dass wir dafür ins neunte Stockwerk fahren mussten.
Im Gegensatz zu vielen anderen Museen ist das Trick Eye Museum darauf ausgelegt, dass Fotos geschossen werden. Zahlreiche Fotos. Aus allen möglichen Perspektiven, aber vorzugsweise aus jener, die vorgegeben ist. Dahinter verbirgt sich ein lustiges Konzept. Es gibt verschiedene Kunstwerke, die auf Wände, Decken und Böden gemalt sind. Wenn man sich richtig hinstellt, also die richtige Perspektive einnimmt, kann man Teil des Kunstwerks werden. Natürlich müssen davon Beweisfotos geschossen werden, sonst ist es nur ein halber Spaß, denn man will diese Fotos Freunden und Verwandten zeigen. Einige Kunstwerke, von denen man Teil werden konnte, waren sogar dreidimensional.
Wir verbrachten einige lange Zeit in dem Museum, gingen dreimal durch, machten lustige Fotos von so gut wie jedem Ausstellungsstück – natürlich mit uns drin – und kehrten äußerst amüsiert ins Hostel zurück. Es war ein äußerst gelungener Ausflug.
Zurück zu Steve. Dieser junge Mann stieß einige Tage nach Zuskas Abfahrt zu uns. Er war ein Amerikaner vietnamesischer Herkunft, der in China Englisch lehrte und jetzt in Korea Urlaub machte. Entgegen seines stämmigen Erscheinungsbildes war er ein ruhiger und schüchterner Zeitgenosse, mit dem wir einen entspannten Umgang pflegten, auch wenn wir außerhalb der Arbeit nicht sonderlich viel mit ihm zu tun hatten. Mehr fällt mir zu ihm auch nicht ein.
Während unseres Aufenthaltes in Busan gab es eine Katastrophenübung. Ob das nun mit den Vorkommnissen im Norden zusammenhing oder eine bereits länger geplante Angelegenheit war, konnte niemand in Erfahrung bringen. Belle schien auch nicht sonderlich interessiert – in ihren Augen gehört das zum koreanischen Alltag. Jedenfalls sollte diese Übung auf den Ernstfall während einer drohenden Katastrophe jeglicher Art vorbereiten: Ob nun Erdbeben, Überschwemmungen, Tsunami, Terrorismus oder dritter Weltkrieg, die Koreaner wollten keiner Eventualität überrascht gegenüberstehen.
Als ich eins Tages die Treppe zur Rezeption runter ging, erklang ein schriller Signalton, der mich stark an Franz Josef erinnerte. Plötzlich bewegte sich draußen niemand mehr. Die Straßen wurden abgesperrt, die Kreuzungen blockiert. Es fuhr kein Auto mehr, die Fußgänger blieben stehen, wo sie gerade waren, auch wenn die Ampel gerade auf Grün umsprang, niemand verließ die Häuser oder Geschäfte. Falls es doch jemand wagte, diesem Verhalten zuwiderzuhandeln, gab es zahlreiche Männer in blassgelben Hemden (nein, sie trugen wirklich keine schrillen Warnwesten), die die Leute wieder an ihren Platz verwiesen. Besonders oft passierte das mit Autofahrern, die doch noch ein paar Meter weiterkommen wollten. Ich stand gebannt am Fenster und wartete darauf, dass etwas geschah. Sekunden schwollen zu Minuten an. Nichts. Die Minuten dehnten sich in die Länge. Nichts. So langsam wurde es langweilig. Belle gesellte sich zu mir und erklärte mir die Situation. Ich frage sie, was man als Otto Normalverbraucher in diesem Fall machen solle. Sie antwortete, dass sie selbst es nicht genau wisse. Noch mehr Parallelen zu Franz Josef machten sich in meinen Gedanken breit.
Dann, plötzlich, wie aus dem Nichts, fuhr ein einzelnes Polizeiauto in der Mitte der Straße entlang. Es macht nichts, es gab keine Durchsage, keine Sirenen, nur ein einsames Auto. Nachdem es vorbeigefahren war, passierte immer noch nichts. Einige Zeit später kam noch ein Auto, dann noch eins. Ob es immer wieder dasselbe war oder drei verschiedene, vermag ich nicht zu sagen. Ebenso wenig ist mir der Zweck dieser Vehikel erklärt worden. Ob sie nur prüften, dass jeder sich an die Vorschriften hielt oder die Leute mit den blassgelben Hemden kontrollierten, weiß ich nicht. Erst als der Van im Anschluss vorbeifuhr, gab es eine Entwarnung, die blassgelben Hemden zogen sich zurück, die Autos und Busse fuhren wieder an und Unmengen an Passanten strömten aus den Metroeingängen. Für einen langen Moment hatte Busan den Atem angehalten, jetzt durfte die Stadt wieder durchatmen.
Alles in allem war diese Übung äußerst friedfertig und ruhig verlaufen. Ich versuchte mir das gleiche Szenario in Köln auszumalen und lachte in mich hinein.
Es dauerte genau fünf Schritte, bis wir unsere Gastgeber vermissten und die Fahrt nach Busan bereuten.
Als Mahlzeit für zwischendurch besorgten wir uns Kimbap bei Mapu Mandu sowie einige Teilchen bei Tous les Jours. Darüber hinaus hatten wir noch einige Knabbereien. Gut gerüstet zogen wir also wieder in die große, weite Welt, um unseren Horizont zu erweitern und Neues zu erleben.
Fast schon selbstverständlich war alles hervorragend ausgeschildert: Zugnummer, Wagon und Sitzplatz standen auf unseren Fahrkarten (zu allem Überfluss hatte die Dame am Schalter die wichtigsten Informationen mit einem Buntstift eingekreist), während die Anzeige uns deutlich machte, wohin wir uns wenden mussten, um unseren Zug zu bekommen. Dieser war auch noch pünktlich.
Der Zug war wesentlich breiter als in Deutschland, wobei ich nur einen Vergleich mit einem Regionalexpress erstellen kann. Man hatte breite Sitze und genug Platz im Mittelgang. Auch Beinfreiheit war gegeben. Selbstverständlich war das Abteil klimatisiert, was bei 36° Außentemperatur zwingend erforderlich war.
Allerdings war die Klimaanlage den Gegebenheiten nicht so ganz gewachsen. Auf einem Abschnitt der Strecke, als der Wagon mit so vielen Menschen vollgepackt war, dass man nicht einmal mehr durch den Gang gehen konnte, ohne überall anzurempeln, merkte man zwar die sachte Brise, die von der Anlage ausging, sie brachte allerdings keinerlei Linderung. Letzten Endes musste eine Schaffnerin die Fahrgäste mit Fächern und kaltem Wasser versorgen. Trotzdem blieben alle Leute ruhig und gelassen. Zuvor war noch ein Mitarbeiter durch die Wagons gegangen und hatte eine Ansage gemacht, aber wir verstanden nicht genug davon, außer dem Wort für Wasser tatsächlich gar nichts. Er hätte uns auch eine Geschichte vom Reiher, der auf den Mond flog, erzählen können.
Vielleicht setzte er die Fahrgäste auch darüber in Kenntnis, warum der Zug doch unerwartet Verspätung hatte. An einer Haltestelle stand er fast dreißig Minuten, was den Zeitplan völlig durcheinander brachte. Bis Busan weitete sich diese Verzögerung auf fünfzig Minuten aus.
Die Strecke zwischen Seoul und Busan war allerdings recht sehenswert. Erst hier wurde uns deutlich, wie bergig das Land tatsächlich war, wodurch ich mich fragte, ob Seoul an der einzigen flachen Stelle innerhalb der Grenzen erbaut wurde. Es war hier so grün und unberührt, das es doch stark an Neuseeland erinnerte.

Trotz dieser widrigen Umstände kamen wir irgendwann endlich in unserer neuen Heimatstadt an. Hulk hatte uns den Weg zum Hostel in wenigen Worten erklärt, uns die Metrolinie genannt, mit der wir fahren mussten, den Haltestellennamen in Hangul aufgeschrieben und uns alle notwendigen Informationen mitgeliefert. Auf diese Weise fanden wir das Popcorn Hostel Nampo problemlos.
Mein erster Eindruck von Busan beschränkte sich auf die Fahr zur Herberge, so dass ich mir wie in einer Kleinstadt vorkam. Die Anzahl der Metrolinien war übersichtlich und die Strecken kurz. Aber schon zu Anfang wurde deutlich, dass Hupen in dieser 3,5 Millionenmetropole einen wesentlich größeren Stellenwert einnahm als in Seoul. Innerhalb von 100 Metern hatten wir so viele Leute hupen hören wie in drei Wochen in der Hauptstadt.
Im Hostel angekommen wurden wir freundlich von Belle und Zuska begrüßt, die von unserem bevorstehenden Aufenthalt wussten und unsere Namen errieten, bevor wir uns vorstellten. Weniger gesprächig war Mango, die Hostel eigene Perserkatze, die uns eher gelangweilte Blicke zuwarf, wenn sie sich überhaupt dazu herabließ, das gemeine Volk anzusehen. Sogleich führten die Damen uns in unser neues Zimmer.

Zuska war Tschechin, die ihren Urlaub nicht zum ersten Mal in Busan verbrachte. Sie war ein angenehmer Zeitgenosse, der gerne einen Spaß mitmachte und lustige Geschichten zu erzählen hatte. Ebenso reisefreudig wie wir hatte sie bereits zahlreiche Freunde außerhalb der Heimat. Sie war auch äußerst hilfreich, was die Verständigung betraf, denn im Gegensatz zu unserer Gastgeberin sprach sie fließend Englisch und ein bisschen Koreanisch. Allerdings hatten wir nur ein kurzes Vergnügen miteinander, da sie wenige Tage nach unserer Ankunft zu weiteren Abenteuern aufbrach. Zuerst führte sie ihre Reise nach Japan, bevor sie für eine Nacht zurückkam, um dann nach Seoul und schließlich in die Heimat zu fahren. An ihrer statt kam Steve. Dazu später mehr
Auch wenn die Treppe bei Hulk spektakulär war, so machte mir dieses Konstrukt, das die verschiedenen Stockwerke miteinander verband, wesentlich mehr zu schaffen. Die Stufen waren unterschiedlich hoch, einige waren schon ausgetreten, andere krumm und schief, so dass sie in verschiedenen Winkeln abfielen. Die eine Stufe fiel nach vorne ab, die nächste nach hinten, zwei Stufen weiter ging es nach links und irgendwann bestimmt auch nach rechts. Vielleicht war die Treppe als solche ausgeglichen und plan, aber das war nur dank eines Mittelwertes der einzelnen Stufen der Fall. Allein am ersten Tag stolperte ich zweimal über diese Hindernisse, und bin froh, dass nichts passierte. Ich machte es mir zur Priorität, die Stufen langsam zu begehen, insbesondere dann, wenn ich nur Arbeitslatschen trug.
Was mir am Popcorn Hostel besonders gefiel, war die Tatsache, dass man in den Räumen barfuß laufen durfte / musste. Am Eingang gab es ein kleines Treppchen, vor dem man gefälligst die Schuhe ausziehen musste. Somit blieben die Räume sauberer als mit Schuhen. Für empfindliche Besucher oder die kalte Jahreszeit stellte das Hostel Pantoffeln zur Verfügung. Ich liebe dieses Konzept und finde, dass es unbedingt in Deutschland eingeführt werden sollte.
Es gab dieses Mal keine Mitarbeiterquartiere, so dass wir gezwungen waren in einem Achtbettzimmer mit Gästen zu nächtigen. Glücklicherweise hatte ich noch keinen Koreaner getroffen, der laut schnarchte. Unglücklicherweise sollte sich das eben in Busan ändern. Aber nur ein unvorbereiteter Globetrotter macht sich ohne eine ausreichende Menge Ohrstöpsel auf den Weg.

Unser erster Arbeitstag begann um 12, was für mich nun wirklich viel zu spät war. Bis dahin hatte ich schon wieder Hunger und hätte viel lieber etwas gegessen, als erst mit dem Aufräumen anzufangen. Es änderte sich auch während unseres Aufenthaltes nicht. Was sich änderte, war meine Essgewohnheit, denn ich nahm einfach noch einen Snack direkt vor der Arbeit ein. Dies war besonders wichtig, weil die Arbeit hier mehr Zeit einnahm als im Inno Hostel.
Man merkte schnell, dass Hulk hier gelernt hatte. Die Putzroutine war ähnlich, aber in einigen Details dann doch anders. Allerdings verstehe ich bis heute nicht, was die Koreaner an Putzbürsten mit langen Stielen auszusetzen hatten. Um den Boden zu putzen mussten wir immer auf den Knien rumrobben, in der Hocke sein oder uns bücken. Gründlichkeit schön und gut, aber das gleiche Ergebnis hätten Borsten an einem langen Stiel gebracht.
Besonders schlimm war es mit einem Besen inklusive Handfeger, den man für die Treppen benutzen sollte. Der Besen hatte einen Stiel, ja, aber er war so kurz, dass sogar ein koreanisches Großmütterchen sich hätte bücken müssen, um damit fegen zu können. Es gibt so viel sinnvollere Erfindungen.
Ich verstand ebenso wenig, warum wir angehalten waren in Räumen zu putzen, die bereits sauber waren und von niemandem benutzt wurden. Die Türen waren zu, nicht einmal die Katze hatte eine Pfote hinein gesetzt. Aber es war nicht meine Aufgabe mit den vorherrschenden Strukturen zu brechen. Ebenso wenig Sinn ergab es, die Böden in den Bädern nach dem Schrubben trocken zu wischen, weil die Waschbecken in den Bädern keinen Abfluss hatten. Stattdessen tropfte das benutzte Wasser auf den gerade abgetrockneten Boden, um dann in den Abfluss zu fließen. Es war mir ein Rätsel. Hier zeigte sich aber deutlich, wieso es in koreanischen Badezimmern Badelatschen gab: Alles andere hätte zum einen einen Saustall hinterlassen, da es letzten Endes immer nass in ihnen war; zum anderen um keine nassen Füße zu bekommen, weil man in den Räumlichkeiten dieses Hostels eh nur in Socken ein durfte.
Was mir allerdings den Rest gab, war das hiesige Putzzeug. Schon nach fünf Minuten sehnte ich mich nach Two Ways zurück, denn was auch immer sie mir hier in einer weißen Sprühflasche servierten, es war wesentlich schlimmer. Giftig beschreibt es wahrscheinlich am besten. Bei dieser chemischen Wunderwaffe war es nicht einmal mehr nötig, das fein gestäubte Mittelchen versehentlich einzuatmen. Die Dämpfe allein reichten aus, um einen Elefanten umzuhauen. Wahrscheinlich war es pures Chlor oder so etwas Ähnliches. Ich fragte Belle nach einem Mundschutz, aber sie hatte keinen. Immerhin gab es Gummihandschuhe. Trotzdem brauchte ich nach jedem geputzten Badezimmer erst einmal frische Luft, um wieder einen klaren Kopf zu bekommen.
Zu unseren Aufgaben zählte es auch nun, die Bettdecken und –laken zu waschen und zum Trocknen aufzuhängen. Darin zeigte sich schon ein grober Fehler in der Planung, denn es gab nur zwei Waschmaschinen, die maximal drei Teile fassen konnten (sowohl die Decken als auch die Laken waren recht dick), und das bei rund 40 Betten, also 80 Teilen. Ein Waschgang dauerte ungefähr 20 Minuten, wobei die Maschinen stellenweise eine eigene Zeitrechnung an den Tag legten. Glücklicherweise gab es wenige Tage, an denen wir so viele Betten machen mussten, dass uns etwas ausging.
Ein besonders großes Problem stellten Regentage dar, weil wir dann einfach nicht in der Lage waren, Wäsche zu machen. Die Waschmaschinen standen auf dem Dach in einem kleinen Unterstand, während die Leinen zum Trocknen unter freiem Himmel waren. Dummerweise gab es auch keinen ausreichenden Vorrat, um auf diese Weise für Ersatz zu sorgen. In diesem Fall griffen wir auf die chemische Lösung zurück. Es war aber wirklich nur der letzte Ausweg. Es war auch deshalb ärgerlich, weil man an bewölkten Tagen auch immer darauf achten musste, ob es nun regnete oder nicht.
Ähnliche Probleme gab es mit den Handtüchern. Zum einen fand ich diese viel zu klein, auch wenn jeder Gast zwei erhielt. Sie waren nicht viel größer als ein DIN A4 Blatt. Jedenfalls führte diese Rechnung dazu, dass wesentliche mehr Handtücher verbraucht wurden. Die Wäsche der Handtücher übernahm ein externer Dienst, dessen Qualität mit jedem Tag mehr und mehr zu wünschen übrig ließ. Nicht nur, dass die Lieferung jeden Tag später kam, nein, manchmal gab uns der Lieferant auch das falsche Paket. Ende vom Lied war, dass wir an so manchem Tag ohne frische Handtücher standen. Ein Alptraum für jeden Douglas Adams-Fan.
Nachdem wir mit unseren Aufgaben fertig waren, stand die Vorbereitung des Essens im Vordergrund. Anders als in Seoul wurden wir hier nicht mit fertigen, köstlichen Mahlzeiten versorgt, sondern nur mit den Zutaten. Der Rest oblag uns. Manchmal mussten wir auch zuerst einkaufen. Wehmütig erinnerte ich mich an den Luxus der vergangenen Herberge. Insbesondere weil ich ohne Rezepte nur drei Sachen kochen kann: Curry, Pfannkuchen Chili con carne.
In erster Linie war Zuska unsere Ansprechpartnerin für alle Belange, was vor allem daran lag, dass sie wesentlich besser Englisch konnte als der durchschnittliche Koreaner. Aber auch weil sie schon seit einigen Wochen in dem Hostel tätig war und so oder so wusste, was wohin gehörte und was wo zu finden war. Auch wenn es um Besorgungen jeglicher Natur ging, kannte Zuska sich im Viertel aus. Sie wusste, wo der nächste, günstige Supermarkt war, wo man Delikatessen erstehen konnte und wo es Kuriositäten zu sehen gab. Auch bei der Planung von Besichtigungen rund um Touristenstandorte war sie eine große Hilfe.
Bereits am ersten Tag nahm sie mich in den nächsten Supermarkt mit, doch dieser war nicht, wie ich es erwartet hatte. Ich dachte an etwas im Stil von HomePlus, wurde aber von einer Mischung aus Basar und Rewe begrüßt. Während im Erdgeschoss Frischwaren feilgeboten wurden, fand man im ersten Stock alle abgepackten Lebensmittel sowie Haushaltsgegenstände. Unten gab es tatsächlich Verkäufer, die ihre Ware lautstark anpriesen, was auf mich sonderbar wirkt. Dann ergab sich für mich noch die Schwierigkeit, dass die meisten Sachen gar keine Übersetzung hatten, so dass ich doch ziemlich verloren durch die Gänge schlenderte. Selbstverständlich war ich darauf bedacht, meine Begleitung nicht aus den Augen zu lassen.
Biff-Plaza / Marktstände
Direkt gegenüber von unserem Hostel befand sich der Biff Plaza. Dies war eine große Fußgängerzone, die vor Geschäften und Straßenbuden nur so überquoll. Morgens kamen die Verkäufer langsam zu ihren Ständen, um dann allerlei skurrile Köstlichkeiten anzubieten. In den Boden waren die Handabdrücke bedeutender koreanischer Schauspieler mit ihren Unterschriften eingelassen. Nachts wurde der Platz in bunten Farben erleuchtet. Mehrere Bögen zierten einen Teil des Platzes, so dass man abends den Eindruck hatte, durch einen Regenbogen zu schlendern. Diesen schmückenden Umstand hatten wir dem Busan International Film Festival zu verdanken, für das die Stadt sich jedes Mal herausputzte und auch außerhalb der Zeit Touristen anlocken wollte.

Auch wenn ich kein großer Fan davon war, mir das Zimmer mit fünf Fremden zu teilen (drei der Betten waren schließlich von Personal belegt), ergaben sich dadurch ganz neue Möglichkeiten der Interaktion mit Einheimischen. Sie waren zumeist von äußerst kurzer Natur, aber das tat der Intensität dieser Begebenheiten keinen Abbruch. Davon abgesehen gab es nur wenige Tage, an denen dieses Zimmer voll belegt war.
Wir hatten einen Heidenspaß dabei, die erschrockenen Gesichter von Koreanern zu betrachten, weil sie uns sahen. Es war wirklich nicht mehr dabei. Wir saßen nach getaner Arbeit im Zimmer auf unseren Betten, machten unseren alltäglichen Kram und ab und zu kamen eben Kunden herein, um die Nacht mit uns in einem Zimmer zu verbringen. Jeder zweite Gast blieb in der Tür stehen, sah uns mit großen Kulleraugen an (wie Koreaner es eben konnten), verbeugte sich und schlurfte zu einem freien Bett. Aber es waren genau diese Leute, die sich nicht trauten, auch nur ein Wort mit uns zu wechseln. Es ging so weit, dass ich mich stellenweise unwohl fühlte.
Dann war da der Abend, an dem Kwan Min und Kwan Yun uns zu einer kleinen Feier einluden. Kwan Yun hatte gerade Urlaub von seinem Militärdienst bei der Luftwaffe und nutzte die Gelegenheit, um seinen jüngeren Bruder, Kwan Min, durch das Land zu schleifen. Beide schienen dabei viel Spaß zu haben. Aufgrund ihres doch nicht allzu hohen Budgets teilten sie sich das Zimmer mit uns. So kam abends Kwan Min hinein, um Franziska und mich nach unten ins Wohnzimmer einzuladen, wo die beiden gerade eine kleine Party anberaumten. Es dauerte allerdings einige Zeit, bis wir seine Intention verstanden, denn Kwan Min gab sich größte Mühe, Jae Won in seinem Englischkenntnissen zu unterbieten. Es gelang nur mäßig. Schließlich teilten wir dem Jungen mit, dass wir gleich zu ihnen stoßen würden, hier nur noch einige Kleinigkeiten abschließen wollten.
Es dauerte keine fünf Minuten, da war Kwan Min wieder im Zimmer. Ich bin mir nicht sicher, ob er uns nicht verstanden hatte, ob er glaubte, wir hätten ihn nicht verstanden oder ob unser „Gleich“ ihm einfach zu lange dauerte. Jedenfalls hielt er eine große, ganze Wassermelone vor der stolzgeschwellten Brust, aus der das Fruchtfleisch gekratzt worden war. Stattdessen gluckerte nun eine große Menge Sojo im Inneren der grünen Schale. Wir schickten den breit grinsenden Jungen raus, bevor wir ihm folgten. Unten warteten schon sein Bruder, Zusaka, Belle und noch ein weiblicher Gast auf uns.
Das Eis mit den Gebrüdern Kwan hatten wir gebrochen, als wir uns über Kwan Yuns Tattoo (das nicht permanent, sondern nur ein Aufkleber war) amüsiert äußerten, denn er hatte sich für die Worte „Gott ist tot“ entschieden. Er hingegen war aus dem Häuschen, dass er jemanden gefunden hatte, der es tatsächlich verstand. So kamen wir schnell ins holprige Gespräch. Ich rechne es allerdings jedem einzelnen Koreaner hoch an, dass die Leute sich tatsächlich Mühe gaben, mit ihren Touristen zu kommunizieren.
Bei der bevorstehenden Party versuchten uns unsere neu gewonnen koreanischen Freunde mit einigen einheimischen Trinkspielen vertraut zu machen. Es stellte sich allerdings schon bald heraus, dass ich sogar in nüchternem Zustand nicht in der Lage war, diese zu begreifen. Was auch immer wir machten, es klappte nicht. Es hatte irgendetwas mit klatschen und Namen zu tun oder mit Zahlen und ich war völlig durcheinander. Wahrscheinlich muss man damit großwerden, um es zu verinnerlichen. Ich gab schnell auf. Stattdessen holte irgendjemand ein Gesellschaftsspiel hervor. Es ging darum verschiedene Zutaten auf einer wackeligen Pizza zu platzieren, ohne dass der Haufen runterfiel. Auf dem Bild sah es sehr einfach aus, doch hatte ich nach kurzer Zeit das Gefühl, dass die Fotografen einen Pakt mit dem Teufel geschlossen hatten, um die Gesetze der Physik außer Kraft zu setzen. Das oder sie wussten mit Photoshop umzugehen. Jedenfalls gelang es uns nie so viel auf die Pizza zu legen, wie es auf dem Beispielbild war, obwohl wir einen versteckten Profi in unserer Mitte hatten.

Unsere Koreaner machten auch daraus ein Trinkspiel. Es gab auch einen kleinen Snack für Zwischendurch, auch wenn ich mich nicht mehr daran erinnere, was es war.
Wieder stießen wir auf blankes Unverständnis, als wir diesen Koreanern erklärten, dass man sich in Deutschland zu einem Bier zusammensetzen durfte, ohne dabei zu essen oder ein Spiel zu spielen.
Alles zusammen betrachtet nahm der Abend einen äußerst erheiternden Lauf. Die Koreanerin, die noch mit von der Partie war, war sogar so begeistert, dass sie uns zum Abschied drückte. Auch wenn die Kommunikation ein bisschen schwierig war, weil wir – wie so oft – nicht die gleiche Sprache sprachen, schafften wir es irgendwie einen bleibenden Eindruck bei ihr zu hinterlassen. Sie gab Franziska eine Gesichtsmaske, welche diese am selben Abend noch ausprobierte. Leider erlaubte meine Reisebegleitung mir nicht, ein Foto davon zu machen, da sie befürchtete, man würde sie mit einem Geist verwechseln. Zurecht!
Es gibt ein koreanisches Phänomen, das mich bis heute beschäftigt und königlich amüsiert: junge, männliche Koreaner. Sie sind in vielerlei Hinsicht so anders als ihre europäischen Pendants, dass ich es am Beispiel von Kwan Min deutlich machen will.
Als Kwan Min mit seinem Bruder das Hostel betrat, stolperten die beiden zwangsläufig über Mango, die sich gerade genüsslich vor dem Empfang räkelte. Während der ältere Bruder dank monatelanger Militärausbildung gerade noch so die Fassung bewahren konnte, tat sich der jüngere nicht den geringsten Zwang an. Es dauerte genau zwei Sekunden, bis er alle Hemmungen fallen ließ, mit seiner Stimme drei Oktaven nach oben sprang, so dass er sein zehn Jahre jüngeres Ich imitierte, große Kulleraugen bekam und sich freudestrahlend auf das pelzige Wollknäuel stürzte, um es ordentlich durch zu knuddeln. Hier möchte ich noch erwähnen, dass Kwan Min, obwohl schon 20, noch immer wie 14 aussah. Es war ein Bild, das mich ein bisschen perplex in der Gegend stehen ließ und gleichzeitig den Charakter junger Koreaner hervorragend einfing. Die sind nun einmal so. Egal ob Freude, Trauer oder Begeisterung, sie können ihre Gefühle einfach so ausleben. Einfach nur goldig.
Obwohl ich schon eine perfekte Geburtstagsüberraschungsparty in Seoul feiern durfte, fand mein tatsächlicher Geburtstag in Busan statt. Also galt es, diesen zu gestalten und in vollen Zügen zu genießen.
Er begann damit, dass ich mir an diesem Tag frei nahm. Frühstück ans Bett konnte ich wohl von niemandem erwarten, weil ich eh zuerst wach war. Ein bisschen schlecht fühlte ich mich schon, weil ich den Mädels nicht aus dem Weg gehen konnte, während sie putzten. Aber ich blieb stark, sah sie nur groß an, wenn sie um mich herum wuselten, und beschäftigte mich mit anderen Dingen.
Wir unternahmen einen kleinen Spaziergang durch das Viertel, suchten die Touristeninformation auf, in der die Mitarbeiter tatsächlich Englisch sprachen und uns helfen konnten, drehten einen Runde durch die belebte Fußgängerzone und statteten der Lotte Mall einen kurzen Besuch ab. (Wir erinnern uns hier noch einmal daran, dass Lotte nicht omnipräsent war.) Zurück ging es entlang des Fischmarktes, der allerlei lebendige Kuriositäten feilbot. Ein Oktopus wollte sich seinem Schicksal nicht kampflos geschlagen geben, krabbelte aus dem Wasserbecken, platschte auf den Boden und versuchte davon zu robben – bis die Verkäuferin ihn sah und gelassen wieder ins Becken beförderte. Auch wenn die Waren jetzt noch frisch waren und auf Eis lagen, waren wir uns sicher, dass wir sie bis zum Abend würden riechen können, weil wieder einmal mehr als 30° prophezeit worden waren.
Nachdem die Mädels ihre Arbeit getan hatten, stand Mittagessen auf dem Programm. Ich durfte mir etwas wünschen, also bestand ich auf Jjajangbap, das ich bisher nur einmal hatte, aber doch sehr schmackhaft fand. Wir riefen bei einem Lieferservice an, um zu bestellen, erfuhren aber, dass sie gerade Urlaub machten. Also ließ Belle uns ausziehen, damit wir in einem Restaurant zu meinem Wunschgericht kamen. Dort angekommen sagte man uns, dass sie nur Jjajangyeom hatten. Das ist dieselbe Sauce, aber auf Nudeln statt auf Reis. Wir stellten aber fest, dass sie Reis als Beilage anboten, weshalb Zuska es so drehte, dass man mir nur eine Portion der Sauce bracht und ich mir den Reis drunter mischen konnte. Es war den Köchen nicht ganz so lieb, aber sie spielten mit, was ich ihnen sehr hoch anrechne. Dazu bestellten wir eine mittlere Platte frittierter Schweinefleischstreifen. Es war ein köstliches Mahl.

Vollgefuttert rollten wir von dannen. Da die meisten ausländischen Filme in Südkorea mit Untertiteln unterlegt sind, steht einem Kinobesuch wenig im Wege. Allerdings wollten wir die Minions sehen und wussten nicht, wann die letzte Vorstellung lief. Immerhin war es ein Kinderfilm. Wir unternahmen einen Spaziergang zum Lotte Kino (Lotte ist nicht omnipräsent), nur um festzustellen, dass die einzige nicht synchronisierte Fassung um acht Uhr morgens lief. Aus dem Vorhaben wurde für heute nichts. (Aus dem Vorhaben wurde auch später nichts, weil es einfach unmöglich wurde, so viele Leute um diese frühe Uhrzeit aus dem Bett zu schütteln.)
Aber auf uns warteten noch andere Verpflichtungen. Nachdem wir über die Portion des Mittagessens hinweggekommen waren, machten wir uns auf den Weg in ein Café, um ein Geburtstagsbingsu zu verspeisen. Natürlich gab es so etwas nicht, weil man keinen Anlass braucht, um ein tolles Bingsu zu essen, aber es war mein Geburtstag, es war ein kunstvoll drapiertes Bingsu, also nenne ich es Geburtstagsbingsu. Ich entschied mich für ein schokoladenes Schokobingsu. Es war vorzüglich!

Auch wenn dies nicht nach besonders viel klingen mag, war es aus meiner Sicht ein hervorragender Geburtstag. Schmackhaftes Essen in Hülle und Fülle macht mich nun einmal glücklich. Und Bingsu krönt jeden Tag.
Unsere Gastgeberin Belle überraschte mich noch mit einem kleinen Geburtstagsgeschenk. Es war etwas, womit ich nichts anzufangen wusste, auch wenn die beigelegte Gebrauchsanweisung in Bildern international verständlich war. Es sah aus wie ein überdimensionales Pflaster, das man auf der Rückseite eines Mobiltelefons befestigen sollte. Zu diesem Zweck hatte dieser Gegenstand zwei Klebestreifen. Nachdem ich es also angebracht hatte, stand ich mit meinem neuerlangten Zierrat dar und wusste immer noch nicht ein noch aus. Als Belle meine Verwirrung sah, erklärte sie mir den Zweck dieses Gegenstandes. Wenn man dieses „Pflaster“, wie ich es unbeholfen nannte, aufklappte, hatte man ein praktisches Standbein für das Smartphone, so dass man es nicht die ganze Zeit halten musste, um beispielsweise ein Video zu sehen. Gleichzeitig konnte man es einklappen, wenn man es gerade nicht brauchte und so immer mit sich führen, ohne dass es im Weg war. Zur Körnung des ganzen Spaßes war es noch kunterbunt mit den Monstern aus dem Film Monster Universität übersät.

Eines Tages überraschte Zuska uns mit der Ankündigung, dass ein Freund von ihr sie hier im Hostel besuchen würde. Er bliebe nur eine Nacht, reiste dann weiter, was uns aber keinesfalls davon abhalten sollte, Spaß mit ihm zu haben. Diesen Freund hatte sie auf einer vorhergehenden Reise kennengelernt, denn auch er war nur Besucher in diesem Land. Sein Name war Masa und er kam aus Japan eingeflogen, um sich mit Zuska und weiteren Freunden zu treffen. Bei der Gelegenheit gab es eine kleine Feier – wahrscheinlich nur aus dem Grund, weil Koreaner gerne feierten und jeden Anlass dafür nutzten. Wir waren von Anfang an überrascht, wie gut Masas Englischkenntnisse waren. In vielerlei Hinsicht wirkte der junge Mann gar nicht japanisch, sondern weltgewandt.
Auch zu dieser Feier gesellte sich ein Koreaner, mit dem wir letzten Endes nichts anzufangen wussten. Er sprach kein einziges Wort mit uns, besorgte aber Essen für alle. Diese Haltung verwirrte mich in außergewöhnlichem Maß, doch ich lernte die Erklärung dafür schon bald. Zum einen ist es in Korea ganz selbstverständlich, dass Gäste etwas mit dem Manager eines Hostels teilen – und umgekehrt. Zum anderen konnte der Kerl nicht genug Englisch, um sich auch nur vorzustellen. Er versicherte Belle aber, dass er einen schönen Abend hatte und die Gesellschaft genoss. Uns blieb nichts anders übrig, als ihm zu glauben.
Während wir also in dieser illustren Runde saßen und ziemlich viel Zeugs ohne Sinn und Verstand erzählten, wurde auch viel Alkohol ausgeschenkt. Dieses Mal verzichteten die Leute aber auf Hochprozentiges und gaben sich mit Bier zufrieden. Allerdings war es mit einer drei Liter Plastikflasche nicht getan, weshalb man noch Nachschub holte. Sowohl Franziska als auch Zuska beschlossen, dass Koreaner kein Bier brauen konnten. Tags darauf verschwand Zuska; dieses Mal sahen wir sie nicht wieder.
Tatsächlich erkannten wir schnell, dass es einige Unterschiede zwischen Seoul und Busan gab, die sich nicht nur auf die Städte, sondern auch auf weitere Aspekte des Lebens ausdehnten. Beispielsweise sahen wir wesentlich mehr übergewichtige Leute hier im Süden als in der Hauptstadt. Darüber hinaus war Busan nicht so gut auf Touristen vorbereitet wie Seoul. Ja, es gab Touristeninformationen mit Broschüren in verschiedenen Sprachen. Aber es gab wesentlich weniger Ausländer und wesentlich weniger Personal, das zumindest einige Brocken Englisch sprach. Auch die Beschilderung war nicht immer in englischer Sprache vorhanden. Dafür fanden wir viele einfache Hinweisschilder an Läden, die in kyrillischer Schrift waren. Wir schafften es trotzdem immer uns zurechtzufinden und wurden von allen Leuten äußerst freundlich behandelt.
Anders als in Deutschland spielen Geister in der koreanischen Kultur bis heute eine wichtige Rolle, was vor allem mit dem Ahnenkult zusammenhängt. Geister zählen nicht zum Aberglauben, sondern sind Teil der Realität in Korea. Punkt. Es hat keinen Sinn mit Koreanern darüber zu diskutieren.
Das heißt nicht, dass es für einen Europäer nicht lustig sein kann, wenn man mal einen koreanischen Geist sieht und die Reaktion von Koreanern auf ihn beobachten darf.
Ich hatte das unvergessliche Privileg bei einem solchen Ereignis zugegen zu sein, das sich folgendermaßen zutrug. Auf dem Weg nach draußen schneite ich an der Rezeption vorbei, um mich nach dem Weg zu erkundigen und kurz abzumelden. Just in diesem Moment sah man auf der Überwachungskamera, wie die Tür des Dachzimmers aufging… und wieder zufiel. Drei gebannte Augenpaare, Belle und zwei Gäste, starrten mit offenen Kinnladen und Ausrufen des Unglaubens auf den Bildschirm. Daneben saß Zuska, gelassen, entspannt; ich stand noch in der Tür. Ausnahmslos alle Koreaner im Raum hielten dies für ein Werk von Geisterhand. Ich schob eher dem starken Wind die Schuld zu. Als ich mich anbot nach oben zu gehen, um die Tür fest zu schließen, schrie einer der Jungs tatsächlich, dass ich nicht gehen solle. Er hatte Angst, dass dort oben ein echter Geist sein Unwesen trieb und mir Böses wollte. Ich bin mir annähernd sicher, dass der junge Mann bereits eine Gänsehaut hatte. Ungeachtet seiner Zweifel bot ich Bell meine Hilfe nochmals an, weil ich nicht wollte, dass sie den ganzen Tag in Angst und Schrecken verbrachten. Nur widerwillig nahm unsere Gastgeberin dieses Angebot an. So stieg ich die Treppen aufs Dach hoch, um die Tür zu schließen. Ich hatte mir Geister gruseliger vorgestellt.
Die Sache mit den Geistern war uns schon in Seoul über den Weg gelaufen, allerdings in einem viel weiteren Ausmaß.
Franziska war dabei gewesen, als Jae Won einen Geist sah. Sie berichtete mir – nicht ohne einen gewissen amüsierten Unterton – wie der Junge an einem offen stehenden Raum vorbei gegangen war, irgendetwas aus dem Augenwinkel gesehen haben musste, wieder rückwärts zurückging, den Raum betrat, sich verwirrt umsah, wieder hinausging, um noch einmal rein zu gehen und dann Jae Woo von einem Geist berichtete. Jae Won soll dabei bleich geworden sein, denn der Raum war beide Male leer gewesen. Aber er wusste die Gestalt aus der anderen Welt genau zu beschreiben. Es war ein Mädchen mit langen, schwarzen Haaren, das vor einem der Betten gestanden haben soll. Jae Woo lachte ihn offen aus. Später versicherte Jae Won mir, dass er keine Angst vor Geistern hätte, was ich aufgrund dieses und anderer Ereignisse nicht so ganz glauben wollte. Aber das verrate ich dem Jungen nicht.
Ein anderes Mal als wir unten in der Lounge des Inno Hostels saßen, lief im Hintergrund ein Film – ein Horrorfilm mit Geistern. Wir sahen nur die Anfangsszene, bevor jemand sich erbarmte und umschaltete. Es ging um irgendeinen weiblichen Geist, der irgendwo in einem Badezimmer spukte. Nach dieser Szene traute sich unser Jüngster für die nächste Stunde nicht mehr aufs Klo, obwohl er genau deshalb aufgestanden war. Martin, der sich anbot mitzukommen, unterbreitete diesen Vorschlag wahrscheinlich nur, weil er sich verantwortlich fühlte. Ganz geheuer schien auch ihm die Sache nicht.
Hulk war ebenso einfach von Geistern zu beeindrucken. Um dem ganzen Spektakel noch die Krone aufzusetzen, sah er sich youtube-Videos mit Geistersichtungen an. Ich möchte hier noch einmal betonen, dass alle drei Kerle ehemalige Navy Seals der Koreanischen Armee waren. Das Argument, das man an dieser Stelle von vielen Koreanern hörte, war, dass man Geister ja nicht schlagen könne, weshalb man keine Möglichkeit habe, sich zur Wehr zu setzen. Erstaunlich logisch.
Busan Tower
Wir unternahmen einen Ausflug zum Busan Tower, der glücklicherweise nicht weit von unserer Herberge entfernt war. Glücklicherweise deshalb, weil das Wetter immer noch sommerlich war. Es war nur ein kurzer Marsch und ein noch kürzerer Aufstieg den Hügel hinauf, auf dem der Turm stand. Den Hügel zu erklimmen war allein deshalb besonders einfach, weil es überall Rolltreppen gab, die einen nicht nur nach oben, sondern auch wohlbehalten und sicher wieder nach unten brachten. Das kam uns nur ganz recht.

Wie immer lag diese Sehenswürdigkeit in einer gepflegten Umgebung. Am Fuße stand ein kleiner Pavillon mit einer großen Glocke darin. Selbst von diesem Hügel aus konnte man schon das Meer sehen. Kein Wunder, wenn die Mauern auf dem Dach unserer Herberge nicht so hoch gewesen wären, hätte man auch von dort bis zum Meer sehen können. Um den Turm herum erstreckte sich ein Park, in dem man behutsam spazieren gehen konnte und in den Genuss von Schatten kam. Wir betrachteten den Turm nur von unten, doch wir besuchten bei der Gelegenheit auch das Busan Tourist Shopping Center, in dem sich sowohl Souvenirs als auch Infostand fanden. Schon beim Betreten des Ladens umwehte uns der Duft von Zahnarztpraxis, was bei mir nicht gerade zu rosiger Stimmung führte. Dennoch drehten wir eine Runde durch die Räumlichkeiten. Tatsächlich fand ich nichts, das meine Aufmerksamkeit für längere Zeit gefesselt hätte.


Dann flanierten wir gelassen durch den Park hinunter, um uns zumindest ein bisschen Bewegung zu gönnen. Wieder unten am Hügel angekommen begaben wir uns in die belebte Fußgängerzone, in der man allerlei kunterbunte Geschäfte, Marktstände und Straßenverkäufer antraf. Es war einfach nur erstaunlich. Selbst in Seoul hatten die Einkaufsstraßen nie so eng und voll gewirkt, obwohl mindestens ebenso viele Menschen unterwegs waren. Hier schienen die Massen einfach konzentrierter zu sein. Wir schlängelten uns durch die Menge, betrachteten die zahllosen Marktstände mit Socken, bevor wir wieder den Heimweg antraten.

Mit der Zeit gewöhnten wir uns auch in Busan ein und lernten bei der Gelegenheit, dass die Hostelkatze doch von einem anderen Stern war. Sie war sehr umgänglich, ließ sich viel gefallen und wehrte sich gegen kaum einen Besucher. Allerdings hatte sie doch eine ungewöhnliche Vorliebe: Sie mochte es ausgesprochen, wenn man ihr sanft auf den Hintern klopfte. Diese eine, kleine Stelle zwischen Schwanzansatz und Rücken war ihre Schwachstelle. Es ging so weit, dass sie begierig um mehr Hiebe bettelte, wenn man auch nur daran dachte kurz aufzuhören. Im Gegenzug belohnte sie ihre menschliche Assistenz damit, dass sie sie abschleckte.
Dank unserer hervorragenden Organisationsfähigkeiten sowie intensiven Netzwerkens nutzten wir die einmalige Gelegenheit Jelle wieder zu sehen. Wir hatten ihn in Franz Josef, Neuseeland, kennengelernt, in Christchurch noch einmal aufgesucht und festgestellt, dass er dieselbe Route zu nehmen gedachte, wie auch wir – allerdings umgekehrt. Er flog nach Tokio, zog dann nach Kyoto, Osaka, Busan und Seoul, bevor er weitere Staaten aufsuchte. Also beschlossen wir, dass es Zeit für ein Wiedersehen war. Nach langen und stellenweise schwierigen Verhandlungen fanden wir endlich einen Tag, der wie geschaffen war.
So zogen wir nach der Arbeit los, um Jelle zu treffen. Wir hatten uns an der Haltestelle der Metro verabredet, sogar den Ausgang genannt, aber dabei vergessen zu erwähnen, wo genau wir stehen würden. Also stolperten wir einige Zeit orientierungslos durch die Gegend, bis wir diesen auffälligen Blondling fanden. Wir unternahmen einen Ausflug in die Lotte Mall, um uns ein bisschen abzukühlen, zogen dann noch weiter durch die Straßen, aßen Bingsu und redeten allerlei wirres Zeug. Jelle war mit seiner bisherigen Reise sehr zufrieden, was wir selbstverständlich gerne hörten. Wir empfahlen ihm einige Sachen in Seoul und rieten von anderen ab. Abends aßen wir noch eine Kleinigkeit zusammen, was für den jungen Mann zu wenig war, weshalb er noch eine Portion Nudeln bekam. Es war ein sehr angenehmes Treffen.
Es ergab sich, dass wir zu Zeiten des Koreanischen Unabhängigkeitstages, 15. August, in Busan verweilten. Zu diesem Anlass hatte die Stadt nicht nur ihr Antlitz gewandelt, sondern auch diverse Veranstaltungen zur Feier des Tages auf die Beine gestellt. Überall fand man die koreanische Flagge, Lampions, Wimpel und dergleichen.

Am Vorabend des tatsächlichen Unabhängigkeitstages fand ein großes Feuerwerk im Hafen von Busan statt. Wir erfuhren recht kurzfristig davon, so dass wir uns sputen mussten, um noch rechtzeitig anzukommen. Von einem guten Platz war schon lange nicht mehr die Rede. Wir kamen rechtzeitig am Wasser an, um den Beginn des Feuerwerks zu sehen, aber leider konnte man wegen eines großen Schiffes nur wenig erkennen. Also zogen wir weiter auf der Suche nach einem besseren Standort.
Nach einigen Minuten hatten wir diesen gefunden und bestaunten mit vielen Koreanern das Spektakel. Koreaner haben wirklich die Angewohnheit ihr Staunen in lauten „Ohhs“ und „Aahs“ kundzutun – ungeachtet des Alters oder Geschlechts. Als es dann richtig losging, hatten wir einen annehmbaren Aussichtspunkt gefunden, so dass wir nicht viel verpassten.

Unzählige Feuerwerkskörper vertrieben die abendliche Dunkelheit mit ihrem bunten Glanz. Dort zischte eine Rakete in die Luft, gefolgt von einem Funkenregen. Es knallte laut. Einige dieser bunten Farbkugeln am Nachthimmel waren schlichtweg riesig, während andere ungewöhnlich waren. Da gab es die einfachen runden Bälle, die man schon gesehen hat. Es gab Ringe und Herzchen. Manche wechselten ihre Farbe nach der Explosion; andere bestanden sofort aus mehreren Farben. Groß neben klein, riesig gefolgt von winzig. Dazwischen fanden sich außergewöhnliche Exemplare, die wie goldene Wasserfälle vom Himmel fielen. Andere wiederum schlängelten sich auf die Zuschauerschaft hernieder, als wolle eine Schlange eine Wendeltreppe hinunterkriechen. Die nächsten wirkten wie ein verpixeltes impressionistisches Gemälde. In der Ferne sah man noch die Spitze von feurigen Fontänen.
Myriaden von Funken in verschiedenen Farben und Formen gesellten sich zu einem farbenprächtigen Tanz. Nach einer dreiviertel Stunde kam der glorreiche Höhepunkt, bei dem Farben, Formen und Intensitäten sich mischten. Es gab kein Entrinnen, der Himmel war taghell. Ein jeder Koreaner, der etwas auf sich hielt, machte Fotos oder gar Videos von dem Ereignis, getreu dem Motto: „Wenn ich es nicht festhalte, hat es nie stattgefunden.“ Einige Leute hielten die ganze Zeit über ihre Mobiltelefone in die Luft, um auch tatsächlich das ganze Schauspiel später mit Freunden und Verwandten zu teilen. Kaum, dass es zu Ende war, löste sich die Menge auch schon auf, und mit ihr zogen wir nach unserer Heimatstatt. Ein phantastischer Abend!
Der Grund, aus dem das Zusammenleben in Korea auch auf engstem Raum reibungslos funktionierte:

Der Platz wurde einfach den dummen Ausländern überlassen, während Koreaner sich mit einem Bett zufrieden gaben, das sie auch noch ordentlich hielten, hegten und pflegten. Vor allem männliche Vertreter dieser Spezies machten dies anstandslos. Insbesondere, wenn sie gerade erst aus dem Militärdienst entlassen worden waren oder gerade im Urlaub waren. Aus diesem Blickwinkel waren 9m² auf einmal ein Schloss mit mehreren Flügeln – insbesondere wenn man ein eigenes Badezimmer zur Verfügung hatte.
Es war wirklich entspannend, wie umgänglich die Jungs waren. Es gab einen Bereich in dem Achtbettzimmern, in dem man große Koffer abstellen konnte, aber außer uns Leuten aus dem Westen machte keiner davon Gebrauch. Wir mussten uns nie an irgendjemandem vorbeidrängeln, wir durften so viel Platz einnehmen wie wir wollten – wenn wir bereit waren den Preis dafür zu zahlen. Dieser bestand im Schminktisch. So lange wir den Jungs morgens genug Platz und Zeit ließen, sich für den Tag zurecht zu machen, durften wir den Rest des Zimmers in Anspruch nehmen. Aber auch hier war Vorsicht geboten, denn es konnte so weit ausarten, dass die Badezimmer für einen längeren Zeitraum nicht mehr zur Disposition standen. Das klingt jetzt besitzergreifender, als es tatsächlich war.
Denn auch in diesem Lebensbereich wussten die Koreaner mit ihren Ressourcen umzugehen, vor allem besagte Jungs. Da sie es nicht anders gewohnt waren, gingen sie gut und gerne in Grüppchen duschen. Als wir eines Abends oben in der geräumigen Küche saßen und uns unterhielten, wollten gerade zwei Jungs, die einen Tag zuvor aus dem Dienst entlassen worden waren, duschen gehen. Wie sie es nicht anders kannten, gingen sie zusammen in ein Badezimmer. Wir beobachteten das eher desinteressiert, denn schließlich hatten wir uns schon akklimatisiert und sahen diese nicht zum ersten Mal. Unseren Gast des Abends, Jelle, verwunderte dieses Verhalten allerdings in großem Maße, weshalb er seinem Erstaunen verbal Ausdruck verlieh. Franziska kommentierte dies nur mit den Worten: „As long as they are quiet, I don’t care what they do.“ („So lange sie ruhig sind, kümmert es mich nicht, was sie machen.“) Wir brachen allesamt in schallendes Gelächter aus.
In diesem Moment sah man Belles Gesicht an, dass die Rädchen in ihrem Gehirn sich langsam in Bewegung setzten. Es dauerte ein, zwei Sekunden, bis die Bedeutung von Franziskas Aussage bis zu ihrem Bewusstsein durchgedrungen war. Mit einem Mal weiteten sich die Augen unserer Gastgeberin, sie sprang hektisch auf, lief den Jungs hinterher, zerrte einen von ihnen am Arm durch die sich bereits schließende Badezimmertür und erklärte ihm, dass es noch ein Badezimmer auf der Etage gab, das gerade auch frei war. Pure Verständnislosigkeit stand in den Gesichtern der ehemaligen Soldaten geschrieben. Aber Belle bestand darauf, dass jeder ein anderes Badezimmer benutzte. Was für ein Anblick!
Während unseres Aufenthaltes in Busan spitzte sich die Lage zwischen Nord- und Südkorea zu. Südkoreanische Soldaten waren in der DMZ auf eine nordkoreanische Mine getreten, woraufhin es Schwerverwundete kam, was natürlich starke Emotionen hervorrief. Jedenfalls behauptete der Süden, dass die Mine in dem sonst sicheren Bereich aus dem Norden stammte. Auch darüber wurde lange Zeit gestritten. Der Süden nahm seine Beschallungsanlagen nach elf stillen Jahren wieder in Betrieb und ergötzte den Norden mit Wettervorhersagen und Popmusik, was von der Obrigkeit im Nachbarstaat mit Empörung entgegengenommen wurde. Hier lohnt sich zu erwähnen, dass die Bauern im Norden von solchen Kleinigkeiten wie einer Wettervorhersagte durchaus profitieren könnten, da sie nicht über die neuste Technik verfügten und es ihnen eventuell hätte helfen können. Vielleicht wurde dies bereits bei der DMZ-Tour deutlich. Über die Musik lässt sich natürlich streiten. Und über das Prinzip, denn darum ging es den Regierungen letzten Endes nur. Der Lautsprecher, von dem hier die Rede ist, wurde daraufhin mit Gewehrschüssen bedacht, Politiker stießen Drohungen aus, Eines führte zum Anderen, und letzten Endes saßen sich beide Seiten am Verhandlungstisch gegenüber, was weltweit mit Wohlwollen begrüßt und mit Spannung verfolgt wurde.
Auch wenn die Angelegenheit in den deutschen Medien aufgebauscht wurde, man sogar von südkoreanischer Propaganda sprach, Panzereinsätze hinzudichtete und eine atomare Eskalation an die Wand malte, bekamen wir in Busan wenig davon mit. Tatsächlich wurden uns die meisten Informationen von deutscher Seite zugespielt, was dazu führte, dass wir Belle nach dem tatsächlichen Ablauf und den Folgen für Südkorea fragten. Einige Soldaten mussten ihre Buchungen absagen, weil sie aus dem Urlaub zurückbeordert worden waren. Ansonsten ging das Leben normal weiter. Erstaunlicherweise machte man sich in Deutschland mehr Sorgen über den Verlauf der Ereignisse als in Korea. Mal davon abgesehen, dass die Berichterstattung stellenweise einfach nur falsch war.
Lotte Mall Gwangbok

Dann gab es noch die Lotte Mall Gwangbok, die hier in allen erdenklichen Einzelheiten aufgeführt werden muss. Nachdem ich den ein oder anderen Spaziergang durch diesen Koloss machen durfte, werde ich Arkaden nie wieder mit denselben Augen betrachten. Nicht einmal Paddy’s Market in Sydney konnte hier mithalten. Nimmt man dann auch noch ein deutsches Pendant dazu, fällt einem die Langeweile meines Heimatlandes erst so richtig auf. Beginnen wir doch am Anfang. Vorher erinnern wir uns nur kurz daran, dass Lotte nicht omnipräsent war.
Als wir die Lotte Mall zum ersten Mal betraten, nahmen wir den unterirdischen Eingang, der von der Metro Shopping Area direkt ins Untergeschoss dieses faszinierenden Gebäudekomplexes führte. Wir schritten durch blank polierte Glastüren mit verchromten und teils vergoldeten Griffen in ein turbulentes Menschengewusel, das sich in Seelenruhe hin und her bewegte. Aus verschiedenen Richtungen wehten unterschiedliche Düfte zu uns her, von denen jeder mir das Wasser im Munde hätte zusammenlaufen lassen, wenn ich nicht gerade erst gegessen hätte. Im diesem Geschoss fand man vor allem Restaurants und Essenstände.
Moment, das ist nicht ganz korrekt. Im Untergeschoss der Aqua Mall fand man diese. Hier lohnt sich eine detaillierte Beschreibung des Gebäudekomplexes Lotte Mall Gwanbok.
Die Lotte Mall Gwangbok bestand aus drei Gebäuden, die auf verschiedenen Ebenen miteinander verbunden waren und mit jeweils elf Etagen ein Shoppingerlebnis für jedermann boten. Es gab, wie bereits erwähnt, die Aqua Mall, dann noch den Department Store sowie das Entertainment Building. Jedes Gebäude hatte eine andere Form, Ausstattung und Einteilung. In diesem Komplex fand sich ungelogen alles, was man brauchte, suchte oder noch nicht kannte.
Es fing damit an, dass der einfache Supermarkt bereits vier Etagen des Entertainment Buildings einnahm. Zahlreiche Geschäfte mit der aktuellen Mode für jeden Stil und Geschmack gaben sich in der Aqua Mall die Hand. Abgewechselt wurde dies – selbstverständlich – durch Cafés und Restaurants, die manchmal nur eingestreut waren, um den Besucher zu einer kurzen Rast einzuladen, manchmal aber auch ganze Etagen in Anspruch nahmen, wie es beispielsweise im vierten oder zehnten Stock der Fall war.
Der Department Store bediente eher die großen Anliegen seiner Besucher. Ob es nun der Kauf der gesamten Wohnungseinrichtung war oder der Maßgeschneiderte Anzug, dies spielte hier eine untergeordnete Rolle. Natürlich gab es auch die Möglichkeit viele waren Duty Free zu bekommen. Internationalen Kunden standen zudem Wechselstube und Geldautomat zur Verfügung, um keine Schwierigkeiten beim Einkaufsspaß aufkommen zu lassen.
Das war bei weitem noch nicht alles. Für unausgelastete Kinder gab es einen Themenpark, in dem man die kleinen Störenfriede unter Aufsicht zurücklassen konnte. Für Erwachsene mit Bewegungsdrang fand sich ein Sportclub. Passend dazu gab es Sportbekleidungsgeschäfte verschiedener Firmen für unterschiedliche Zielgruppen. Nach solch einem anstrengenden Fitnessprogramm gab es doch nichts Besseres, als einen entspannenden Besuch in der Spa. Auch hierfür brauchte man das Gebäude nicht zu verlassen, denn es reichte eine Etage höher zu fahren. Einen Elektronikladen gab es natürlich auch.
Ergänzt wurde dieses Angebot vom kulturellen Teil Lottes, der eine Culture Hall, Galerien und Arbeitsräume für verschiedene Projektgruppen, wie beispielsweise Kochschule, Kunstklasse oder Handwerksraum, umfasste.
Darüber hinaus war es möglich diverse Ereignisse in der Lotte Mall zu zelebrieren, wofür man Eventhallen verschiedener Größen auf diversen Etagen bereitstellte. Mehr als ein junges Pärchen ließ seine Hochzeit in der Lotte Mall Gwangbok ausrichten.
Aber auch der einfachen Unterhaltung konnte vor Ort gefrönt werden: Das hauseigenen Lotte Kino erstreckte sich immerhin über vier Etagen. Ich habe vergessen, warum wir es nie aufsuchten. Es hätte ja nicht unbedingt die 8-Uhr-Vorstellung sein müssen.
Selbstverständlich war Lotte auch um das Wohlergehen seiner Kunden bedacht, weshalb sich einige Arztpraxen (Zahnarzt, Hausarzt, Arzt für orientalische Medizin, Schönheitschirurg) im Gebäude befanden. Richtig: Man konnte sich morgens die Augen vergrößern lassen und gleich danach den nächsten Blockbuster sehen, ohne nach draußen zu gehen.
Zahlreiche Rolltreppen und Aufzüge verbanden die einzelnen Etagen miteinander. Für koreanische Verhältnisse war es nicht wegzudenken, dass sich in jedem Stockwerk mehrere Toiletten und Wasserspender befanden. Die Toiletten verdienen hier eine eigene Erwähnung. In Korea (und vielen anderen Ländern außerhalb Deutschlands) haben die Behörden verstanden, dass es gewisse Bedürfnisse gibt, die der Mensch nicht ewig unterdrücken kann, weshalb man vielerorts saubere, geräumige, kostenlose Toiletten fand. Lotte versprach mehr! – und hielt sein Versprechen.
In der Lotte Mall Gwangbok waren die Toiletten nicht nur gepflegt und kostenlos, sondern auch noch stylisch. Jede Etage hatte ihren eigenen Stil mit verschiedenen Themen und unterschiedlicher, angepasster Musik. Schminktische mit großen Spiegeln waren allgegenwärtig; Wickeltische eine Selbstverständlichkeit. Selbst bei der Konzeption der Waschbecken hatte man sich etwas gedacht: Anstatt eines öden Wasserstrahls gab es in einigen Toiletten einen feinen Nebel, der auf die Hände gestäubt wurde. Wie dekadent!

Lotte wäre aber nicht Lotten, wenn das Unternehmen sich bereits hier zufriedengeben würde. Um das Programm zu vervollständigen und wirklich alle Kundenwunsche (bewusste oder unterbewusste) zu berücksichtigen, nutzte man auch das Flachdach der Mall gekonnt aus. Als wir durch die Tür auf die Dachterrasse gingen, wurden wir von einem Hain umfangen.

Eine hübsche Parklandschaft mit Zierpflanzen und Sitzgelegenheiten schuf eine Oase der Erholung inmitten einer Millionenmetropole. Für den rastlosen Geist gab es auch einen Zen-Garten.

Wir stiegen hinauf zum Beobachtungsdeck, das fast schon einen Rundumblick über die Gegend ermöglichte. Man sah den Busan Tower mit ihm umgebenden Park. Das Meer war nicht weit. Der Fischmarkt fast zum Greifen nah. Dort, wo man auf die Yeongdo Brücke hinuntersehen konnte, fand sich eine Bank, die diese Brücke darstellte – inklusive der aufgemalten Möwen.

Um den Besuchern auch in kalten oder nassen Zeiten ein angenehmes Klima zu bieten, das zum Verweilen einlud, gab es hier hoch oben über der Stadt ein Café mit spektakulärer Aussicht. Außerdem erfreute ein Kleintierzoo Besucher aller Altersklassen. Ja, dieses pflegeintensive Programm stellte Lotte kostenlos seinen Besuchern zur Verfügung.

Und dann gab es noch den Springbrunnen.
Auch für Unterhaltung in koreanischem Stil war in der Lotte Mall gesorgt. Die Aqua Mall verdiente ihren Namen nämlich zurecht aus folgendem Grund: Inmitten des Gebäudes stand der weltgrößte Indoor-Springbrunnen, eine Fontäne, die über vier Etagen ging. Während unten ein Planschbecken mit mehreren Fontänen Wasser in die Höhe schossen, fielen von oben Wasserstrahlen hinunter.

Manchmal bildete das Wasser nur einen Vorhang oder einfache Muster, die ineinander übergingen oder sich ergänzten, manchmal aber schrieben die Verantwortlichen auch diverse Sachen in die Luft. Den Höhepunkt bildete allerdings die Wassershow, die mehrmals täglich anzusehen war und ungefähr zehn Minuten dauerte. Eine Wand aus Wasser schob sich im Kreis umher, während Bilder auf sie projiziert wurden. Untermalt wurde das Ganze von klassischer Musik. Als wir es uns ansahen, lief gerade eine Ballettvorführung auf dem Wasservorhang. Ein weitsichtiger Mensch hatte zahlreiche Sitzgelegenheiten am Fuß der Fontäne aufstellen lassen.
In Busan ergab sich auch die Gelegenheit, einige koreanische Spezialitäten zu probieren, die mir in Seoul durch die Lappen gegangen waren. Ich werde klein anfangen.
Da meine Reisebegleitung entschieden weniger aß als meine Wenigkeit, kam es mehr als einmal vor, dass ich in die großen, menschendurchfluteten Straßen Busans zog, um nur eine Kleinigkeit für mich selbst zu erstehen. Wir kochten schon mittags zusammen, also war ich zu faul noch am Abend etwas zuzubereiten. Müsli fand ich nicht in der Preiskategorie, die ich als vertretbar ansah, so dass mir nicht viel anderes übrig blieb, als etwas zu kaufen. Das war gar nicht schlimm, denn das Essen war überall erschwinglich.
Als ich eines Abends hungrig, aber ziellos durch die Straßen schlenderte, um einen Snack vor der Nachtruhe zu mir zu nehmen, stolperte ich über einen ganz kleinen Verkaufsstand, der komische Bällchen verkaufte. Sie waren ungefähr so groß wie meine Faust und mit verschiedenen Zutaten gefüllt. Da ich nicht wusste, was auf mich zukam, beschloss ich einen sanften Anfang und kaufte nur eines dieser Bällchen, auch wenn es wahrscheinlich zu wenig für meinen gierigen Magen sein würde. Es stellte sich heraus, dass das eine Fehlentscheidung war.

Ich fand diesen Snack so lecker, dass ich in der kurzen Zeit unseres Aufenthaltes in Busan zu einem Stammkunden des Geschäfts wurde. Ich probierte auch alle Füllungen durch, was bei der geringen Auswahl schnell ging – nur das scharfe Zeug ließ ich aus. Franziska bestätigte mich in meiner Meinung. Da ich zumeist zu später Stunde an dem Laden vorbei ging und sie ihre Lebensmittel gerne loswerden wollten, bekam ich oft noch eine Kleinigkeit kostenlos dazu. Es gab also genug Leckereien für jeden Abend. Tatsächlich war ich am Boden zerstört, als ich an einem Abend an dem Geschäft vorbei ging, um festzustellen, dass sie gerade ihren freien Tag und somit geschlossen hatten. Stattdessen musste ich mir eine Alternative suchen. Ich probierte sogar einen anderen Stand aus, nur um festzustellen, dass diese Teigbällchen zwar auch lecker, aber doch so vollkommen anders waren. Letztere bestanden aus Fishcake, was bei meiner Reisebegleitung auf wenige Gegenliebe stieß.
Immer noch der Auffassung, dass am Spieß alles besser schmeckte, kaufte ich einmal Hähnchen am Spieß. Es war in irgendeiner leckeren Marinade, stark angebraten und triefte noch. Das war auch sehr lecker.
Belle und Zuska lehrten uns einiges in Sachen koreanischer Ernährung. Dass man mit wenigen Lebensmitteln im Kühlschrank sehr wohl ein schmackhaftes Mahl zubereiten konnte. Dass man Essig als Erfrischungsgetränk trinken konnte.

Dass kurz angebratener Gim mit einem Schuss Sojo eine hervorragende Ergänzung zu meinem täglichen Mittagessen darstellt. Franziska schaudert an dieser Stelle wahrscheinlich. Und dass man sehr wohl Kartoffeln mit Nudeln und Reis in einem Gericht verarbeiten kann.

Lotte nahm so einen geringen Stellenwert in Busan ein, dass wir fußläufig nur zwei Fastfood-Burger-Läden dieses Unternehmens, Lotteria genannt, erreichen konnten. Wie bereits in Sydney erwähnt war es uns ein persönliches Anliegen Burgerläden aus aller Welt auf Herz und Nieren zu prüfen. Eines Abends zogen wir also aus, um uns bei Lotteria gütlich zu tun. Wir waren gerade eh in der Lotte Mall, so dass der Weg nicht weit war, denn im Untergeschoss gab es eben diesen Laden. Lotteria wusste auch, wie man in Sachen Eigenwerbung den englischsprachigen Kunden den Kopf verdrehte.

Wie nicht anders zu erwarten, waren die Essgewohnheiten auch in Sachen Burger an den koreanischen Gaumen angepasst, so dass es tatsächlich einen Bulgogi-Burger gab. Wie hätten wir daran vorbeigehen können, ohne davon zu kosten? Diese Option gab es schlichtweg nicht.

In diesem Fall beschwerte ich mich nicht einmal über die Wartezeit, denn dieser Burger war wirklich lecker. Außerdem war es mal eine Abwechslung zu den europäischen Varianten, die ich bisher kannte.
Als wir mit Anneena in Seoul unterwegs waren, kamen wir an einem Stand vorbei, der Beondegi verkaufte. Die junge Dame wollte unsere Ekelgrenze testen und uns einen Becher von diesem in Europa doch eher ungewöhnlichem Snack andrehen. Wir lehnten dankend ab. Meinerseits hatte dies nicht das Geringste mit Abscheu zu tun, sondern ich war einfach nur pappsatt. Wie bereits erwähnt, waren wir kurze Zeit zuvor bei einem koreanischen Grill gemästet worden. In Busan ergab sich erneut die Gelegenheit an einem der zahlreichen Lebensmittelstände Beondegi zu holen. Dieses Mal wollte ich es wissen. Zur Erläuterung: Beondegi sind geschmorte Seidenraupenpuppen.

Der Kauf dieses Snacks war schon eine spannende Angelegenheit. Ich schlenderte gemütlich die Buden am Biff Plaza entlang, als mir dieser Stand mit eben diesem Snack ins Auge fiel. Einige Tage zuvor hatte Anneena mich noch damit reizen wollen. Dieses Mal wollte ich mir eine Portion holen. Es verwunderte mich ein wenig, dass der Verkäufer Beondegi und dünne Pommes Frites anbot, aber ich fragte nicht weiter nach. Leider sprach der Mann kein Wort Englisch, weshalb ich mich mit Handzeichen zu verständigen suchte. Es klappte. Allerdings verstand ich seine Antwort nicht. Das war für ihn auch kein großes Hindernis, denn er nahm einige Fritten und drückte sie mir in die Hand, obwohl ich sie nicht bestellt hatte. Verwirrt, aber mit meinem Einkauf zufrieden, ging ich wieder meines Weges – ins Hostel, um Franziska meine Ausbeute zu zeigen.
Sie war von meinem Fund genauso begeistert, wie ich es erwartet hatte. In diesem Moment dachte sie an Zuskas Worte, die unsere Mitarbeiterin schon einige Male gesprochen hatte: „Close your eyes and think of something nice.“ („Schließe die Augen und denke an etwas Schönes.“) Selbstverständlich zwang ich sie nicht mitzuessen. Stattdessen beobachtete sie mich bei meinem Abendmahl. Anfangs war ich ein bisschen skeptisch, weil dieser Snack doch eher außergewöhnlich für mich war, aber ich überwand meine Zweifel und spießte die erste Puppe auf. Es stellte sich heraus, dass Beondegi ein bisschen wie Schwein schmeckten, dabei allerdings wesentlich knuspriger waren. Der Clou waren aber wirklich die Fritten, die der Mann mir dazu gab. Damit schmeckten Beondegi richtig klasse. Außerdem sollte man immer ein Getränk dazu nehmen, weil dieser Snack erstaunlich trocken sein konnte, obwohl er im eigenen Saft schmorte. Nach etwas mehr als einem halben Becher stellte ich fest, dass ich nicht weiteressen konnte. Schließlich hatte ich es hier mit einer großen Portion Eiweiß zu tun und war in diesem Moment übersättigt.
Als ich mich eines Tages ziellos in die Weiten Busan’scher Straßen begab, stolperte ich über allerlei Kuriositäten. Es begann mit der Auskundschaftung der Einkaufsmöglichkeiten zwischen Metro-Station und Oberfläche. Wie sich herausstellte, war der gesamte Bereich von der Haltestelle, wo unser Hostel lag, bis zum Hauptbahnhof Busan unterirdisch begehbar. Es war ein langer Tunnel, der sich unter der Hauptverkehrsstraße hinzog. Um das ganze Gebilde ein bisschen aufzufrischen, gab es zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten, die verschiedene Waren anboten. Kleidung und Accessoires standen dabei deutlich im Vordergrund. Es gab aber auch genug auflockernde Elemente und Bänke, um geschundenen Füßen einen Moment der Ruhe zu gönnen. In einem Teil gab es sogar einen kleinen, künstlichen Garten, der nicht nur dem Körper, sondern auch dem Geist zur Entspannung verhalf.

Meine Neugier obsiegte und ich wollte wissen, wie weit ich kam, ohne nach oben gehen zu müssen. Schon bald änderte sich das Antlitz dieses Tunnels, offensichtlich trat ich in einen älteren Teil, denn die Wände wurden schmuckloser und enger, die Verkaufsstände hier waren nicht mehr integriert, sondern schnell aufgebaute Hütten. Dieser Teil lag näher am Zentrum der Stadt.
Als ich dann irgendwann doch noch an die Oberfläche stieg, um mir die Gegend anzusehen, entdeckte ich das Deutsche Gebäude. Es beherbergte das Goethe Institut, die Lufthansa und das Honorarkonsulat der BRD.

Es gab einige Punkte auf meiner Karte, die ich mir ansehen wollte, also zog ich relativ zielsicher weiter. Schnell bemerkte ich, dass die Karte größer wirkte, als die Stadt war; was ich für eine Wegstrecke von zehn Minuten hielt, absolvierte ich in drei. Ergo gemahnte ich mich zur Vorsicht, um die Sehenswürdigkeiten nicht zufällig zu verpassen. Meine Sorge erwies sich als vollkommen unberechtigt, denn mein Ziel war so prägnant, dass man schon hätte blind sein müssen, um es zu übersehen. Es handelte sich um das Eingangstor zu Chinatown.
Seit Sydney mit diesem Konzept bereits vertraut, erwartete ich ein spannendes Wirrwarr, das vor Leuten überquoll und mich in eine andere Welt eintauchen ließ. Aber es schien, dass ich zur falschen Stunde kam. So früh am Tag war nichts los. Gar nichts. Als ob die Straße noch schlafen würde. Tatsächlich bestand dieses Chinatown aus nur zwei kurzen Straßen, die sich kreuzten. An jedem Eingang war ein Tor, das den Bereich deutlich abgrenzte. Nichtsdestotrotz war es eine Abwechslung zu den restlichen Straßen Busans, die ich in den letzten Tagen gesehen hatte, denn man hatte sich Mühe mit dem Erscheinungsbild dieses kleinen Stadtteilausschnitts gegeben. Die Straße wand sich einer Schlage gleich den kleinen Hügel hoch, während an den Seiten sowie in der Mitte kleines Zierrat einen chinesischen Flair vermitteln sollten.

In der Mitte fand sich ein luftiger Pavillon, der das Nachbarland in stilvoller Weise darstellte. Als ich mich allerdings an der Kreuzung einmal um die eigene Achse drehte, stieg so langsam der Gedanke in mir auf, dass irgendetwas nicht so ganz koscher war. Seit mittlerweile sieben Wochen in Südkorea, machte ich mir nichts mehr draus, dass ich die meisten Schriftzüge nicht lesen konnte. Da Busan noch weniger auf Touristen eingestellt war als Seoul, hatte ich mich damit abgefunden, dass ich einfach meinem gesunden Menschenverstand – falls vorhanden – folgen musste. Egal, in welchem Land ich mich befand, hatte ich auch gewisse Ansprüche an die Schrift, die mir in Chinatown begegnen müsste: Schriftzeichen. Ich erwartete keineswegs, sie zu verstehen, ich wollte nur diese typischen Piktogramme sehen, die man aus dem Land der Mitte kennt. Aber hier stimmte etwas nicht. Nun nagte etwas an meinem Bewusstsein, eine undeutbare Unruhe befiel mich, etwas war definitiv nicht in Ordnung, bis es mir nach mehreren Minuten wie Schuppen von den Augen fiel: Die Schrift vor mir war kyrillisch.

Hier traf ich auf ein weiteres Mysterium, das Franziska immer noch lösen möchte: Wieso gibt es so viele Russen in Busan? Tatsächlich fiel es einem immer wieder auf, dass zahlreiche Geschäfte Hinweisschilder in russischer Sprache hatten, dass es die Touristenbroschüre auch auf Russisch gab, dass man immer wieder über russischsprachige Leute stolperte. Aber Chinatown war mit Abstand der krönende Abschluss.
Ich schlenderte weiter, weil ich auf dem Hinweg ein interessantes Gebäude gesehen hatte, das ich nun zu finden suchte. Es war nicht auf meiner Karte eingezeichnet, aber äußerst prägnant. Es sah aus wie ein überdimensionaler, mehrstöckiger chinesischer Palast – und das wollte ich mir nicht entgehen lassen. An diesem viel zu heißen Tag (jeder Tag in Südkorea war für meine Verhältnisse viel zu heiß, weshalb ich es nicht immer erwähnen möchte) stiefelte ich weiter durch die Gegend. Ich suchte nach kleinen Gassen und Verbindungsstraßen, die mich ungefähr in die Richtung brachten, in der ich das Gebäude vermutete. Fast die ganze Zeit über war es gut sichtbar, weil es offensichtlich auf einer Erhöhung stand. Ich erklomm Hügel, stolperte Treppen rauf und schlurfte Straßen entlang, bis ich endlich vor diesem Gebilde stand. Es stellte sich heraus, dass es ein Hotel war. Trotzdem schmuck anzusehen.

Auch wenn es ihrem Boss nicht sonderlich passte, hatte Belle auch freie Tage. Damit meine ich einen freien Tag in der Woche, der regelmäßig frei war. Ihr Chef äußerte sich tatsächlich verstimmt darüber, dass sie ihn wirklich nahm. Wie dem auch sei. Da kein Ersatz vorhanden war und keiner Aushilfsarbeitskraft so viel Verantwortung zugemutet werden konnte, lernten wir Belles Boss Ray kennen. Er war in Ordnung. Allerdings wurden wir nie richtig warm mit ihm. Er versuchte sich mit Small Talk, hatte gleichzeitig aber viel zu tun, weshalb sein Mobiltelefon manchmal klingelte. An diesem Tag waren wir auf uns alleine gestellt, weil er sich nicht um die Putzroutine kümmerte. Schließlich war er der Boss – oder so ähnlich. Da er keine Lust zu kochen hatte, bestellte er für uns alle ein Mittagsmahl, das aus Jjajamyeong bestand. Es sollte mir recht sein, denn das Essen war gut.
An Belles zweitem freien Tag während unseres Aufenthaltes war eine andere Vertretung da. Welche Rolle er einnahm, weiß ich nicht, jedenfalls war er uns nicht sonderlich sympathisch. Er sprach so gut wie gar nicht mit uns, stellte sich nicht einmal vor, und schien allgemein sehr von sich selbst überzeugt. Wir machten uns nicht die Mühe, ihn in irgendetwas zu involvieren.
Yeondo Brücke und Spaziergang durch die Kkangkkangi Straße
An einem anderen Tag begab ich mich auf eine Tour durch unsere Nachbarschaft. Die Broschüre empfahl einen Rundgang durch den Hafen, bei dem man die Yeongdo Brücke und die Werften sehen konnte. Die Brücke wurde einmal täglich gehoben, doch leider war dies zu unserer Arbeitszeit, weshalb sich keine Gelegenheit ergab, dieses Ereignis zu sehen.

Stattdessen spazierte ich nur einfach drüber und betrachtete die Gegend aus allen Winkeln. Auf der Fahrbahn der Brücke waren überdimensionale Möwen im Flug aufgemalt. Auf der anderen Seite fand sich eine Zeittafel, die die Entwicklung Busans innerhalb der letzten Jahrzehnte dokumentierte. Ich war wirklich erstaunt darüber, wie viel sich verändert hatte. Vor einem Jahrhundert war Busan noch ein armes, kärgliches Fischerdorf, doch heute stand hier eine Metropole mit wichtigen Industriestandorten und –betrieben.
Allerdings bot der Rundgang durch das Werftviertel nur wenige Sehenswürdigkeiten für mich. Ich versuchte der Route in meiner Broschüre so gut es ging zu folgen, aber aus Ermangelung an Straßennamen fand ich nicht immer den richtigen Weg. Letzten Endes weiß ich nicht, ob ich jemals am Yong Schrein vorbeigegangen war oder nicht, doch bewusst nahm ich ihn auf keinen Fall wahr. In meinen Augen war das Viertel unschön und trist. Allerdings gelang es mir einige sehenswerte Bilder vom Fischmarkt zu machen, da dieser direkt gegenüber war.

Außerdem bot sich mir ein phantastischer Blick auf die Lotte Mall von außen.

Was die restlichen Touren der Broschüre betraf, stellten wir fest, dass wir einige davon schon mehr oder weniger erledigt hatten, als wir ziellos durch die Straßen Busans geschlendert waren. Wir kannten den Hügel mit dem Busan Tower ebenso wie die umliegenden Einkaufsstraßen. Aus diesem Grund verzichteten wir auf eine weitere Begehung.
Wir fanden allerdings noch eine kleine Gasse, in der ausschließlich Buchläden zu finden waren.

Trick Eye Museum
Nicht weit von der Herberge entfernt fand sich das Trick Eye Museum, das wir gerne besuchen wollten. Wir teilten unser Anliegen Belle mit, die uns daraufhin einen wertvollen Schein ausstellte. Denn wir erfuhren von ihr, dass lange bleibende Kunden bei dieser Attraktion einen Rabatt bekommen konnten, wenn sie einen Beleg aus dem Hotel / Hostel mitbrachten. Das klang doch hervorragend, insbesondere weil der Rabatt wirklich ansehnlich war.
Also brachen wir in die Nachmittagshitze auf, um uns ein Bild von dieser viel umworbenen Sehenswürdigkeit zu machen. Es stellte sich heraus, dass wir dafür ins neunte Stockwerk fahren mussten.
Im Gegensatz zu vielen anderen Museen ist das Trick Eye Museum darauf ausgelegt, dass Fotos geschossen werden. Zahlreiche Fotos. Aus allen möglichen Perspektiven, aber vorzugsweise aus jener, die vorgegeben ist. Dahinter verbirgt sich ein lustiges Konzept. Es gibt verschiedene Kunstwerke, die auf Wände, Decken und Böden gemalt sind. Wenn man sich richtig hinstellt, also die richtige Perspektive einnimmt, kann man Teil des Kunstwerks werden. Natürlich müssen davon Beweisfotos geschossen werden, sonst ist es nur ein halber Spaß, denn man will diese Fotos Freunden und Verwandten zeigen. Einige Kunstwerke, von denen man Teil werden konnte, waren sogar dreidimensional.
Wir verbrachten einige lange Zeit in dem Museum, gingen dreimal durch, machten lustige Fotos von so gut wie jedem Ausstellungsstück – natürlich mit uns drin – und kehrten äußerst amüsiert ins Hostel zurück. Es war ein äußerst gelungener Ausflug.
Zurück zu Steve. Dieser junge Mann stieß einige Tage nach Zuskas Abfahrt zu uns. Er war ein Amerikaner vietnamesischer Herkunft, der in China Englisch lehrte und jetzt in Korea Urlaub machte. Entgegen seines stämmigen Erscheinungsbildes war er ein ruhiger und schüchterner Zeitgenosse, mit dem wir einen entspannten Umgang pflegten, auch wenn wir außerhalb der Arbeit nicht sonderlich viel mit ihm zu tun hatten. Mehr fällt mir zu ihm auch nicht ein.
Während unseres Aufenthaltes in Busan gab es eine Katastrophenübung. Ob das nun mit den Vorkommnissen im Norden zusammenhing oder eine bereits länger geplante Angelegenheit war, konnte niemand in Erfahrung bringen. Belle schien auch nicht sonderlich interessiert – in ihren Augen gehört das zum koreanischen Alltag. Jedenfalls sollte diese Übung auf den Ernstfall während einer drohenden Katastrophe jeglicher Art vorbereiten: Ob nun Erdbeben, Überschwemmungen, Tsunami, Terrorismus oder dritter Weltkrieg, die Koreaner wollten keiner Eventualität überrascht gegenüberstehen.
Als ich eins Tages die Treppe zur Rezeption runter ging, erklang ein schriller Signalton, der mich stark an Franz Josef erinnerte. Plötzlich bewegte sich draußen niemand mehr. Die Straßen wurden abgesperrt, die Kreuzungen blockiert. Es fuhr kein Auto mehr, die Fußgänger blieben stehen, wo sie gerade waren, auch wenn die Ampel gerade auf Grün umsprang, niemand verließ die Häuser oder Geschäfte. Falls es doch jemand wagte, diesem Verhalten zuwiderzuhandeln, gab es zahlreiche Männer in blassgelben Hemden (nein, sie trugen wirklich keine schrillen Warnwesten), die die Leute wieder an ihren Platz verwiesen. Besonders oft passierte das mit Autofahrern, die doch noch ein paar Meter weiterkommen wollten. Ich stand gebannt am Fenster und wartete darauf, dass etwas geschah. Sekunden schwollen zu Minuten an. Nichts. Die Minuten dehnten sich in die Länge. Nichts. So langsam wurde es langweilig. Belle gesellte sich zu mir und erklärte mir die Situation. Ich frage sie, was man als Otto Normalverbraucher in diesem Fall machen solle. Sie antwortete, dass sie selbst es nicht genau wisse. Noch mehr Parallelen zu Franz Josef machten sich in meinen Gedanken breit.
Dann, plötzlich, wie aus dem Nichts, fuhr ein einzelnes Polizeiauto in der Mitte der Straße entlang. Es macht nichts, es gab keine Durchsage, keine Sirenen, nur ein einsames Auto. Nachdem es vorbeigefahren war, passierte immer noch nichts. Einige Zeit später kam noch ein Auto, dann noch eins. Ob es immer wieder dasselbe war oder drei verschiedene, vermag ich nicht zu sagen. Ebenso wenig ist mir der Zweck dieser Vehikel erklärt worden. Ob sie nur prüften, dass jeder sich an die Vorschriften hielt oder die Leute mit den blassgelben Hemden kontrollierten, weiß ich nicht. Erst als der Van im Anschluss vorbeifuhr, gab es eine Entwarnung, die blassgelben Hemden zogen sich zurück, die Autos und Busse fuhren wieder an und Unmengen an Passanten strömten aus den Metroeingängen. Für einen langen Moment hatte Busan den Atem angehalten, jetzt durfte die Stadt wieder durchatmen.
Alles in allem war diese Übung äußerst friedfertig und ruhig verlaufen. Ich versuchte mir das gleiche Szenario in Köln auszumalen und lachte in mich hinein.
... link (0 Kommentare) ... comment
Sonntag, 24. Januar 2016
Kleinigkeiten, Teil II
atimos, 10:18h
* Es gab sehr wenige Vögel in Seoul. Man sah einige Spatzen und Tauben, aber damit hate es sich dann auch. Dafür gab es jede Menge Libellen. Wenn man morgens früh aufstand, konnte man sie fast schon in Schwärmen betrachten.
*Einparken war in Seoul Millimeterarbeit, die jeder mit einem Führerschein im Schlaf zu beherrschen schien. Nicht nur, dass die Wagen wie von Zauberhand gerade so dicht an einer Wand standen, dass der Fahrer noch irgendwie aussteigen konnte, nein, sie hatten auch keine Kratzer. Die Autos der Seoler waren ebenso Statussymbole wie in Deutschland. Da wurde geputzt, poliert, gepflegt und rücksichtsvoll gefahren. Es spielte auch keine Rolle, ob es Männlein oder Weiblein war, denn beide Geschlechter konnten gleichermaßen den engen Raum ausnutzen.
* Vorfahrt hatte derjenige, der sie sich nahm. Autos blieben auf Fußgängerüberwegen stehen, sie drängelten sich in eine kleine Lücke, sie zwängten sich zwischen Passanten hindurch. Trotzdem schienen alle Verkehrsteilnehmer die Situation gelassen zu nehmen.
* Seoul ist ein Beweis dafür, dass man in einer Millionenstadt keine Fußgängerwege braucht. Außerhalb der Hauptverkehrsstraßen sind Bürgersteige nur sehr selten anzutreffen – man hat keinen Platz dafür.
* Internet nimmt in Südkorea einen sehr wichtigen Stellenwert ein. So wichtig, dass es gut und gerne passieren kann, dass mal irgendwo in der Stadt plötzlich einen kostenlosen Wlan Hotspot hat. In den U-Bahnstationen sowie -wagons gibt es zudem Router, damit die Kunden zahlender Mobilfunkunternehmen auch brav weiterhin Empfang haben, wenn sie tief unter der Erde unterwegs sind.

* Als Moped-, Mofa- oder Motorradfahrer durfte man tun und lassen, was man wollte. Dies war zumindest bisher mein Eindruck. Sie fuhren in falscher Richtung durch eine Einbahnstraße (während die Polizei daneben stand), fuhren über den Bürgersteig, fuhren, trotz hohen Verkehrsaufkommens, quer über mehrere Spuren, fuhren bei Rot über die Ampel und blieben dann irgendwo stehen. Das schien niemanden zu kümmern.
* Koreaner schienen aus Zucker gemacht. Anders weiß ich diese panische Angst bei Regen, selbst in kleinsten Mengen, nicht zu erklären. Wenn es anfing zu regnen, machten einige clevere Geschäftemacher mal eben einen Verkaufsstand an einem Ausgang der U-Bahnstation auf und verdienten ordentlich Geld damit, Regenschirme zu verkaufen. Für all jene, denen das allerdings zu teuer war, blieb noch die Option lange genug im Untergrund zu bleiben, bis der Regen ganz aufgehört hatte.
* In Korea konnte man, obwohl die Koreaner ein ganz anderes Buchstabensystem verwenden, das europäische Alphabet nicht vergessen. Es war allgegenwärtig. Viele Läden trugen europäische Namen, wie beispielsweise Tous les Jours, Paris Baguette, Ediya Café. Einige Läden führten parallel Hangul und das europäische Alphabet.
* Betten sind in Korea härter als in Deutschland. Tatsächlich sind sie nur ein bisschen weicher als eine Joga-Matte auf einem Holzboden. Nach den viel zu weichen Matratzen in Neuseeland waren diese gepolsterten Bretter eine wahre Wohltat für jeden geschundenen Rücken. Ich habe lange nicht mehr so gut geschlafen.
* Nicht nur die Neuseeländer sind stolz auf ihre einheimischen Betriebe, auch das Label Made in Korea ist weit verbreitet – in Korea. Es ist nicht ganz so aufdringlich wie in Neuseeland, aber doch vorhanden. Die Seouler gehen so weit, es auf ihre Gullideckel zu drucken.

* Korea hat die Sommerzeit abgeschafft, wofür ich es liebe.
* Die Steckdosen in Korea sind den deutschen gleich. Das macht Reisen sehr einfach, denn man braucht keinen Adapter. Auch die Spannung ist gleich, so dass man seine elektronischen Geräte schnell und einfach geladen bekommt. Es gibt für gewöhnlich auch überall genug Steckdosen.
* Koreanische Toiletten und Toilettenpapier desselben Landes vertragen sich nicht so ganz. Tatsächlich ist es nicht möglich, das Papier runterzuspülen, weil man dann akut Gefahr läuft, dass es zu einer Verstopfung kommt. Stattdessen findet man in jedem Badezimmer große Mülleimer.
*Einparken war in Seoul Millimeterarbeit, die jeder mit einem Führerschein im Schlaf zu beherrschen schien. Nicht nur, dass die Wagen wie von Zauberhand gerade so dicht an einer Wand standen, dass der Fahrer noch irgendwie aussteigen konnte, nein, sie hatten auch keine Kratzer. Die Autos der Seoler waren ebenso Statussymbole wie in Deutschland. Da wurde geputzt, poliert, gepflegt und rücksichtsvoll gefahren. Es spielte auch keine Rolle, ob es Männlein oder Weiblein war, denn beide Geschlechter konnten gleichermaßen den engen Raum ausnutzen.
* Vorfahrt hatte derjenige, der sie sich nahm. Autos blieben auf Fußgängerüberwegen stehen, sie drängelten sich in eine kleine Lücke, sie zwängten sich zwischen Passanten hindurch. Trotzdem schienen alle Verkehrsteilnehmer die Situation gelassen zu nehmen.
* Seoul ist ein Beweis dafür, dass man in einer Millionenstadt keine Fußgängerwege braucht. Außerhalb der Hauptverkehrsstraßen sind Bürgersteige nur sehr selten anzutreffen – man hat keinen Platz dafür.
* Internet nimmt in Südkorea einen sehr wichtigen Stellenwert ein. So wichtig, dass es gut und gerne passieren kann, dass mal irgendwo in der Stadt plötzlich einen kostenlosen Wlan Hotspot hat. In den U-Bahnstationen sowie -wagons gibt es zudem Router, damit die Kunden zahlender Mobilfunkunternehmen auch brav weiterhin Empfang haben, wenn sie tief unter der Erde unterwegs sind.

* Als Moped-, Mofa- oder Motorradfahrer durfte man tun und lassen, was man wollte. Dies war zumindest bisher mein Eindruck. Sie fuhren in falscher Richtung durch eine Einbahnstraße (während die Polizei daneben stand), fuhren über den Bürgersteig, fuhren, trotz hohen Verkehrsaufkommens, quer über mehrere Spuren, fuhren bei Rot über die Ampel und blieben dann irgendwo stehen. Das schien niemanden zu kümmern.
* Koreaner schienen aus Zucker gemacht. Anders weiß ich diese panische Angst bei Regen, selbst in kleinsten Mengen, nicht zu erklären. Wenn es anfing zu regnen, machten einige clevere Geschäftemacher mal eben einen Verkaufsstand an einem Ausgang der U-Bahnstation auf und verdienten ordentlich Geld damit, Regenschirme zu verkaufen. Für all jene, denen das allerdings zu teuer war, blieb noch die Option lange genug im Untergrund zu bleiben, bis der Regen ganz aufgehört hatte.
* In Korea konnte man, obwohl die Koreaner ein ganz anderes Buchstabensystem verwenden, das europäische Alphabet nicht vergessen. Es war allgegenwärtig. Viele Läden trugen europäische Namen, wie beispielsweise Tous les Jours, Paris Baguette, Ediya Café. Einige Läden führten parallel Hangul und das europäische Alphabet.
* Betten sind in Korea härter als in Deutschland. Tatsächlich sind sie nur ein bisschen weicher als eine Joga-Matte auf einem Holzboden. Nach den viel zu weichen Matratzen in Neuseeland waren diese gepolsterten Bretter eine wahre Wohltat für jeden geschundenen Rücken. Ich habe lange nicht mehr so gut geschlafen.
* Nicht nur die Neuseeländer sind stolz auf ihre einheimischen Betriebe, auch das Label Made in Korea ist weit verbreitet – in Korea. Es ist nicht ganz so aufdringlich wie in Neuseeland, aber doch vorhanden. Die Seouler gehen so weit, es auf ihre Gullideckel zu drucken.

* Korea hat die Sommerzeit abgeschafft, wofür ich es liebe.
* Die Steckdosen in Korea sind den deutschen gleich. Das macht Reisen sehr einfach, denn man braucht keinen Adapter. Auch die Spannung ist gleich, so dass man seine elektronischen Geräte schnell und einfach geladen bekommt. Es gibt für gewöhnlich auch überall genug Steckdosen.
* Koreanische Toiletten und Toilettenpapier desselben Landes vertragen sich nicht so ganz. Tatsächlich ist es nicht möglich, das Papier runterzuspülen, weil man dann akut Gefahr läuft, dass es zu einer Verstopfung kommt. Stattdessen findet man in jedem Badezimmer große Mülleimer.
... link (0 Kommentare) ... comment
Sonntag, 17. Januar 2016
Seoul – Juni-August 2015 (Leben)
atimos, 11:26h

JSA / DMZ
Nach dem Seoul Tower ist die DMZ, Demilitarized Zone, also Entmilitarisierte Zone, die zweitgrößte Touristenattraktion Seouls. Außerdem ist es historisch und politisch ein wichtiger Ort, so dass wir beide ihn uns gerne ansehen wollten.
Anbieter für begleitete Touren dorthin gibt es zuhauf, und auch wenn diese sich in einigen Details unterscheiden, ähneln sich die Preise stark. Man kann verschiedene Teile der DMZ besichtigen, eine Infiltrationstunnel, den Nordkorea nach Südkorea bauen wollte, aber der zwischendurch entdeckt wurde, Sehenswürdigkeiten in der Stadt selbst, wie beispielsweise einen der Paläste, die wir schon kannten, oder Insa-Dong oder die J.S.A., Joint Security Area, also die Gemeinsame Sicherheitszone, auch Panmunjeom genannt. Wir entschieden uns für die DMZ 2 Tour von Seoul City Tours, da diese ihren Fokus auf die J.S.A. gelegt hatte, was uns besonders sehenswert schien, weil gerade dort der Tisch stand, an dem Verhandlungen zwischen den beiden Staaten geführt wurden, wenn es denn mal zu Gesprächen kam. Im Preis inbegriffen waren zudem eine Abholung vor der Hoteltür, die Freedom Bridge, ein koreanisches Mittagessen sowie die Besichtigung eines Museums über die Geschichte der beiden Staaten – und technisch gesehen auch eine Reise nach Nordkorea. Spannend.
Es begann alles recht früh morgens, was für uns beide natürlich kein Problem darstellte, weil wir eh recht früh wach waren. Bevor wir diese abenteuerliche Reise allerdings antreten konnten, mussten wir uns noch zurecht machen, denn es galten strenge Vorschriften, was die Kleiderordnung betraf. Konkret sah es wie folgt aus:
Dress code: No jeans (the color has faded and torn), no leather pants, no short pants, no tank tops or sleeveless shirts, no training pants, no military style, no T-shirts (must be collared shirts), no Shirts with profane, provocative or demeaning representations, no leggings, no skinny jeans, no short skirts (skirts/dresses need to be about knee length). No slippers, flip-flops, sandals. (Keine Jeans [ausgebleicht oder mit Löchern], keine Lederhosen, keine kurzen Hosen, keine Tanktops oder Shirts ohne Ärmel, keine Sporthosen, keine Kleidung in Militärfarben, keine T-Shirts [das Shirt muss einen Kragen haben], keine Shirts mit profanen, provokativen oder erniedrigenden Darstellungen, keine Leggins, keine hautanliegenden Jeans, keine kurzen Röcke (Röcke/Kleider müssen bis zum Knie reichen). Keine Pantoffeln, keine Flip-Flops, keine Sandalen.)
Wie wir erst später erfuhren, war der Hintergrund jener, dass die nordkoreanische Seite gerne Fotos von Leuten in derartiger Kleidung machte und sie als Propaganda an die Bevölkerung weitergab. Löchrige oder zu kurze Kleidung wurde oftmals als Mangel an Ressourcen dargestellt. So zeigte man den Leuten: „Seht, wie gut ihr es hier habt! Außerhalb Nordkoreas kann man sich nicht einmal vernünftige Kleidung leisten.“ Jeans hingegen galten als Symbol Amerikas, eines der größten Feinde Nordkoreas, weshalb Jeansbekleidung als unverschämte Provokation gewertet wurde. Bei den Einschränkungen blieb nicht mehr viel in meinem Koffer übrig.
Um 9 Uhr wollte uns ein Taxi von Seoul City Tours abholen – und das tat es auch. Zuvor verabschiedeten wir uns von unseren Gastgebern, denn wir schlossen zu diesem Zeitpunkt nicht aus, dass irgendetwas schiefgehen würde und wir in Nordkorea stranden könnten. Es war ein Schauspiel für die Götter Hulk dabei zuzusehen, wie er Franziskas Worte des Abschieds hörte, die Zahnrädchen in seinem Denken langsam in Bewegung gerieten, um die implizierte Nachricht zu verarbeiten, der Groschen fiel und er die Augen schreckensweit öffnete. Ja, wir hatten gesagt „falls wir überhaupt zurückkommen“. Oder so etwas Ähnliches. Er sprang auf, fuchtelte wild mit den Armen und versicherte uns, dass uns nichts passieren würde. Wir waren allerdings schon lachend auf dem Weg nach draußen.
Auf unserem Weg zum Lotte Hotel (wir erinnern uns daran, dass Lotte nicht omnipräsent ist) kamen wir an einer Pizzeria vorbei, die einen beunruhigenden Namen trug. Es hieß „Mafia – Pizza & Pub“. Wir fragten uns, ob sie zum Inno Hostel dazu gehörte.
Am Lotte Hotel angekommen, nahm der Fahrer unsere Ausweise entgegen und verschwand damit. Es dauerte nicht lange bis zu seiner Rückkehr. Er teilte uns mit, dass wir unser gemütliches Taxi für einen Reisebus eintauschen mussten, welcher dieser Bus sei, welche Plätze uns zugewiesen worden waren und wann wir abführen. Alles war sehr übersichtlich strukturiert.
So stiegen wir in den für uns vorgesehenen Bus und ich fühlte mich sofort wie bei meiner Großmutter im Wohnzimmer.

Es waren nicht ganz die Spitzendeckchen an den Vorhängen oder die Stickereien drauf… Doch, es war genau das, das dieses Gefühl von vorletztem Jahrhundert vermittelte. Auch die Farben hatten etwas Altertümliches an sich, das ich nicht so ganz fassen kann. Wahrscheinlich lag es am Gesamteindruck.
Als wir dann losfuhren, erklärte uns die Tourleiterin, dass wir einen Gast an Bord hatten, nämlich eine Deserteurin aus Nordkorea. Zuerst erzählte sie uns ein bisschen vom Leben in ihrer Heimat, dann von ihrer Flucht und schließlich stellte sie sich den Fragen der Gäste. Einige der Fahrgäste stellten Fragen, die meiner Ansicht nach viel zu persönlich waren. Dennoch scheute sich die Dame nicht, diese zu beantworten. Natürlich sprach sie kein Englisch, immerhin musste sie sich schon damit abmühen, die Sprache Südkoreas zu erlernen. Stattdessen gab es eine Übersetzung von unserer Tourleiterin. Fotos waren mit dieser Dame allerdings nicht erlaubt, da man damit sie und ihre Familie in Nordkorea in Gefahr hätte bringen können. Sie achtete auch genau darauf nicht ins Visier zu geraten. Zwar besuchte sie mit uns das Museum, danach verabschiedete sie sich allerdings, damit sie nicht zufällig irgendwo gesichtet werden würde.
Tatsächlich ist der Begriff „Entmilitarisierte Zone“ irreführend, denn es handelt sich um einen vier Kilometer breiten Streifen, der nur so mit Minen übersät ist. In einem festgelegten Abstand stehen Schilder, die in verschiedenen Sprachen (südkoreanische Seite: Koreanisch und Englisch; nordkoreanische Seite: Koreanisch und Chinesisch) darauf hinweisen, dass das Betreten dieses Bereiches strengstens untersagt ist. Die Tatsache, dass seit Jahrzehnten keine Menschenmassen mehr dort waren – mit Ausnahme einiger sicherer und festgeschriebener Routen –, ließ es zu, dass in diesem Streifen ein riesiges Naturschutzgebiet entstand. Es ist ja niemand da, der etwas an diesem Ökosystem ändern würde.
Im Museum, das vor allem ein Observatorium war, sahen wir einen kurzen Film über die Lebensumstände in Nordkorea sowie die Grenzregion. Außerdem gab es viele Ausstellungsstücke aus Nordkorea, wie beispielsweise Lebensmittel, Banknoten und Zeitschriften. Aber es schien mir auch so, als sei es einfacher Postkarten in Nordkorea zu bekommen, als im südlichen Pendant. Jedenfalls stellte die Ausstellung es so dar.

Draußen auf einer Terrasse konnte man einen Blick über den Fluss und auf ein nordkoreanisches Dorf werfen. Es war viel zu weit weg, um irgendetwas mit dem bloßen Auge zu erkennen, doch das hatten die Verantwortlichen berücksichtigt und kostenlose Ferngläser aufgestellt. Mit Hilfe dieser konnte man tatsächlich erkennen, wie einige Bauern drüben ihre Felder bestellten, wie sie über die Lehmstraßen gingen, wie die Mehrfamilienhäuser leer standen oder nicht ganz zu Ende gebaut worden waren. Es war ein bizarrer Anblick.

An dieser Stelle war der Fluss ziemlich breit, so dass man der anderen Seite auf keinen Fall zu nah kommen konnte. Doch wir erfuhren, dass mancherorts nur 400 Meter die beiden Länder voneinander trennten. Selbstverständlich waren gerade dort die Befestigungsanlagen stärker ausgebaut. Wir fuhren tatsächlich an einer solchen Stelle vorbei. Ein trauriges Bild. Doppelt und dreifach war hier der Stacheldrahtzaun aufgestellt, die Wachposten standen in geringer Entfernung zueinander.
Im Museum im Inneren des Gebäudes gab es zudem die Schnauze eines KTX, auf der in großen Lettern Seoul – Pjongyang – Paris draufstand. Tatsächlich gab es eine Zugstrecke, die von Paris fast bis nach Seoul reichte. Kurz vor ihrer Fertigstellung verstarb der ehemalige Diktator und das letzte Stück, die Verbindung zwischen Nord- und Südkorea wurde nie beendet. Schade, denn es wäre bestimmt eine aufregende Fahrt. Im Observatorium erinnerte dieser Triebwagen nun an eine zerbrechliche Hoffnung.

Darüber hinaus sahen wir ein Klassenzimmer, wie es sie bis heute in Nordkorea gibt. Es unterschied sich nicht sonderlich von meiner Grundschulzeit. Holzstühle und –tische standen in Reih und Glied vor dem Lehrerpult. Eine Tafel an der Wand. Bilder der Diktatoren an der Wand. Nun gut, letzteres hatten wir nicht (mehr).

Das nordkoreanische Wohnzimmer, das gegenüber ausgestellt wurde, war spartanisch eingerichtet. Aber auch hier hingen Bilder der Führungspersönlichkeiten an der Wand. Es erinnerte mich noch mehr an das Haus meiner Großmutter als der Bus, was vermutlich darin begründet lag, dass kommunistische Wohngelegenheiten dieses gewisse Flair hatten, haben und haben werden. Von dem, was uns hier geboten wurde, schloss ich, dass die nordkoreanische Wohnungsgestaltung irgendwann in den 1980ern zum Stillstand gekommen war.

Einige Schritte weiter sahen wir auch die vielen Vergleiche, die mit Deutschland und dessen Teilung gezogen wurden. Natürlich war die Situation in Deutschland nicht eins zu eins auf Korea zu übertragen, aber dennoch schauten die Südkoreaner lieber auf die Gemeinsamkeiten, um eine Annäherung mit dem Norden nicht aus den Augen zu verlieren. Immerhin hatte es bei uns auch funktioniert. Es war ein Hoffnungsschimmer am Horizont – mehr nicht. Besonders deutlich wurde dies bei den Sicherheitszäunen, die die beiden Nationen voneinander trennten. Stacheldraht war allgegenwärtig.

Unser nächster Stopp war die Freedom Bridge, also Freiheitsbrücke. Falls man uns erklärt hatte, weshalb sie so heißt, habe ich es wieder vergessen. Es gab eine höher gelegene Plattform, von der aus man auf die Brücke sowie die nähere Landschaft blicken konnte. Während auf unserer Seite des Flusses ein kleiner Park angelegt worden war und ein großer Parkplatz vor einem Gebäude zum Verweilen einluden, fand man auf der gegenüberliegenden Seite eine hügelige Waldlandschaft, durch die eine Schneise geschlagen worden war, um Platz für den Zug zu machen. Auf einem der Hügel stand ein Wachposten.

Was aber das tatsächliche Ausstellungsstück an diesem Halt darstellte, war die letzte Lokomotive, die die Freedom Bridge überquert hatte. Natürlich war die Lokomotive von allen Seiten anzusehen; man hatte sogar eine Plattform gebaut, um sie von oben betrachten zu können. Der ganze Aufwand für den lieben Tourismus.

Es war ein bizarres Bild, wenn man auf dem Fußgängerüberweg stand. Auf der einen Seite stand dieses rostende Wrack, ein beeindruckender Zeuge eines bis heute andauernden Konflikts. Auf der anderen Seite sah man einen schön angelegten und gepflegten Garten, der zum Spazieren und Entspannen einlud. Dazwischen wuselten Menschen verschiedener Altersgruppen und Herkunftsländer. Alles in Reichweite eines feindlich gesonnen Staates.

Als wir diesen Schauplatz verließen, war es bereits an der Zeit das Mittagessen einzunehmen. Ein Gedanke, der ganz nach meinem Geschmack war, zumal ich so langsam hungrig wurde und es mir in Korea abgewöhnt hatte, Proviant einzupacken. Man bekam ja überall etwas zu essen.
Wir fuhren in ein Lokal zwischen Schauplatz der Lokomotive und DMZ, das anscheinend von diesen Reisegruppen lebte. Es gab Bulgogi. Nie im Leben würde ich mich über Bulgogi beklagen – nur über die Menge. Für uns beide ausgehungerte Profiglobetrotter war die Portion dann doch ein bisschen zu klein. Immerhin konnte man sich an den Beilagen bedienen, wie einem lustig war, so dass ich locker eine Portion nur davon verdrückte. Allerdings neigten sich auch diese schon langsam ihrem Ende zu. Das Essen war jetzt nicht herausragend, aber es war gut. In Anbetracht der Dienstleistungen, die uns am heutigen Tag geboten wurden, möchte ich mich nicht beklagen.
Nach einer einstündigen Pause (beim Essen gibt es in Korea keine Hast) brachen wir dann auf, um den Teil der Tour zu sehen, für den wir uns hauptsächlich interessierten: die JSA.
Schon auf dem Weg dorthin wies die Veranstaltungsleitung uns darauf hin, dass Fotos von nun an verboten waren, es sei denn wir bekamen ausdrücklich die Erlaubnis dafür. Grund dafür war die Vermutung, dass jeder, der sich zu sehr für die Verteidigungsanlagen Südkoreas interessierte, ein nordkoreanischer Spion hätte sein können. Um nicht ins Visier der Behörden zu geraten, hielten wir uns strikt an die Vorgaben. Wir mochten Südkorea und wollten wiederkommen.
Schon bald wurde es mehr als deutlich, dass hier der Spaß aufhörte. Auf einer Strecke von einigen Kilometern vor der entmilitarisierten Zone begannen die Barrikaden, die es Fahrzeugen nur noch erlaubten, Zickzack zu fahren. Große schwarz-gelbe Fässer mit riesigen Stacheln behinderten das gerade Vorankommen; Wellenbrecher von der Größe kleiner PKW standen im Weg, am Straßenrand fand man noch mehr davon; Schranken, die schnell in Position gebracht werden konnten. All das verdeutlichte uns, wie kompliziert und angespannt die Lage zwischen den beiden Staaten tatsächlich war.
Wir kamen an der Grenze an, wo unsere Pässe geprüft wurden. Glücklicherweise stimmte alles mit der Liste des diensthabenden Soldaten überein, so dass wir problemlos ins Niemandsland einreisen durften. Vorher allerdings erhielt jeder von uns einen gelben Besucherausweis, den wir die ganze Zeit gut sichtbar an unserer Kleidung mitführen mussten. Einige Meter weiter wurde uns ein amerikanischer Soldat zugewiesen, der unsere Gruppe von nun an begleiten und instruieren würde. Daneben gab es noch einen koreanischen Soldaten, der kein Wort mit uns sprach, und der Busfahrer wurde gegen einen Soldaten eingetauscht. Wir waren in besten Händen.
Ungeachtet dieses doch bedrückenden Anblicks gab es Leute, die sich davon nicht im Geringsten beeindrucken ließen. Als wir auf dem Parkplatz vor dem UNO-Gebäude ankamen, sahen wir zwei Füße gemütlich über den Rand einer Bank baumeln. An diesen Füßen hing ein Mensch, ein Busfahrer, um genau zu sein. Er nutzt diese kurze Pause, um ein Nickerchen zu machen. Das versetzte den amerikanischen Soldaten, der uns einwies in einen Zustand flüchtiger, aber unendlicher Resignation. Da versuchte der Mann ernst zu sein und uns die Schwierigkeit der Lage darzustellen, nur um im nächsten Moment von einem Zivilisten als Wichtigtuer dargestellt zu werden.
Nach einem Gruppenfoto auf dem Parkplatz innerhalb der entmilitarisierten Zone, führte man uns in eines der Gebäude, dort in einen Vorführungssaal, wo wir zusammen mit anderen Reisegruppen einiges über die Geschichte Koreas, hauptsächlich eine kurze Zusammenfassung der Umstände, die zur Teilung führten, erfuhren. Dann gab es noch einige Informationen zur DMZ sowie einigen militärisch sowie politisch wichtigen Ereignissen in der Zone, wie beispielsweise den Versuch eins Russen von Nord- nach Südkorea zu laufen. Es endete blutig.
Außerdem erhielten wir einige Informationen über die DMZ. Tatsächlich gab es ein Dorf in dieser Zone, in dem Menschen beider Nationen friedlich zusammen wohnten. Sie bestellten ihre Felder, gingen ihrem Alltag nach, hatten aber unwahrscheinliche Einschränkungen, wie beispielsweise eine Ausgangssperre. Es war für mich eine Überraschung zu erfahren, dass tatsächlich Menschen hier lebten. Weniger überraschend war die Erläuterung, dass diese Siedler oft evakuiert wurden, wenn mal wieder ein Konflikt anstand. Aber alles in allem schienen die Leute nicht von dort weglaufen zu wollen.
Darüber hinaus gab es ein sogenanntes Propagandadorf auf der nordkoreanischen Seite, das man in einiger Entfernung sehen konnte, wenn man mit dem Bus zum UNO-Stützpunkt fuhr. Ein Lautsprecher auf einem hohen Mast hatte in vergangenen Tagen nordkoreanische Propaganda gen Süden gesandt. Heute stand das Dorf leer, die Gebäude verfielen langsam und die Lautsprecher waren still. Was aber ins Auge fiel, war der Mast mit der nordkoreanischen Flagge daran. Er war entschieden größer als das südkoreanische Pendant. Nordkorea hatte zuerst einen Flaggenmast aufgestellt, woraufhin Südkorea auf seiner Seite einen platzierte, der ein klein bisschen höher war. Durch diese Aktion aufgestachelt erhöhte Nordkorea seinen Mast entschieden. Auch die Flagge war den Proportionen des Masts angepasst worden, um auf jeden Fall sicher zu stellen, wer hier den größeren hatte. Wir mussten uns ein Lachen verkneifen.
Nach diesem offiziellen Briefing durften wir uns wieder in unsere Gruppen aufteilen, stiegen in den Bus und fuhren weiter zu dem tatsächlich interessanten Teil, vorbei an den „Attraktionen“, von denen soeben die Rede war. Natürlich kamen wir nicht wirklich an ihnen vorbei – sie lungerten mehr irgendwo in der Entfernung, so dass man sie am Horizont gerade einmal so erkannte. Außer der nordkoreanischen Flagge am Mast, sie war wirklich weithin sichtbar.
Es gab auch ein Tor, das vorher keine Erwähnung gefunden hatte. Dort begann der gefährliche Teil dieser Zone. Auf diesem Tor prangerte in fetten Lettern das Motto der Einheiten in der Grenzregion: „In front of them all!“ („Vor ihnen allen.“), das den dort stationierten Soldaten noch einmal vor Augen führen sollte, wie nah sie am Gegner dran waren.
Schließlich kam unser Reisebus vor einem weiteren prunkvollen Gebäude an, man ließ uns aussteigen, hindurchgehen, das gläserne Dach bewundern (aber nicht fotografieren) und auf der anderen Seite einen ersten Blick auf die Grenze zwischen diesen beiden Staaten werfen. Es wechselten sich blaue Gebäude mit grauen ab. Die blauen waren südkoreanischer Machart, die grauen nordkoreanisch.

Wir betraten das mittlere blaue Gebäude, in dem sich der Verhandlungsraum befand. Dort wurden Gespräche zwischen den beiden Nationen abgehalten, wenn mal wieder die Notwendigkeit dafür entstand. Wir wurden mehrfach darauf hingewiesen, dass wir in dem Raum nichts anfassen und unter keinen Umständen verrücken durften – natürlich fand sich mindestens ein Genie, das trotzdem irgendwo dran kam. Außerdem waren nun Fotos zwar erlaubt, aber nur in Richtung der nordkoreanischen Seite. Diese Möglichkeit nutzte unsere Gruppenleiterin aus, um ein weiteres Gruppenfoto zu schießen, nämlich als wir um den großen Konferenztisch in der Mitte herum gingen und somit tatsächlich auf nordkoreanischem Grund und Boden standen. Wir hatten gemeinsam die Grenze überschritten, doch würde das nie in unseren Reisepässen Erwägung finden.
Neben der Ausstattung aus Tischen, Sesseln, Dolmetscherkabinen und Flaggen fanden sich einige südkoreanische Soldaten in dem Raum, deren Aufgabe es war, einfach nur bewegungslos in der Gegend zu stehen. Diese sowie ihre Kollegen draußen wurden oftmals kurzerweise ROKs genannt, was einfach nur die Abkürzung für Republic of Korea war. Sie alle trugen trostlose Uniformen, dicke, schwarze Helme und ebensolche Sonnenbrillen. Ihre Aufgabe bestand darin, Präsenz zu zeigen und im Notfall zu reagieren. Glücklicherweise gab es nicht viele solcher Zwischenfälle, die ein tatsächliches Eingreifen erfordert hätten – und keinen während unserer Anwesenheit.

Zu diesem Zweck standen sie in der Gegend rum. Draußen war es sogar so, dass zwischen zwei Gebäuden drei ROKs standen: zwei starrten halb auf die Wand und halb in die Ferne, einer stand in der Mitte zwischen den Bauten. Diese Aufstellung hatte den Zweck, dass die zwei Soldaten möglichst viel Schutz hatten, wobei sie von der gegnerischen Seite immer noch gesehen werden konnten. Markanter Weise war der junge Mann in der Mitte, also jener, der der nordkoreanischen Seite schutzlos ausgeliefert war, auch der schmächtigste. Die Soldaten, die hier standen, waren Spezialeinheiten, die zu den besten der Nation zählten. Ich hätte mir einen interessanteren Job vorstellen können.
Bei dieser Gelegenheit lernten wir auch einiges über die feindliche Seite: Die Soldaten in Nordkorea wurden für zehn Jahre eingezogen und hatten während dieser Zeit kaum Gelegenheit nach Hause zu gehen. Vielen von ihnen war während der Dienstzeit gar kein Urlaub gewährt.
Während wir also draußen auf der südkoreanischen Seite gen Nordkorea blickten, sahen wir einen einzigen Soldaten drüben stehen. Er wartete genauso regungslos vor dem Gebäude wie seine südlichen Gegenstücke. Unser amerikanische Begleitsoldat erklärte uns, dass die UNO es sich einfach machte und alle nordkoreanischen Uniformträger der Einfachheit halber Bob nannte. Waren es mehrere, wurde Bob durchnummeriert. Immerhin gab es keine Möglichkeit, ihre tatsächlichen Namen in Erfahrung zu bringen, da die Kommunikation untereinander untersagt war. Heute gab es nur Bob 1, der zudem weit weg war.
Nach dieser doch recht zügigen Besichtigung war es wieder an der Zeit aufzubrechen. Fotos waren wieder verboten, bis andere Anweisungen erfolgten, und wir stiegen in unseren Bus. Wir fuhren eine kleine Schleife, um noch ein Monument sowie die Bridge of no Return zu sehen. Von beidem durften wir Fotos knipsen. Die Brücke (Bridge of no Return = Brücke ohne Wiederkehr) hatte ihren Namen aus folgendem Grund erhalten: Im Laufe des Koreakrieges war es auf beiden Seiten zur Festnahme von gegnerischen Soldaten gekommen. Nach den Waffenstillstandsverhandlungen hatte man sich dazu durchgerungen, diese auszutauschen, doch beide Seiten ließen ihren Gefangenen die Wahl, auf welcher Seite der Brücke sie bleiben wollten. Allerdings gab es keine Rückkehr, wenn sie sie einmal überquert hatten.

Mit dieser Sehenswürdigkeit als letzten Stopp ging es zurück nach Seoul. Man brachte uns allerdings nicht mehr zum Hostel zurück, sondern nur zum Lotte Hotel in der Innenstadt. Das war kein Problem, da die Metroverbindung hervorragend war.
Gegenüber vom Lotte Hotel fand an diesem Tag ein Open Air K-Pop Festival statt, doch Franziska war zu müde, es sich noch anzusehen. So fuhren wir entkräftet, aber mit dem Ausflug äußerst zufrieden, wieder nach Hause. Hulk war äußerst erfreut darüber, uns unbeschadet wiederzusehen. Offensichtlich hatte Franziskas Aussage ihm mehr zu schaffen gemacht, als meine Reisebegleitung es beabsichtigt hatte.
Franziska versucht bis heute herauszufinden, warum Touristen in dieser Zone überhaupt zugelassen werden.
Korean Folk Village
Ein Stück außerhalb von Seoul lag ein Freilichtmuseum, das seinen Besuchern erlebte Geschichte versprach und somit einen Blick in die Vergangenheit Koreas gewährte. Auch wenn die Wegbeschreibung auf dem Flyer zu wünschen übrig ließ, war der Gesamteindruck auf der inhaltlichen Seite überzeugend, weshalb wir uns diese Sehenswürdigkeit für Groß und Klein auch gerne ansehen wollten. Dank Hulk konnten wir auch in Erfahrung bringen, wie wir dort überhaupt hinkamen. Immerhin musste man dafür einen Bus nehmen und dieses Netz war uns überhaupt nicht geläufig.
Vorab: Man sollte viel Zeit mitbringen, wenn man das Korean Folk Village sehen will. Nicht nur, dass es sehr viele Ausstellungsstücke gab und die Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln rund zwei Stunden dauerte. Nein, es gab auch ein schönes Unterhaltungsprogramm sowie die Möglichkeit sich handwerklich an einigen Stationen auszuprobieren. Aber ich sollte am Anfang anfangen.
Wir brachen recht zeitig auf, nachdem wir gefrühstückt und einige Formalitäten geklärt hatten. Hulk hatte uns erklärt, welchen Weg wir am besten nehmen sollten, um zielsicher anzukommen. Zuvor hatte er unter der angegebenen Nummer angerufen, weil wir nicht sicher waren, welchen Bus wir denn nun wo nehmen sollten und welches unsere Haltestelle war, an der wir aussteigen mussten. Er löste unser Problem fix.
Als wir nach einigem Suchen an der Bushaltestelle angekommen waren, lernten wir ein neues Phänomen Seouls kennen: Buszuweiser. Da stand ein älterer Herr in Hemd an der Bushaltestelle und erklärte den Leuten, wo sie sich hinstellen mussten, je nachdem wohin sie wollten und in welchen Bus sie einzusteigen hatten. Für uns blutige Anfänger, die den Bus der Linie 5001-1 (nicht zu verwechseln mit Linie 5001) zu erwischen gedachten, war das ein Segen. Denn ein entscheidender Prozentsatz des Straßenverkehrs in Seoul wird von öffentlichen Verkehrsmitteln eingenommen, ob nun Busse, Taxen oder sogenannte private Taxen, also Chauffeure. Wir standen zwar an der richtigen Säule, aber daneben gab es noch bestimmte Bereiche, in denen man auf unterschiedliche Busse wartete. Jeder Bus hatte seine Nummer auf dem Bürgersteig.

Ich bezweifle, dass wir es gesehen hätten, ohne darauf aufmerksam gemacht worden zu sein.
Unser Buszuweiser war auch ein sehr freundlicher Koreaner, der gar kein Wort Englisch sprach. Glücklicherweise verstand Franziska einige Happen dieser mir immer noch recht fremden Sprache und ich war dank Jae Won geübt in internationaler Kommunikation, so dass wir tatsächlich ein einfaches Gespräch zustande brachten. Er erzählte uns wie alt er war, dass er sich noch mit Sport fit hielt, weder rauchte noch Alkohol trank und die deutsche Fußballmannschaft sehr mochte, besonders unseren Torwart, wobei Zidane ihm im Angriff besser gefiel als unsere Jungs. Er fragte auch woher wir kamen, wie alt wir waren und einiges mehr, was wir dann doch nicht verstanden. Er war erstaunt zu erfahren, dass ich älter als meine Reisebegleitung war, und wies mich darauf hin, ich solle sehr gut auf sie aufpassen. Immerhin war es meine kleine Schwester, von der er hier sprach. Es war ein lebhaftes und lustiges Gespräch, auf jeden Fall ein Ereignis, an das ich mich lange und gern erinnern werde.
Hier möchte ich noch kurz erwähnen, dass die Busse in Seoul nicht nach einem so strikten Fahrplan wie in Deutschland fuhren. Nun, ich weiß, dass die Fahrpläne daheim eher theoretischer Natur sind, aber in Korea machte man sich nicht die Mühe, den Fahrgästen etwas vorzumachen. Es gab einfach eine kurze Zusammenfassung: Der Bus fuhr zwischen 5 und 23 Uhr im Takt von 5 bis 11 Minuten je nach Verkehrslage. Das war mal was Neues. Anstatt genervt auf die Uhr zu schauen und sich zu wundern, wo denn das Vehikel blieb, warteten die Seouler einfach, bis ihre Linie ankam.
Als unser Bus eintrudelte, verabschiedete sich der Buszuweiser freundlich von uns, wir von ihm, und er erklärte dem Busfahrer, an welcher Haltestelle er uns doch bitte raus lassen müsste. Bis dahin dachte ich, dass wir alleine zurechtkommen würde, aber schon eine Minute später stellte ich fest, dass die Busse in Seoul sich stark von der Metro unterschieden: Die Namen der Haltestellen warn nicht in europäischen Buchstaben angeführt, sondern nur in Hangeul. Jetzt verstand ich auch, warum unser Buszuweiser von mir verlangte, dass ich ein Foto vom Streckenverlaufsplan nahm. Wenn man kein Hangeul lesen und kein Koreanisch sprechen konnte, war Abgleichen die einzige Möglichkeit dort anzukommen, wohin man wollte. Es sei denn, natürlich, ein freundlicher Buszuweiser erklärt es dem Busfahrer im Vorfeld.
Die Fahrt dauerte mit ihren 45 Minuten dann doch recht lang, aber wir kamen am Dorf an, wo der Busfahrer uns freundlich darauf hinwies, dass dies unsere Haltestelle war. Hervorragend. Bisher lief alles wie geschmiert.
Nun mussten wir nur noch eine Ampel überqueren, über einen großen Parkplatz stolpern und den Eintritt von 15.000 Won (ca. 12 Euro) pro Person bezahlen, um auch schon das Vergnügen genießen zu dürfen, in eine historische Welt einzutauchen. Wenn man ein bisschen mehr ausgeben wollte, konnte man den Vergnügungspark direkt nebenan mitnehmen. Dies war allerdings nicht unsere Intention.

Das Korean Folk Village war klar und übersichtlich gegliedert: Am Eingang befanden sich einige Restaurants und Souvenirshops, in der Mitte gab es Häuser verschiedener Epochen inklusive Werkstätten und Freilichtbühnen, am anderen Ende fand man eine riesige Essensausgabe à la Freilichtmensa. Aufgelockert wurde die ganze Atmosphäre durch Grünflächen, Blumenwiesen, Bäume und staubige Sandwege, die nicht halb so heiß wie der brütende Asphaltparkplatz vor dem Eingangstor waren. In Anbetracht der sommerlichen Temperaturen war es im Museum richtig angenehm – und das trotz mangelnder Klimatisierung, da es ja unter offenem Himmel stattfand.
Wir waren schon lange unterwegs, es war brütend heiß und ich hatte schon wieder Hunger, also entschlossen wir uns kurzerhand für die Mittagspause. So stiefelten wir zielgerichtet durch den ersten Teil des Museums, um schon beim Eingang zum zweiten gehörig abgelenkt zu werden. Dort begrüßte uns eine riesige HEU-Schrecke.

Wir kamen nicht umhin, das eine oder andere Foto von diesem Geschöpf zu machen.
Obwohl das Gelände relativ groß war, konnte man sich gar nicht verlaufen, weil überall Straßenschilder den Weg zu den größten Attraktionen wiesen und man anhand dieser zumindest einige Orientierungspunkte hatte, auch wenn man zum ersten Mal dort war. Ich fand es äußerst übersichtlich und wohl strukturiert.
Nach einigen Minuten zügigen Marschierens kamen wir dann doch relativ schnell und ohne uns ablenken zu lassen im Essensbereich an. Vor uns erstreckte sich an Meer an Tischen und Bänken, manche unter Sonnenschirmen, andere in hölzernen Hütten, wenige in der prallen Sonne.

Dahinter fand sich ein langes Haus, in dessen Innerem sich verschiedene Stände mit unterschiedlichen Speisen die Hand reichten. Wir stellten uns brav vor eine Theke in der Erwartung unsere Bestellung aufgeben zu können, doch wurden wir hier eines Besseren belehrt. Eine Dame kam auf uns zu und zeigte zum rechten Ende der Häuserkette, wo sich eine Kasse befand, an der man sein Essen bestellte und bezahlte. Im Gegenzug erhielt man eine Nummer und Anweisung, an welche Theke man gehen musste, um das Essen abzuholen, nachdem die Nummer aufgerufen worden war. Klingt jetzt kompliziert, war aber ganz einfach. Vom organisatorischen Standpunkt ergab es sogar Sinn. So musste nicht jeder einzelne Stand mit eigener Kasse herumwirtschaften und als Besucher konnte man sich getrost schon hinsetzen, während man auf die Speisen wartete.
So stellten wir uns in eine sehr kurze Schlange und waren auch schon dran. Wir entschieden uns für zwei Varianten von koreanischen Pfannkuchen: der eine war aus Sojabohnen, der andere mit Kimchi. Natürlich bekam Franziska den schärferen, aber wir teilten selbstverständlich auch, damit jeder von allem was hatte.
Als wir an der Essensausgabe auf unser Gericht warteten, kam eine eifrige Mitarbeiterin zu uns, riss uns förmlich das Märkchen mit der Nummer aus der Hand, zeigte uns den Stand, an dem wir das Essen abholen sollten (wir hatten gerade direkt vor dem Stand Platz genommen), sprach einige Worte mit den Mitarbeitern und wartete geduldig mit uns, bis die Pfannkuchen fertig waren, um sie uns dann an den Tisch zu tragen. Entweder meinte sie es gut mit uns oder wir sahen äußerst verloren und ausgehungert aus. Da sie es bei sonst keinem (koreanischen) Besucher machte, schiebe ich es auf unser Aussehen. Wie dem auch sei, wir nahmen es gelassen und mit einer Portion Humor. Allerdings wollten wir uns dann auch nicht nach einem anderen Sitzplatz umsehen.
Nach dieser wohlverdienten Stärkung konnten wir die Wunder dieser Erlebniswelt erst so richtig in uns aufnehmen. Schon am Ausgang vom Essenshof fanden sich die ersten traditionellen Handwerksstätten. Da saß ein alter Mann und bemalte in Seelenruhe einen Fächer nach dem anderen. Dort gab es einige gefärbte Tücher zu kaufen. Ja, auch hier fand man einen Laden mit Souvenirs. Hier fand man einen Laden der Ttoek herstellte. All dies sah man in diesen urigen hölzernen Häuschen, die oftmals gerade nur so viel Platz boten, dass man sich um die eigene Achse drehen konnte – wie es bis heute in Korea der Fall sein kann.

Wir hatten uns eine klare Route ausgesucht, damit wir uns alles nach Plan ansehen konnten. Bisher hatten wir es nie geschafft, die richtige Reihenfolge bei irgendeiner Begehung einzuhalten, was daran lag, dass wir einfach drauf losstürmten und uns nicht viel dabei dachten. Dieses Mal sollte es anders sein. Wir hatten eine Karte in der Hand, eine festgelegte Route, waren gestärkt und zielsicher... Bis wir die erste Brücke fanden und beschlossen abzubiegen. Auf einmal waren wir bei Haus Nr. 37. Damit verabschiedeten wir uns von einem vorgegebenen Pfad und machten es wieder einmal auf unsere Weise.
Viele der Häuser stellten das Leben einfacher Leute, Bauern und Handwerker dar, doch sie waren aus verschiedenen Epochen sowie Teilen des Landes. Man erkannte schon Unterschiede in Stilen und Bauweisen, verschiedene Materialien waren zum Einsatz gekommen und dergleichen. Gleichzeitig wurde auch deutlich, dass dies keine Häuser von reichen Familien waren. Es gab nur das Nötigste auf engstem Raum. Infotafeln erzählten oft etwas zum Leben und Arbeiten der Bewohner oder zu den Gegenständen, die sie benutzten. Letzten Endes hatten wir nicht die Zeit uns jedes einzelne Bauernhaus gesondert anzusehen, aber auch so gewannen wir einen allgemeinen Eindruck von der damaligen Lebensweise.


Im Eintrittspreis inbegriffen waren einige Vorstellungen mit verschiedenen Künstlern. Da die Ankündigung vielversprechend klang, begaben wir uns zur Freilichtbühne, um uns das Spektakel anzusehen. Ich bin immer noch begeistert davon.
Es begann mit einem musikalischen Akt. Die Bühne, wie ein Amphitheater aufgebaut, war noch leer, doch schon bald kamen die Musikanten hereinmarschiert. Sie führten vor allem Trommeln mit sich, doch gab es auch noch andere Schlaginstrumente. Was besonders ins Auge stach waren ihre bunten Kostüme und die drolligen Hüte, die sie trugen. Es gab drei verschiedene Huttypen: Zwei Leute trugen einen großen Bommel an einer Stange, einige hatten einfach nur flauschig wirkende, riesige, bunte Kugeln auf dem Kopf, die letzte Gruppe schleifte weiße Bänder hinter sich her. Erst im Laufe der Show erfuhren wir, was es damit auf sich hatte.
Da fingen die Musiker auch schon an ihre Köpfe im Takt der Trommeln zu drehen und wippen, wodurch die weißen Bänder an ihren Hüten in Bewegung gerieten. Sie zogen gekonnt Schleifen und Wirbel durch die Luft, zielgerichtet drehten sie den Kopf mal in die eine, dann in die andere Richtung, um dem Bändchen den richtigen Schwung zu versetzen. Es war einfach nur herrlich anzusehen. Aber damit nicht genug. Plötzlich ging es heiß her, was keineswegs am Wetter lag. Die Burschen fingen an im Kreis zu rennen, während die anderen Gruppenmitglieder, also die ohne Bändern am Hut, sich in der Mitte drängten. Im nächsten Moment sprangen sie in wilder Manier durch die Luft und machten genau solche Kreise wie ihre Hutbändchen. Es war formvollendet.

Die beiden Herren mit dem großen Bommel an der Stange konnten ihren Kopfschmuck ebenso herumkommandieren. Allerdings sah es eher buschig und nicht so elegant wie bei den Bändchen aus. Doch kaum war der Bommel oben, entfaltete sich eine prächtige weiße Blume über den Köpfen der Künstler.
Zum Abschluss gab es noch einige Solodarbietungen. Da nahm einer der Musiker seinen Bommelhut ab und tauschte ihn für ein Stäbchen und eine Scheibe ein. Breit grinsend begann er seine Show vor dem gespannt wartenden Publikum. Er drehte die Scheibe an und warf sie aufs Stöckchen, wo er sie gekonnt balancierte, in die Luft warf, wieder auffing, unterm Bein hindurch führte und dergleichen. Das Publikum war entzückt – mich eingeschlossen. Was vor vierhundert Jahren für Erheiterung gesorgt hatte, funktionierte bis heute immer noch hervorragend. Der Musiker zeigte ins Publikum und griff sich eine bezaubernde junge Dame (Ausländerin) heraus, mit der er ein wenig spielen wollte. Sie sollte ihm die Scheibe zuwerfen. Nach einigen missglückten Versuchen, die zur Erheiterung aller Anwesenden beitrugen, gelang es ihr dann endlich, die Scheibe vernünftig zu werfen, so dass der Künstler sie auch vernünftig auffangen konnte. Es war ein herrlich amüsantes Schauspiel.
Zum krönenden Abschluss kam ein anderer Bändchenschwinger herein, doch hatte er seinen Kopfschmuck für ein weit längeres Bändel eingetauscht. Mit diesem Gerät ausgerüstet vollführte er Kunststücke, die so manchen Breakdancer vor Neid hätten grün anlaufen lassen. Dabei wusste er gleichzeitig seinen Kopf so zu bewegen, dass das meterlange Band vom Boden fern blieb. Eine gelungene Inszenierung.

Ich fand es schön, wie offen die Koreaner ihre Begeisterung für eine solch simple Form der Unterhaltung kundtaten. Jedes neue Kunststück wurde mit einem großen „Ahh“ oder „Ohh“ belohnt. Es war nicht gespielt oder übertrieben – die Koreaner können sich wirklich aus tiefstem Herzen für solche Sachen begeistern.
Natürlich gab es donnernden Applaus für die Truppe. Zusammen mit den Koreanern brachen wir in eine andere Ecke der Freilichtbühne auf, um uns das nächste Schauspiel anzusehen.
Es folgte ein Akt auf dem Hochseil. Eine junge Dame in Rot und Weiß tauchte wie aus dem Nirgendwo neben dem zweieinhalb Meter hohen Gestell auf, schwang sich kunstvoll drauf und begann damit, eine Geschichte zu erzählen. Sie hatte ein Mikrofon, das der Vorstellung leider nicht gewachsen war und nach einiger Zeit mit einem Wackelkontakt negativ auffiel. Mir persönlich machte es nichts aus, schließlich verstand ich immer noch kein einziges Wort. Den zahlreichen Koreanern könnte es eventuell ein bisschen mehr ausgemacht haben. Das spielt für diese Geschichte allerdings nur eine untergeordnete Rolle.
Wir nahmen möglichst gute Plätze ein, was bei den gegebenen Verhältnissen vor allem hieß, sich eine schattige Stelle zu suchen, von der aus man noch immer etwas sehen konnte. Dann ging es auch schon los. Die junge Frau baute sich an einem Ende des Hochseils auf, öffnete knallend ihren Fächer und marschierte los. Es fing recht harmlos an, doch schon die erste Übung ließ die Koreaner um uns herum Rufe der Bewunderung ausstoßen, obwohl die Dame „nur“ über das Seil spazierte. Sie wagte sogar, das Ganze ein wenig aufzupeppen, indem sie hin- und herschwankte, als ob sie tatsächlich Probleme damit hätte, das Gleichgewicht zu halten. Selbstverständlich kam sie heil und munter am Ende der Strecke an. Schließlich ging es bei dieser Einleitung nur darum, sich die ungeteilte Aufmerksamkeit des Publikums zu sichern. Die Strategie war erfolgreich.

Mit jeder Runde holte sie neue Tricks aus der Kiste. Vielleicht erläuterten ihre Worte das ein oder andere Kunststück oder gaben wichtiges Hintergrundwissen preis – doch das würde ich auf dieser Reise nie erfahren. Die Akrobatin ging vorwärts, rückwärts, setzte sich auf das Seil, um dann wieder aufzuspringen, und wandelte dort oben so sicher wie unsereins auf festem Boden. Besonders spannend wurde es, als sie ihre Beine zu einer Seite fallen ließ, mit dem Hintern im Damensitz auf dem Seil landete und den Schwung nutzte, um wieder aufzustehen. Den Trick überbot sie noch damit, dass sie die Beine sitzend von der einen auf die andere Seite schwang. Das Publikum war hingerissen.
Nach gut zwanzig Minuten verabschiedete sich die junge Frau von uns allen und wir zogen zur dritten Bühne, einem runden steinernen Kreis, in dem junge Burschen eine Vorführung im Voltigieren darboten. Auch das wollten wir uns nicht entgehen lassen.
Es begann schon turbulent. Laute Musik erschallte, irgendwo knallte etwas, Pferde stürmten in den doch recht engen Kreis. Einer nach dem anderen präsentierten sich sechs Reiter auf ihren Tieren, um dann nebeneinander Aufstellung zu nehmen.

In diesem rasanten Tempo ging es die ganze Zeit weiter. Da schwangen sich die Reiter durch ihre Sattel, sprangen runter, liefen ihren Tieren hinterher, nur um bei der nächsten Runde wieder aufzuspringen. Sie brachten Pfeile und Bögen mit, um aus dem Galopp auf eine Zielscheibe zu schießen, oder sie warfen Speere auf das Bild eines Wildschweins. Mit knallenden Peitschen (diese Munition für Kinderpistolen war daran befestigt) schossen sie künstliche Blumen von Ständern am Rand der Manege. Es gab auch Kunststücke mit zwei Reitern auf einem Pferd oder drei Reitern auf zwei Pferden. Die Jungs sprangen, liefen, schossen, vollführten Manöver von unwahrscheinlicher Leistung und schienen dabei so gelassen wie auf einem Sonntagsspaziergang. Es war eine hervorragend inszenierte Darbietung, die mich staunend zurückließ.

Nach dieser zwanzigminütigen Vorstellung musste ich erst einmal tief durchatmen und mich wieder sammeln. Eine Pause war mehr als nötig – dabei hatte ich nur zugesehen. Wir entschieden uns dagegen, uns die traditionelle koreanische Hochzeit anzusehen, weil wir uns lieber mit dem Rest des Freilichtmuseums beschäftigten. Mittlerweile waren wir seit eineinhalb Stunden bei den Künstlern.
Es gab einen Bereich, der regelmäßig von Filmproduzenten für den Dreh von historischen Filmen und Serien benutzt wurde. Dort fanden sich viele Pappaufsteller und Informationstafeln von Dramen, die gerade dort oder allgemein in dem Dorf gedreht worden waren – inklusive lebensgroßer Figuren der Charaktere. Natürlich mussten wir uns das näher ansehen. Natürlich erkannte Franziska viele der Häuser wieder und konnte die meisten Serien mit Namen benennen und die Handlung für mich kurz umreißen. Natürlich hatte ich nicht die geringste Ahnung davon.
Wir wanderten ebenfalls durch die Häuser von Verwaltungsangestellten, die sich allein schon in der Größe von denen der Bauern unterschieden. Selbstverständlich war das Haus auch stabiler gebaut, die Böden waren aus elegantem Holz, es gab die typischen Klappwände und Schiebetüren, Schnitzereien, die jeden Balken verzierten, und vieles mehr. Luxus erkennt man durch alle Länder und Epochen. Außerdem saß dort ein Mann in traditioneller Kluft und fächerte sich Wind zu. Ob er nun die Wache oder einen Adelsmann darstellte, vermag ich nicht zu sagen. So oder so sah er nicht besonders erholt aus, was unter anderem an den Temperaturen liegen mochte.

Im krassen Gegensatz dazu stand das Gefängnis, das direkt neben dem Verwaltungsgebäude aufgestellt war. Lange Reihen an Holzgattern mit dicken Streben füllten einen Gang aus. In den Zellen gab es nicht einmal Betten oder dergleichen. Der Boden war aus Stein oder Lehm, der von einer dicken Staubschicht bedeckt wurde. Man durfte auch Gast in einer Zelle werden, wenn man daran interessiert war, und sich sogar einige Folterwerkzeuge und Fesselgeräte aus der Nähe ansehen, sprich benutzen. Gesagt, getan. Ich möchte explizit darauf hinweisen, dass es weder angenehm noch gemütlich war, aber auf jeden Fall eine nennenswerte Erfahrung.
Wie es sich für ein ordentliches, historisch korrektes Freilichtmuseum gehört, stand auch ein Tempel in der Anlage. So begaben wir uns auf den anstrengenden Pfad, um auch dieses Gebäude in Augenschein zu nehmen. Wie bereits erwähnt, war es an diesem Tag besonders warm, und auch wenn die Bäume und Pflanzen um uns herum viel Schatten spendeten, boten sie zu dieser späten Stunde kaum noch Erleichterung. Die Tatsache, dass der Tempel auf einem Hügel stand, trug nicht zu unserer Erheiterung bei. Irgendwann auf halber Strecke begrüßte uns ein imposantes rotes Tor mit großem, verziertem Dach. Kurze Zeit später sahen wir eine überdachte Steintreppe, die durch den Tempeleingang hindurch auf einen Hof führte. Ich gebe gerne zu, dass die Inszenierung des Tempels gelungen war und man ihn sich auf jeden Fall ansehen sollte. Auch die Gebäude waren schön anzusehen.

Franziska fand einen Herrn, der personalisierte Kalligraphie auf Fächer schrieb, so dass sie einige Zeilen käuflich erwarb. Ich fand Schaukeln. Wir beide waren glücklich mit unserem Fund. Zwischendurch gab es noch für jeden ein Eis, um wenigstens kurzfristig Linderung zu schaffen. Wie bereits angedeutet gab es einen Fluss, der das Korean Folk Village in zwei ungleiche Teile teilte. Um diesen Fluss zu überqueren gab es an verschiedenen Stellen unterschiedliche Brücken. ich ließ es mir nicht nehmen, eine der abenteuerlichen Varianten zu nutzen:

Noch bevor wir alle Häuser eingehend untersucht hatten, waren unsere Köpfe zu müde, um noch irgendwelche Informationen aufzunehmen. Kein Wunder, wir hatten bereits mehrere Stunden in dem Dorf verbracht, uns mehrere hervorragende Vorstellungen angesehen, Koreanisch gegessen und waren durch verschiedene Epochen auf engstem Raum gestiefelt. Wir entschieden uns dafür, dass es für diesen Tag reichte und wir nicht wissen mussten, wie jeder Bauer in jeder Region gelebt hatte. Außerdem schloss das Museum bald seine Pforten. Nach diesem ereignisreichen Tag begaben wir uns also zurück zur Bushaltestelle und nach Seoul. Von der Rückfahrt bekam ich nicht viel mit, da ich in einem seligen Halbschlaf vor mich hinschlummerte. Es war ein gelungener Tag.
Unser letzter Tag in Seoul war schlichtweg phänomenal. Anfangs dachten wir, dass es in Stress ausarten könnte, weil wir uns von so vielen Leuten verabschieden wollten. Am Ende wussten wir aber nicht, wie wir uns hinlegen sollten, weil wir so vollgefuttert waren.
Es begann damit, dass Anneena, die dank Schulferien endlich mal ein bisschen Zeit hatte, uns noch einmal vor unserer Abreise sehen wollte. Das machten wir gerne, immerhin wollten wir uns für das leckere koreanische Grillen bedanken und diesmal die Runde stellen. Nach einigem Hin und Her bezüglich Essenswünschen schlug sie dann ein Restaurant in Sillim vor, das ein All you can eat Buffet mit zahlreichen koreanischen Speisen anbot. Sie war von dem Angebot derart überzeugt, dass sie uns das Versprechen abrang davor nichts zu essen. Davon noch nicht genug: Es war ein Bio-Restaurant mit qualitativ hohen Standards.
Zum Zeitpunkt unserer Zusage wussten wir von alledem noch nichts. Wir freuten uns nur auf einen lustigen Vormittag mit unserer kleinen Englischschülerin. Selbstverständlich konnten wir das Versprechen ihr gegenüber nicht halten, denn wer mich einmal ohne Frühstück erlebt hat, gibt mir freiwillig seine Portion ab. Wie dem auch sei, die Zeit zwischen Frühstück und Lunch war großzügig genug bemessen, so dass ein kleines Mahl am Morgen niemandem einen Abbruch tat. Fast pünktlich kamen wir dann auch am vereinbarten Treffpunkt aus, wo Anneena mit ihrer Mutter uns schon erwarteten.
Nur wenige Schritte vom Ausgang 3 entfernt waren wir auch schon im angepriesenen Restaurant. Ich gebe gerne zu, dass es schon von Anfang an vielversprechend aussah und meine Erwartungen im Laufe des Essens übertraf. Wir bekamen schnell einen Tisch – was ein Glücksfall war, wie wir schnell herausfanden, da der große Gästeandrang erst eine halbe Stunde nach unserem Eintrudeln begann –, ließen unsere Sachen (alles, inklusive Wertsachen, die man einfach offen auf den Tisch legen durfte) dort und folgten gehorsam Mutter und Tochter zum reichen Buffet. Sie erklärten uns, was die Speisen waren und wie wir sie zu essen hatten; wir stellten fest, dass die Teller viel zu klein waren, um sich mit einer Portion zufrieden zu geben. Es gab schlichtweg alles, was die koreanische Küche zu bieten hat, und mehr. Gemüse, Obst, Fleisch, Bingsu, Eis, Nachtisch, Beilagen, Reis, gebraten, frittiert, gekocht, gedämpft, gedünstet, geschwenkt und so viel man wollte. Getränke waren auch schon im Preis inbegriffen.
Wir wussten gar nicht, wo wir anfangen sollten, also griff ich beliebig zu und packte alles auf meinen Teller, bis dieser fast schon überquoll. Jeder einzelne Bissen war ein Hochgenuss. Wir alle schlugen uns den Bauch voll, bis wir nach Hause rollen mussten, denn es kam nicht in Frage zu gehen, bevor wir noch dieses eine letzte Stückchen probiert hatten. Es war köstlich.
Durch ein Fenster konnten wir beobachten, wie die Schlange vor dem Lokal länger wurde. Verständige Marketingfachleute hatten Bänke vor dem Restaurant aufgestellt, um ihren Gästen das Warten erträglicher zu machen. Überraschenderweise war auch Anneenas Tante unter den Wartenden. Die Damen unterhielten sich einige Zeit in ihrer Muttersprache, während ich nur lächelnd daneben saß.
Nach fast zwei Stunden machten wir uns dann wieder auf den Weg – unsere Zeit wäre eh gleich abgelaufen. An der Kasse angekommen, drängelte sich Anneenas Mutter vor und zahlte, obwohl wir darauf bestanden. Sie redete sich damit heraus, dass sie nur glücklich darüber war, dass ihre Tochter jemanden gefunden hatte, mit dem sie Englisch reden konnte. Ich finde, bei dem Deal haben wir sehr gut abgeschnitten.
Auf dem Weg nach draußen fragte Anneena uns, ob wir Stickerfotos kennen würden. Wir beide verneinten und brachten damit einen Stein ins Rollen, der uns beide umwarf. Zielsicher suchte das junge Mädchen einen Laden auf, in dem man spaßige Fotos schießen konnte. Wir bekamen Perücken, wahlweise auch Haarreife mit Öhrchen oder Schleifchen drauf, komische Brillen und durften damit in eine Kabine, in der man mehrere Motive in einer Sitzung schießen konnte. Den Hintergrund suchte man auch selbst aus. Es war ein bisher unbekanntes Erlebnis für sowohl Franziska als auch mich, weshalb wir stellenweise ein bisschen überrascht und verständnislos dreinblickten, weil wir einfach nicht wussten, was von uns erwartet wurde. Anneena hingegen, die damit groß geworden war, überging einige Erklärungen, die ihr selbstverständlich schienen, uns aber ein bisschen besser auf die Sache vorbereitet hätten. Ende vom Lied war eine Ansammlung von lustigen Bildern vor unwirklichen Hintergrundmustern mit komischen Beschriftungen. Es war perfekt. Um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, bekamen wir die Motive in verschiedenen Größen als Sticker ausgehändigt. Wir teilten sie untereinander auf, so dass jeder seinen eigenen Aufkleber als Erinnerung behalten konnte, und zogen weiter, um noch einen Kaffee zu trinken. Dieses Mal ließen wir uns nicht übers Ohr hauen und beglichen die Rechnung dank einer ordentlichen Portion Ellbogengebrauchs.
Zum ersten Mal seit sechs Monaten schlürfte ich wieder genüsslich an einem Assam-Tee. Es war ein Genuss ohne Gleichen, jeden einzelnen Won wert, perfekt, selbst bei der draußen herrschenden Hitze. Wir unterhielten uns über diverse Themen, die alle sehr bodenständig waren, mussten uns dann aber schon langsam wieder auf den Weg machen. Wie gesagt, der Tag drohte dank Termindruck in Stress auszuarten.
Zurück im Hostel hatten wir einen Moment Zeit, um Luft zu holen, bevor es in die nächste Runde ging. Für unseren Abschied hatten wir unseren Gastgebern ein Abschiedsessen mit Kartoffelgerichten versprochen. Dafür mussten wir allerdings noch einige Sachen einkaufen und das Essen selbstverständlich auch vorbereiten. Ein Ausflug in den Supermarkt war eh geplant, da wir noch einige Snacks für die anstehende Reise zu erwerben hatten, und auf diese Weise konnten wir alles in einem Rutsch erledigen.
Jeder machte ein bisschen mit, aber aus Ermangelung an ausreichendem Kochmaterial konnten viele Sachen nur der Reihe nach abgearbeitet werden. So oder so zauberten wir gemeinsam ein köstliches Mahl, das aus Ofenkartoffeln, Labskaus und Kürbispfannkuchen bestand, wobei letzteres unsere Gastgeberin Seol Hee zubereitete. Die Tische quollen praktisch über. Wer heute hungrig ins Bett ging, hatte irgendetwas falsch verstanden. Es war zwar viel zu tun, aber stressig wurde es dennoch nicht, zumal niemand sich daran störte, dass wir einige Minuten länger als geplant brauchten.
Tatsächlich schaffte auch June es noch an diesem Abend vorbei zu kommen, um sich von uns zu verabschieden. Da es letzten Sonntag ein bisschen hektisch zugegangen war und er ausnahmsweise nachmittags statt morgens gearbeitet hatte, mussten wir befürchten, dass wir uns nicht mehr gebührend von ihm verabschieden würden. Letzten Endes war alle Sorge unberechtigt. Wir beide bekamen von ihm zum Abschied ein buddhistisches Armband und erfuhren so ein bisschen mehr über den mysteriösen Kerl.
Dann aber überraschten mich unsere Gastgeber mit einer umwerfenden Geste: Sie brachten Küchelchen mit Geburtstagskerzen drauf herein. Da ich einige Tage vor meinem tatsächlichen Geburtstag abfuhr, erklärten sie kurzerhand diesen Abend zu meiner Geburtstagsfeier. Mit dieser Überraschung hatte ich nun wirklich nicht gerechnet. Ich war hingerissen.

Zum Abschluss gab es noch eine Partie Kicker, gefolgt von weiteren Spielen zwischen verschiedenen Gegnern. Das nenne ich einen perfekten Abend.
... link (0 Kommentare) ... comment
Sonntag, 10. Januar 2016
Seoul – Juni-August 2015 (Lustiges)
atimos, 10:29h

Namsangol Hanok Village
Nicht weit der Myeongdon-Haltestelle gab es eine kleine Ansammlung traditioneller koreanischer Häuschen, die sich in einem abgeriegelten Dörfchen gruppierten. Dieses Dorf aus der Joseon Ära bot uns die Möglichkeit einen Blick auf den Lebensstil der Koreaner vor einigen Jahrhunderten zu werfen. Wenn man zur richtigen Zeit kam und sich vorher anmeldete, konnte man sogar einige traditionelle Sachen mitmachen. Darunter fielen beispielsweise Hochzeitszeremonien. Leider waren wir nicht zur richtigen Zeit da, denn wir mussten arbeiten, so dass wir unglücklicherweise auch die letzte Teak Won Do-Vorführung verpassten. Nächstes Mal holen wir es nach. Wir hatten allerdings das Vergnügen einen Einblick in die traditionelle asiatische Medizin zu erlangen. Dazu später mehr.
Zuerst besuchten wir einen Souvenirladen nahe dem Korea-Haus, wo wir endlich die ersten Postkarten sahen. Hier lernten wir auch, dass man Postkarten in Korea meist in Packen bekommt, die thematisch sortiert sind. Schade aber auch, denn diese hier bezogen sich nur auf das Hanok Dorf nebenan und rissen mich nicht vom Hocker. Ich musste weitersuchen.

Der Eintritt war auch hier frei, so dass wir uns begeistert auf den Erkundungsweg machten. Am Anfang stand eine Reihe von Pappfiguren mit Löchern statt Gesichtern für all jene Besucher, die sich als Prinzessin, Krieger, Bauer oder eine andere Persönlichkeit der damaligen Zeit ausgeben wollten. Ich ließ es mir nicht nehmen, als Ritter in strahlend schwarzer Rüstung zu posieren.
Es gab wesentlich weniger Häuser als in den Palästen, die wir zuvor besichtig hatten, aber dennoch war es alles sehr interessant. Die Häuser waren weiß getüncht und an manchen Stellen lugten Holzbalken hervor. Niedrige Steinmauern umgaben einzelne Bauten oder ganze Komplexe. Franziska fand ihr perfektes Studienzimmer, das nach Süden lag und einen ungehinderten Blick auf den kleinen Teich gewährte. Für meinen Geschmack war es ein bisschen zu beengt. Leider durfte sie es nicht mitnehmen. Wir bekamen Einblicke in die Lebensweise verschiedener Klassen, auch wenn der Großteil der Räumlichkeiten offensichtlich den Reichen gehört hatte.


Ein besonderes Highlight war die traditionelle, asiatische ärztliche Untersuchung, zu der wir eingeladen wurden. In einem der Häuser hatte man ein ganzes Lazarett aufgebaut: Da gab es Monitore, die Filme zeigten, Monitore, die Werte wiedergaben, Maschinen, die verschiedene Körperfunktionen maßen, und viele Leute in altmodischen Ärztegewändern. Es begann damit, dass wir in Schubladen gesteckt wurden – im übertragenen Sinn. Anhand einiger kurzer Beschreibungen sollten wir herausfinden, welcher Typ Mensch wir sind, kalt oder warm. Was mich überhaupt nicht überraschte, war die Tatsache, dass Franziska und ich auf gegensätzlichen Seiten standen. Nach dieser ersten, kurzen Einschätzung bekamen wir einen kostenlosen Tee, der selbstverständlich auf unser Naturell abgestimmt war. Dann drückte man uns einen Fragebogen in die Hand, der Antworten auf unser alltägliches Verhalten inklusive Schlaf- und Essgewohnheiten verlangte. Wir beantworteten diese nach bestem Wissen und Gewissen, woraufhin wir dann die erste Untersuchung über uns ergehen lassen durften.
Diese war antiklimaktisch. Man maß unseren Blutdruck und Puls. Die Gerätschaften, die dazu verwendet wurden, wirkten in meinen Augen alles andere als traditionell, denn ich hatte sie auch schon bei Ärzten, in Krankenhäusern und in Arztserien gesehen. Aber wir wollten der Sache unvoreingenommen gegenübertreten, so dass wir einfach mal mitmachten. Nachdem dies erledigt war, gingen wir ins Sprechzimmer der führenden Ärztin. Ihre Englischkenntnisse bewegten sich in nicht allzu hohen Sphären, so dass ein junger Mann für sie übersetzen musste. Ich fand es anstrengend, beiden gleichzeitig zuzuhören, weil sie einerseits sehr bestimmt redete, ich aber kein Koreanisch verstand, und er übersetzte, sich aber nicht traute sie zu übertönen. Trotzdem hatte ich dabei meinen Spaß.
Franziska war ein viel interessanterer Studienfall als ich. Die Ärztin sagte ihr sogar in die Augen: „You are very pale. That’s beautiful, but you look dead.“ („Du bist sehr blass. Das ist sehr schön, aber du siehst tot aus.“) Dann sah sie Franziska ins Gesicht, ließ sich die Zunge entgegenstrecken und stellte eine Diagnose. Im Anschluss ratterte sie eine Liste von Lebensmitteln runter, die meine Begleitung vermehrt zu sich nehmen sollte, gefolgt von einer ebenso langen Liste an Sachen, die sie vermeiden sollte. Eine besonders wichtige Empfehlung war, dass Franziska einen Freund brauchte, der sie zum Lachen brachte, weil das ihr am meisten helfen würde. Wir waren alle sehr amüsiert über diese Einschätzung. Zum Abschluss gab es noch ein Pülverchen, das sie einige Tage nehmen sollte, damit es ihr ein bisschen besser ging. Es war auf pflanzlicher Basis.
Es folgte eine ähnlich Prozedur bei mir, nur dass ich wesentlich besser dabei abschnitt und mir weniger Einschränkungen auferlegt wurden. Meine Lebensmittelempfehlungen deckten sich mit Sachen, die ich eh mochte, also beschloss ich so weiter zu machen, wie gehabt. Auch ich bekam einige Beutel mit Pulver, was allerdings eher vorsorglicher Natur war. Ich probierte diese tatsächlich, entschied, dass es scheußlich schmeckte, und verschenkte den Rest.
Dies alles kostete uns keinen Won, machte aber einen Heidenspaß.

Wir zogen weiter durch den angrenzenden Park, vorbei an einem Theater, vorbei an einigen Kleinmuseen zu lokalen Künstlern, einen Hügel hinauf, um von dort auf die Zeitkapsel hinunter zu blicken.
Die Zeitkapsel wurde 1994 eingeweiht, weil dies das Jahr war, in dem Seoul seit 600 Jahren Hauptstadt Koreas war. Diese Kapsel beinhaltete zahlreiche kulturelle Schätze und sollte die nächsten 400 Jahre überdauern, um für künftige Generationen ein kulturelles Erbe darzustellen. In einer kreisrunden Vertiefung befand sich eine ebenso runde Steinplatte aus mehreren Segmenten umgeben von einem Pfad, so dass man das Monument von allen Seiten betrachten konnte. Sie war enorm. Darauf standen einige Inschriften in verschiedenen Sprachen, die von den Vertretern der jeweiligen Länder stammten. Ein sanft gewundener Pfad führe in einem sachten Gefälle hinunter. Natürlich schlugen wir diesen Weg ein und betrachteten alles aus der Nähe. Es war seltsam leer dort unten.

Auf dem Rückweg zur Haltstelle entdeckten wir nicht nur eine, sondern zwei auffällige Geschäfte, die sofort unsere Aufmerksamkeit erregten. Es handelte sich um Bäckereien. Das mag jetzt nun ein bisschen lapidar klingen, schließlich gab es ein Tous Les Jours oder Petit Baguette alle paar Schritte, aber es waren eben ausgefallenere Läden. Denn diese Bäckereien versprachen Brot. Richtiges Brot. Seit nunmehr fast sechs Monaten von diesem in Deutschland so alltäglichen Grundnahrungsmittel abgeschnitten, zögerten wir keinen Augenblick den erstbesten Laden zu stürmen. Dem Verkäufer entging unsere Begeisterung keineswegs, ebenso wenig wie er bei unserer Herkunft falsch lag. Er erklärte uns, dass er sehr viele deutsche Kunden hatte und sie mittlerweile sehr gut von anderen Westlern unterscheiden konnte. Vor allem sie suchten richtiges Brot und wussten, worauf es ankam. So wie wir eben. Er sprach sogar einige Standardsätze Deutsch. Wir waren begeistert. So kauften wir ein halbes richtiges (!!) Brot und zwei Scones mit Schokoladenstückchen. An diesem Abend gab es ein kleines Festmahl.

Wenn ich schon einmal dabei bin, kann ich hier einen weiteren Abschnitt über Speisen und Essgewohnheiten einbringen. Ach, ich fasse jetzt einfach alles zusammen.
Überhaupt nahm das Essen einen sehr großen Stellenwert ein. Ich fühlte mich mehrfach wie bei meiner Großmutter, die auch glaubt, jedes Problem mit einem ordentlichen, gut bürgerlichen Mittagessen beheben zu können. Wichtig war, dass immer genug für alle auf dem Tisch stand; besser noch, wenn es zu viel war. Erst wenn jeder Gast vom Tisch wegrollte, war es ein gutes Mahl.
Praktisch jedes Lokal und Restaurant, inklusive Fastfoodketten, hatte einen Lieferservice. Man konnte so gut wie jedes Gericht zu einem Spottpreis ins Haus bestellen, es wurde in einer großen Box heißt (also, wirklich brodelnd heiß) serviert, so dass man sich an den Edelstahlreisbehältern die Finger verbrühte, und wenn man mit dem Essen fertig war, kam der Lieferant zurück, um das benutzte Geschirr abzuholen. Ein hervorragender Service.
Wenn wir das Essen nicht kommen ließen, gingen wir zu einem nahegelegenen Restaurant, das ein kostengünstiges All you can eat-Mittagsbüffet anbot. Dort bedienten wir uns nach Herzenslust an verschiedenen Speisen und kamen so in den Genuss verschiedener koreanischer Köstlichkeiten, von denen wir bis dato keine Ahnung hatten, dass sie existierten.

Darunter waren Kleinigkeiten, wie beispielsweise (in Deutschland) ungewöhnliche Reismischungen oder in Algenblätter gewickelte Glasnudeln, oder aber es waren ganze Gerichte, die wir zum ersten Mal sahen, wie es mit einigen Suppen oder Entenbruststreifen der Fall war. Jedenfalls war immer für jemanden etwas dabei, auch wenn nicht jeder alles mochte. Ich verzichtete selbstverständlich auf Scharfes, während Franziska Fischkuchen mied.
Eines Tages gingen wir zu Mapo Mandu, einem Restaurant in der Nähe, das sich auf die Zubereitung von Mandu, also koreanischen Maultaschen, spezialisiert hatte. Dies gab uns die einmalige Gelegenheit etwas über koreanische Ausgehgewohnheiten zu lernen, denn unsere Mitarbeiterin Amy begleitete uns. Wahrscheinlich besser so, denn ich weiß nicht, wie weit wir ohne ihre Übersetzerfähigkeiten gekommen wären. Wir kamen ins Lokal, setzten uns an einen freien Platz, bekamen sofort unaufgefordert gekühltes Wasser mit Bechern serviert und Speisekarten in die Hände gedrückt. Amy, ganz souverän in ihrem Verhalten, schob eine Schublade an der Seite des Tisches auf und holte daraus Besteck hervor. Sie schien nicht zum ersten Mal hier zu sein. Nachdem wir uns geeinigt hatten, welche Füllungen wir wollten, schrie die junge Dame unsere Bestellung durch den Raum. Franziska sah mich baff an; ich blickte nicht weniger verdutzt drein. Aber das schien hier gang und gäbe. Niemand außer dem Personal schien sich angesprochen zu fühlen; kein Gast empörte sich. Als die Maultaschen dann dampfend auf dem Tisch standen, frage Amy uns noch, ob wir bereits Kimbap kannten. Wir verneinten wahrheitsgemäß, was die junge Dame damit quittierte, dass sie gleich lauthals eine Rolle für uns bestellte. So durfte sie uns nicht nach Hause gehen lassen. Dann gab es noch eine Portion Ramyeon für alle, und wir hatten kein Recht mehr zu meckern. Es war genug. Allerdings war das Ramyeon ziemlich scharf, weil dieser Laden keine anderen Varianten anbot. Immerhin war das ein Ort für Mandu, nicht für Ramyeon. So musste ich diese schmerzhafte Prozedur des Essens über mich ergehen lassen – und überlebte sie tatsächlich.
Das Schöne dabei, dass immer Koreaner für uns bestellten, war die Tatsache, dass wir tatsächlich authentische Gerichte bekamen. Franziska musste sich keine Sorgen machen, dass ihr extra-super-scharfes Gericht XZY vielleicht weniger scharf ausfallen würde, als sie es sich wünschte, weil die Restaurantbesitzer am anderen Ende der Leitung davon ausgingen, dass sie es für Landsleute herrichteten. Das erwies sich bei einem Hähnchengericht in feurig roter Sauce als fatal. Nicht für Franziska, sie fand es herrlich. Die Koreaner um sie herum allerdings weinten vom bloßen Hinsehen. Ich befürchte, diese blasse Ausländerin hat ihren Nationalstolz gekränkt.
Vom Schärfegrad des Essens gab es noch andere Herausforderungen, denen wir uns am koreanischen Mittagstisch stellen mussten. Ja, wir beherrschten die Nahrungsaufnahme mit Stäbchen ganz gut, auch wenn die koreanische Variante dieses Bestecks durch ihre Form gewisse Tücken aufweist. Im Gegensatz zu ihren Nachbarn benutzen Koreaner abgeflachte Metallstäbchen ohne irgendwelche Rillen, so dass das Essen gerne abrutscht.

Aber sie sind Meister ihrer Klasse und nach kurzer Zeit waren wir es auch – annähernd zumindest. Wenn es um mundgerechte Happen ging, war es jedenfalls bald kein Problem. Was allerdings bis zum Ende unseres Aufenthaltes viele Schwierigkeiten bereitete, waren die zwei Königsklassen der koreanischen Cuisine: Hähnchen und Fisch.
Beides bekam man am Stück serviert, manchmal waren es nur Hähnchenschenkel oder –flügel, oft war es ein ganzer Fisch. Die Bewohner dieses Landes verstanden sich wunderbar darauf, diese Lebensmittel fachgerecht zu sezieren. Hähnchenschenkel nahm man mit den Stäbchen in den Mund, knabberte sie sorgsam ab (immer noch mit den Stäbchen haltend) und legte die blanken Knochen dann behutsam auf einen Teller. Ich guckte nur dumm aus der Wäsche, wenn ich das sah. Fisch war noch ein ganz anderes Thema. Während die anderen bereits mit ihrem Teil durch waren und sich an allem anderen zu schaffen machten, versuchte ich immer noch verzweifelt das Fleisch von den Gräten zu trennen. Dabei kam ich mir wie ein unmündiges Kind vor und ich könnte drauf schwören, dass mir amüsierte Blicke zugeworfen wurden. Niemand verriet mir den Trick dahinter. Aber nach einiger Zeit schaffte ich auch das. Es dauerte nur länger.
Im Gegensatz dazu stellten die koreanischen Pfannkuchen keine Herausforderung mehr dar. Die abgeflachten Kanten der Stäbchen fungierten hier wunderbar als Schneidwerkzeuge. Im Handumdrehen hatte man einige mundgerechte Happen.

Wurden wir anfangs noch gefragt, ob wir überhaupt mit asiatischem Besteck umzugehen wussten, folgte schon bald ein anerkennendes Erstaunen darüber, wie gut wir mit Stäbchen essen konnten. Tatsächlich wurden wir mehrfach gelobt, wie wir die Stäbchen hielten und benutzten. Wir fragten und fragten und fragten, was man denn dabei falsch machen konnte. Es dauerte lange, bis uns jemand erklärte, dass es mit guter oder schlechter Erziehung zu tun hatte, wie man die Stäbchen hielt. Über Kreuz oder parallel oder was auch immer man sich ausdachte. Letzten Endes lief es darauf hinaus, dass es nur eine Frage der Etikette war und von guten oder schlechten Manieren zeugte. Aber niemand schien unser Anliegen auf Anhieb zu verstehen, wodurch wir mehrere Anläufe brauchten, um unsere Frage verständlich zu stellen.
Dann gab es noch diese wunderbaren Tage, an denen Martin für uns kochte. Nur für uns, nur für die Crew. Martin konnte wirklich gut kochen. Als er eines Tages versehentlich zu wenig für uns auftischte, entschuldigte er sich noch Tage später dafür. Es kam aber auch nur einmal vor. Es waren meist simple Gerichte, die er zauberte, gutbürgerlich würde man sie hierzulande nennen. Aber das hieß nicht, dass sie dadurch an Qualität abnahmen. Selbst wenn wir uns etwas liefern ließen, wusste er immer noch einen Kniff, wie man die eh schon hervorragende Speise ein wenig aufpeppen konnte.
Diesbezüglich möchte ich ein riesiges Lob an unsere Gastgeber aussprechen: Sie kümmerten sich wirklich vorzüglich um unser leibliches Wohlergehen.
Erwähnenswert sind zudem zwei Ketten, die es wirklich überall in Korea gibt: Paris Baguette und Tous les Jours. Beides sind koreanische Unternehmen, die sich auf die Verbreitung von vermeintlich europäischen Backwaren spezialisierten. Ich wage allerdings stark zu bezweifeln, dass es viele Europäer gibt, die süßes Backwerk der Geschmacksrichtung „grüner Tee“ oder Milchbrötchen mit süßer Bohnenpaste zu ihrer täglichen Diät zählen. Man fand dort wirklich alles, was europäisch angehaucht war: Croissants, Baguettes, Kuchen, Teilchen, auch Herzhaftes, mit Käse Überbackenes. Laut stolzer Überschrift war alles authentisch französisch. Es gab schon viele leckere Speisen in beiden Ketten zu probieren, alles, was ich zum Ausdruck bringen möchte, ist mein Zweifel an der Behauptung, dass auch nur eines der Produkte oder Rezepte jemals Frankreich gesehen hatte. Daher möchte ich jeden Koreabesucher dazu auffordern einen Blick hinein zu werfen, sich ein beliebiges Teilchen zu schnappen und sein eigenes Urteil zu fällen.
Seol Hee teilte uns nach einem Besuch bei der Familie mit, dass sie von ihrem Großvater Maiskolben aus dem eigenen Garten erhalten hatte. Leider kannte sie keine Zubereitungsart. Weder Franziska noch ich waren in dieser Kunst sonderlich bewandert, aber wir hatten Brendon damals zugesehen und zeigten uns zuversichtlich, dass wir etwas Leckeres zaubern würden. Obwohl die Ausstattung der Küche nur rudimentärer Natur war, machten wir uns an die Arbeit. Wir entschieden uns dafür, die Maiskolben zu halbieren und in Salzwasser zu kochen. Nein, wir kannten kein anderes Rezept. Als Kochzeit setzte Franziska erst einmal 10 Minuten an, doch wir stellten fest, dass aufgrund der Ermangelung eines Deckels mehr Zeit vonnöten war. Die hungrige Meute hatte sich bereits vor der Theke versammelt, doch wir waren noch immer nicht fertig. Nervös schritt ich in der Küche auf und ab. Ich war mir nicht sicher, ob wir die Kollegen noch lange vom Essen, obwohl noch roh, fernhalten konnten. Endlich beschloss meine Reisebegleitung, dass es Zeit war, den Tisch zu decken.
Wir packten Salz, Butter und Maiskolben auf die Tafel, doch Seol Hee holte ihre Geheimwaffe raus: ein bestimmtes Gewürzpulver.
Ich glaube, das Geheimnis darin bestand aus Glutamat und Hefeextrakt, aber ich konnte die Zutatenliste nicht entziffern. Wie dem auch sei, dieses Wundermittel reichte unserem Jüngsten aus, seinem Leben neuen Sinn zu geben. Er schnitt ein Stückchen Butter ab, tunkte es in das Gewürzpulver und aß es vom Messer – mehrere Male.
Wir sahen den Jungen fassungslos an. Er blickte verständnislos zurück, bevor er grinste. Wir erklärten ihm, dass man in Deutschland Butter nicht pur aß. Er antworte: „It’s gwaenchanh-a in Korea.“ („Es ist okay in Korea.“) und aß weiter. Allerdings dauert es nicht lange, bis er seine Entscheidung bereute, denn Bauchschmerzen waren die Folge dieser doch eher ungesunden Kombination.
Trotzdem sahen wir alle den Abend als vollends gelungen an.
An dieser Stelle lohnt sich die Beschreibung eines einzigartigen Phänomens, das ich selbst nicht so ganz verstehe: meine Kommunikation mit Jae Won.
Wie bei so vielen Koreanern waren die Englischkenntnisse von unserem jungen Mitarbeiter nicht so weit ausgeprägt, dass er eine anspruchsvolle, zusammenhängende Konversation in dieser Sprache hätte betreiben können. Tatsächlich stellten sogar einfache Sätze eine Herausforderung für ihn dar, was zusätzlich daran lag, dass er sich nicht traute Englisch zu sprechen. Aber irgendwie mussten wir uns verständigen, um ordentlich zusammenarbeiten zu können, ohne unnötige Umwege über einen Dolmetscher zu gehen. Bei meinen praktisch nicht vorhandenen Koreanischkenntnissen und seinem Äquivalent in englischer Sprache schien dies ein unüberwindliches Hindernis zu sein. Nur zu Anfang, wie sich herausstellte. Denn obwohl wir beide keinen gemeinsamen Nenner verbaler Ausdrucksweisen fanden, verstanden wir uns ganz gut. Er sprach Koreanisch untermalt mit einigen Gesten, ich antwortete mit einfachen Worten auf Englisch mit Gesten, wir beide bekamen das, was wir wollten. Manchmal mussten wir uns wiederholen, doch das passiert nun einmal. Es waren fast schon richtige philosophische Gespräche darunter. Diese Art der Verständigung ging so weit, dass ich sogar Unterhaltungen zwischen Jae Won und anderen in groben Zügen verstand – vorausgesetzt Jae Won sprach. Die Spitze war aber erreicht, als mein ungleicher Kommunikationspartner sich eines Tages wortlos auf ein Fahrrad schwang, sich nur von uns verabschiedete, Franziska mich fragte, wohin er fuhr, ich ihr erklärte, dass er Zigaretten holen musste, und damit richtig lag. Da soll noch einmal jemand sagen, Völkerverständigung wäre nicht möglich.
Bukchon Hanok Village
Im Gegensatz zum Namsangol Hanok Dorf war das Bukchon Hanok Dorf kein in sich abgeschlossenes Gelände mit altertümlichen Häusern, sondern ein Stadtteil von Seoul, in dem alte Häuser standen und bis heute von Leuten bewohnt wurden. Dementsprechend war es offen zugänglich. Umgekehrt konnte man sich die Häuser nicht von innen ansehen, weil es die Bewohner womöglich stören könnte. Wie dem auch sei. Wir wollten uns diesen anachronistischen Teil der Millionenmetropole zu Gemüte führen und brachen eines Nachmittags dorthin auf.

Wir stiegen an der Haltestelle Anguk aus, gingen die Treppen hoch, nahmen eine beliebige Straße in die richtige Richtung und spazierten – mehr oder weniger – zielsicher durch Alleen und Gassen. Im Gegensatz zur Umgebung waren die Häuser hier niedrig, bestanden zumeist aus nicht mehr als dem Erdgeschoss, die Dächer hatten die in Europa bekannte geschwungene Form und kleine Grundstücke umgaben die Gebilde. Es war interessant einige Schilder zu sehen, die Besucher dazu aufforderten Rücksicht auf die Einwohner zu nehmen und möglichst leise zu sein.
Franziska hatte sich einen traditionellen Handwerksladen ausgesucht, in dem sie ein Andenken käuflich erwerben wollte. Diesen suchten wir nun, doch obwohl es viele Schilder gab, die Richtungen und Entfernungen anzeigten, waren wir nicht so ganz sicher, ob wir dem rechten Weg folgten. Bis wir durch eine enge Straße schritten und praktisch direkt davor standen. Es war allerdings ein bisschen seltsam. Immerhin wussten wir, dass dies hier ganz normale Wohnhäuser waren, und das Äußere machte dies auch deutlich: parkende Autos vor den Garagen, Spielzeuge in Gärten und dergleichen. Vor ungefähr so einem Haus standen wir auch, doch die Tür zum Hof stand sperrangelweit offen und ein kleines Schild an der Wand machte auf einen Handwerksbetrieb aufmerksam. Unsicher wagten wir uns hinein. Uns begrüßte tatsächlich ein kleiner Laden, doch schien dieser geschlossen zu sein. Die mit Holz verkleideten Türen ließen nur begrenzte Einblicke ins Innere zu, so dass wir nicht sicher waren, ob jemand drinnen war. Es gab kein Schild an der Tür, das uns hätte helfen können. Wir versuchten es trotzdem und betätigten die Türklinge – woraufhin wir belohnt wurden.
Der urige Laden war geöffnet und es gab einen verdammt guten Grund für die geschlossene Eingangstür: Während sich draußen der Sommer in vollen Zügen austobte, herrschten drinnen Temperaturen um den Gefrierpunkt (übertrieben gesprochen, versteht sich). Zwei Damen begrüßten uns freundlich, um sich dann wieder an die Arbeit zu machen. Hier wurden verschiedene Schmuckstücke aus Stoff hergestellt, allem voran Accessoires der Knotenkunst. Aber es gab auch einige prachtvolle Fächer. Franziska interessierte sich für Armbänder mit diesen zierlichen Knoten, die selbstverständlich auf eine bestimmte Weise kunstvoll gebunden waren und verschiedenen Farben zur Schau trugen. Nach einiger Zeit entschied sich meine Begleitung für einige Exemplare, so dass wir unsere Wanderschaft fortsetzen konnten.
Da wir den Sinn und Zweck dieses zielsicheren Ausflugs bereits so zeitig hinter uns bringen konnten, vertrieben wir uns die nächsten Stunden (oder war es nur eine?) damit, uns in diesem überschaubaren Gewirr aus Straßen, Häusern und Gassen zu verlaufen – mit mäßigem Erfolg. Es war einfach zu klein und übersichtlich. In den zahlreichen Fußgängerzonen fanden wir den ein oder anderen interessanten Laden mit traditionell koreanischen Kleinigkeiten. Dieses Mal war es aber offensichtlich, dass es sich um Geschäfte handelte.

Eine Straße war richtig klasse gearbeitet: Während man (von unserer Warte aus) rechts einige alte Häuser hatte, die sich an eine Hügelflanke kuschelten, war links die Straße. Ab einem gewissen Punkt wurde der Bürgersteig immer enger und stieg an. Während man also immer noch einige Stufen zu verschiedenen Läden und Wohnhäusern hochklettern musste, konnte man auf der anderen Seite auf den Verkehr hinunter blicken. Bäume säumten den Fahrbahnrand und ließen den Fußgängern noch weniger Platz. Trotzdem schien es keine Probleme zu geben.

Als wir gerade dort unterwegs waren, fanden wir einen Bereich zu unserer Linken, der durch viele Wagen und Kameraleute abgesperrt war. Leider konnten wir auf die Schnelle nicht herausfinden, was vor sich ging.
Hier lohnt es sich noch zu erwähnen, dass Bukchon gerne als Filmset für diverse koreanische Dramen und Fernsehserien verwendet wird.
Changdeokgung Palace
Man kann wirklich nicht behaupten, dass Seoul zu wenige Paläste zu bieten hätte. Man kann ebenso wenige behaupten, dass wir bereits genug davon gesehen hatten. Daher entschieden wir uns für einen Besuch des Changdeokgung Palastes, der unweit vom Bukchon Hanok Dorf seine Pforten für begeisterte Gäste öffnet. Es war mal wieder ein großes Gelände mit angrenzendem Verborgenen Garten, doch obwohl wir an beides an verschiedenen Tagen besichtigten, fass ich es hier der Einfachheit halber zusammen.
Es fällt mir schwer, ein konkretes Merkmal zu finden, an dem ich unsere Entscheidung festmachen kann, aber sowohl Franziska als auch mir gefiel dieser Palast am meisten von all jenen, die wir während unseres gesamten Aufenthaltes gesehen hatten. Daher zeige ich hier nur einige Impressionen

Wir besuchten den Changdeokgung Palast im Juli, so dass die üblichen Kosten von 3.000 Won entfielen – nur für die Führung durch den Verborgenen Garten mussten wir zahlen, aber es war ein vertretbarer Preis. Fangen wir am Anfang an.
Kaum waren wir durch das riesige Eingangstor getreten, fanden wir uns in einem Vorhof wieder, in dem einige Bäume ein Kanalufer säumten. Wasser war dieses Jahr allerdings Mangelware, so dass nur der Boden der breiten Rinne mit dem nassen Element bedeckt war; an einigen Stellen war der Strom gänzlich versiegt. Wie immer trennten kleine Mäuerchen die einzelnen Elemente dieser Anlage voneinander. Dieser Palast strotzte geradezu vor Rot.


Die meisten Wände waren mit dieser speziellen Farbe bedeckt, Säulen folgten ihrem Beispiel, nur die Deckenbalken behielten ihr typisches Grün bei. Die Flächen zwischen den Gebäuden waren unterschiedlicher Natur: manche waren einfach nur mit Staub und Sand bedeckt, andere hielten kleine Grünflächen für die Besucher bereit. Stein und Holz wechselten sich als Baumaterialien ab. Es gab einen achteckigen Pavillon, den wir unbedingt sehen wollten, aber alle Wege dorthin waren versperrt, so dass wir enttäuscht und unverrichteter Dinge von dannen ziehen mussten. Vielleicht klappt es nächstes Mal.

Der Anbau zu diesem opulenten Palast war später und in einem anderen Stil erbaut worden. Statt der roten Farbe beherrschten hier dunkle Holzbalken und weißer Putz das Bild. Die niedrigen Mauern waren oftmals durch symmetrische Muster geschmückt. Alles in allem diente die gesamte Konstruktion einem ästhetischen Zweck – mal von ihrem eigentlichen, praktischen abgesehen. Die Häuser waren ineinander verschachtelt, bildeten die Umrisse kleiner Labyrinthe, so dass man sich in diesem Komplex gut und gerne verlaufen konnte. Straßen führten auf Höfe, Treppen verbanden verschiedene Ebenen miteinander, bog man um eine Ecke, fand man sich in einer Sackgasse wieder, ging man zurück, lief man Gefahr die falsche Abzweigung zu nehmen und irgendwo anders herauszukommen. Wir hielten uns gerne dort auf und machten nicht die geringsten Anstalten, uns mit unserer Besichtigung zu beeilen. Es war eine hervorragend geplante Anlage.
Dann gingen wir in den Verborgenen Garten – es war die schlechteste Führung, der wir je beigewohnt hatten. Ich gebe nicht dem Garten die Schuld, sondern nur unserer Touristenführerin.
Unsere Zusammenarbeit stand von Anfang an unter keinem guten Stern. Einige Minuten bevor die Führung begann, gab es eine Lautsprecherdurchsage in (vermutlich) englischer Sprache, doch sie war so leise und undeutlich, dass ich mir nicht einmal dessen sicher war. Mit dieser Einschätzung stand ich nicht alleine dar, denn kein Mensch um uns herum rührte sich. Darunter waren zweifelsohne englische Muttersprachler. Anscheinend fühlten die anderen Besucher sich ebenso wenig angesprochen wie wir. Einige Zeit später kam eine Dame in einem traditionell koreanischen Hanbok aus einer Hütte und baffte uns mürrisch an, warum wir denn keine Karten des Gartens hätten, sie hätte uns ja eben darauf aufmerksam gemacht, wo diese zu holen seien. Die Leute starrten die Dame kollektiv verständnislos an. Erst nachdem sie wiederholt hatte, dass es Karten vom Garten gab, machten sich einige Interessieret auf den Weg zum Infostand, der um die Ecke war, um sich ihre Exemplare zu sichern.
An dieser Stelle möchte ich betonen, dass die junge Dame, welche uns den Garten nun zeigen und erklären würde, einerseits einen starken Akzent hatte, der aus der Gegend um Texas zu kommen schien. Andererseits sprach sie aber auch sehr schnell und monoton. So folgten wir ihr durch das Tor, das für unsere Gruppe aufgeschoben wurde, und hörten uns ihre Stimme in den nächsten Stunden an.
Über den Garten an sich gab es recht wenig zu erzählen, da er weder kunstvoll gestaltet noch irgendwie aufgebauscht war. Es gab Bäume, Sträucher, Hecken, Grünzeug, Gras und so weiter, und alles wuchs irgendwie munter umher, wurde vielleicht ab und an von einem Gärtner gestutzt und diente hauptsächlich dem Zweck Schatten zu spenden.

Allerdings gab es einige Wege, die durch diesen Garten führten, um verschiedene Gebäude miteinander zu verbinden. Diese eben waren die Besonderheiten des Gartens. Dort hatte die kaiserliche Familie in vergangenen Tagen Zuflucht vor der brütenden Sommerhitze gesucht. Man genoss die Aussicht auf einen angelegten Teich, spazierte im Schutz der Bäume umher, trank Tee und vertrieb sich die Zeit.

Dazu erzählte unsere Reiseführerin einige Einzelheiten, doch irgendwie konnte sie ihr Publikum nicht mitreißen. Tatsächlich gewann ich mit jedem Schritt mehr und mehr den Eindruck, dass wir eine Bürde für sie darstellten. Gelangweilt ließ sie uns mal hier, mal dort verweilen, entschied, dass wir aufbrechen wollten, weil einige (ältere) Besucher sich nicht umsahen und sie deshalb davon ausging, dass es ihnen an Interesse mangelte. Tatsächlich war es an diesem Tag drückend heiß, so dass einige Leute es körperlich einfach nicht schafften. Die Reiseleiterin vermittelte uns das Gefühl, dass wir eine Last waren. Es fehlte nur noch, dass sie die Augen verdrehte, um ihren Widerwillen offen zum Ausdruck zu bringen. Was auch immer an diesem Tag mit dieser Dame schief gelaufen war, sie ließ es an uns aus. Dies war für mich eine ganz neue Erfahrung in diesem Land, das uns zwar oft mit Verständnislosigkeit gegenübertrat, aber dabei immer äußerst höflich blieb.

Als wir an einer Kreuzung der vor uns liegenden Reisegruppe begegneten, war unsere Leitung gezwungen, eine Pause einzulegen, weil wir sonst ineinander gerannt wären. Sie war alles andere als erfreut darüber. Offensichtlich wollte sie die Runde schnell über sich ergehen lassen und uns so bald wie möglich wieder am Eingang abladen. Das wurde insbesondere zum Ende hin deutlich, als die Besucherschlange sich immer weiter in die Länge zog, weil unterschiedliche Leute nun einmal ein unterschiedliches Tempo hatten. Anstatt auf die Nachzügler zu warten, begann sie mit der Erzählung über die Gebäude als sie dort ankam. Wir hatten keine Zeit uns irgendwie zu platzieren oder umzusehen, nein, wir mussten entweder sofort zur Stelle sein oder in Kauf nehmen, dass wir wichtige, interessante Informationen verpassten. Als es nur noch darum ging, eine gerade Strecke runter zu gehen, wartete sie überhaupt nicht mehr auf die letzten Leute in der Gruppe. Sie stürmte davon, über steile Treppen und unebene Pfade. Dass auch ältere Leute ihrer Verantwortung oblagen, schien sie dabei nicht im geringsten zu stören.
Fazit dieses Ausflugs: Der Tempel ist ein Muss! Man braucht keine Führung, um seine Schönheit zu genießen – wir hatten auch keine. Der Verborgene Garten ist ebenfalls interessant, aber man muss Glück mit dem Tourguide haben. (Hier muss ich erwähnen, dass man diesen ohne Führung nicht betreten durfte.) Ich würde trotzdem das Gesamtpaket empfehlen, weil man im Garten einfach noch einige Hintergrundinformationen bekommt und er vor allem im Sommer äußerst erholsam ist.
Um noch einmal indirekt auf die freundliche Kellnerin vom ersten Tag zurückzukommen. Wie bereits erwähnt konnten wir uns gut mit ihr auf Englisch verständigen, doch es gab eine Begebenheit, bei der uns deutlich wurde, dass das in Korea überhaupt nicht selbstverständlich war. Als wir eines Tages in der Bank waren, um Geld abzuheben, bekam ich eine Fehlermeldung, aber kein Bares. Da diese nur aus einer Nummer bestand, wusste ich mir nicht zu helfen. Allem voran war es mir wichtig, dass es keine Abbuchung gab, ohne dass ich Geld erhalten hatte. Die Schalter waren zu dieser Zeit geschlossen, aber es gab ein Telefon für Notfälle und die Beschriftung „Service“ auf einem der Knöpfe. Nach kurzem Zögern entschied ich mich für einen Anruf. Wie nicht anders zu erwarten, meldete sich die Dame am anderen Ende der Leitung in koreanischer Sprache. Ich gab ihr zu verstehen, dass ich kein Koreanisch konnte, und fragte sie, ob sie Englisch sprach. Daraufhin brabbelte sie mich einige Zeit in ihrer Muttersprache zu. Ich meinte trocken „I’ll take it as a no.“ („Ich interpretiere dies als nein.“), woraufhin sie (auf Koreanisch!!) bestätigte. Immerhin verstand ich das. Sie sprach weiter, um mich dann in eine Warteschleife zu packen. Ich ging davon aus, dass sie nach einem englischsprachigen Mitarbeiter suchte, werde es aber nie herausfinden können. Wie dem auch sei, einige Zeit verstrich und sie war wieder am Hörer – ohne Hilfe oder Unterstützung. Ich bedankte mich und wir legten auf. Da stand ich nun, ich armer Tor, und war so klug als wie zuvor.
Es ging aber noch weiter. Während ich Franziska das Gespräch schilderte, ging die Tür zu dem Bereich mit den Schaltern auf und ein junger Mann kam heraus. Vielleicht hatte er uns gesehen, vielleicht war das Telefonat an ihn weitergeleitet worden, es spielt keine Rolle. Jedenfalls versuchte ich auch ihm mein Problem zu schildern, zeigte ihm den Zettel, den der Automat ausgespuckt hatte, und machte meine Unsicherheit deutlich. Das Ergebnis war, dass der den Zettel an sich nahm und im abgeschlossenen Bereich verschwand. Ich sah meine Reisebegleitung an, sie blickte zurück, wir konnten nichts machen. Spaßeshalber meinte sie noch, dass gleich drei Leute rauskommen würden, um sich bei uns zu entschuldigen und herauszufinden, was das Problem sei. Sie lag richtig. Als die Tür auf ging, kam eine Dame heraus, gefolgt von einer zweiten, gefolgt von dem Herrn von vorhin. Die zweite Dame musste für die erste übersetzen, was ihr allerdings auch nicht so ganz gelang. Mit vereinten Kräften einigten wir uns drauf, dass ich den Zettel wieder an mich nehmen würde, um bei eventuellen Problemen auf die Herrschaften zurückzukommen. Nach dieser Odyssee gingen wir erst einmal wieder nach Hause.
Gangnam Station Undergound Shopping Center
Es gibt nur wenige Sachen, die der durchschnittliche Europäer über Korea weiß. Man hat vielleicht schon davon gehört, dass es ein gespaltenes Land ist, und dank einiger Aktionen des Nordens hat dieser es schon einige Male in die Nachrichten geschafft. Wenn es aber um den Süden geht, haben die meisten Westler nur einige Fragezeichen über ihren Köpfen. Vor kurzer Zeit änderte sich, als ein Lied es in die Kreise westlicher Nationen schaffte: Gangnam Style.
Für all jene, die noch nicht im Bilde sind: Gangnam ist ein Stadtteil von Seoul. Das Lied dazu ist das am meisten angeklickte Video auf youtube. In Anbetracht dieses Booms war es schon fast selbstverständlich, dass wir auch einen Ausflug in diesen Teil der Hauptstadt unternahmen.
Zuerst begaben wir uns in die Touristeninformation, die zum einen Auskunft über K-pop-Stars gab und zum anderen gerne über plastische Chirurgie sowie empfehlenswerte Kliniken informierte. Ja, das war in einem Gebäude, auf einer Etage, an einem Schalter. Durch keins von beidem angelockt, stand ich nutzlos in der Ecke, bis wir weitergingen.
Als wir dann in die Tiefen dieses Viertels vordrangen, stellten wir bald fest, dass es langweilig war. Es gab große Straßen, Nebenstraßen, nicht viel Besonderes. Vielleicht nahmen wir nur den falschen Weg, denn wir folgten nicht der vorgeschlagenen Touristenroute, sondern gingen querfeldein und verliefen uns. Ohne Straßennamen an Kreuzungen oder Straßenkarten ist das ein einfaches Unterfangen. Als wir endlich ankamen, wohin wir von Anfang an wollten, blickten wir auf zwei Reihen gläserner Hochhäuser. Banken, um genau zu sein. Dazwischen standen Autos. Sie standen, weil der Verkehr kein Vorankommen zuließ.

An der Haltestelle Gangnam stand eine Plattform, die besagtes Lied würdigte und interessierten Besuchern die Möglichkeit zum Nachtanzen der Choreographie gab. Wir waren nicht interessiert.

Was mich letzten Endes aus den Socken haute, war die Einkaufsmall an der Haltestelle Gangnam. Sie war unterirdisch (im wörtlichen Sinn), erstreckte sich über einen mir unbekannte Fläche, hatte zwölf Ausgänge und war überlaufen. Zunächst dachte ich, dass es der Eingang zur Metro war, aber nein, das war es bei weitem nicht. Nicht nur, jedenfalls. Geschäfte drängten sich dicht an dicht, nur übertroffen von den Menschenmassen. Wir erinnerten uns an einen Tipp, dass man hier Postkarten finden könne. Hier versuchten wir nun unser Glück – und scheiterten. Mehrere Male liefen wir durch das Gewusel, fanden aber nur Kleidung, Handyzubehör und Allerlei. Postkarten waren nicht aufzutreiben. Nach einiger Zeit gaben wir es auf und fuhren nach Hause.
Eines Nachmittags waren wir mit Beverly verabredet, um zusammen ein traditionell chinesisches Mahl einzunehmen. Es nannte sich Hot Pot, also Heißer Topf. Beverly, ein sehr geselliges Mädel, lud so ziemlich jeden ein mitzukommen, der ihr über den Weg lief. Natürlich würde jeder seinen Anteil selbst tragen, aber es ging ihr einfach darum eine große Runde zu versammeln. Bei dieser Gelegenheit lernten wir einen weiteren Koreaner kennen, der sich uns mit dem Namen Zen vorstellte. Tatsächlich wollte er es für uns „einfacher“ machen und schlug uns vor, dass wir ihn „Kim“ nennen könnten. Das Problem damit ist weiter oben bereits aufgeschlüsselt. Wir bleiben bei Zen.
Auf dem Weg zu dem Restaurant, das Beverly ausgesucht hatte, sprachen wir Zen auf ein Phänomen an, das uns seit einiger Zeit beschäftigte: Lotte. Lotte ist ein Unternehmen, das uns immer wieder über den Weg lief, während wir in Seoul durch die Straßen zogen. Tatsächlich sahen wir den ersten Lotte Duty Free Shop am Flughafen von Jakarta. In Seoul schien Lotte allerdings omnipräsent.
Auf unserer Karte prangerte groß der Lotte Freizeitpark; es gab zwei Lotte Hotels allein in Seoul; Lotte produzierte sogar Süßigkeiten.

Zen erklärte uns, dass es uns nur so vorkäme, dass Lotte überall wäre. Seiner Ansicht nach befanden wir uns in einem Stadtteil, in dem sich eben dieses Unternehmen konzentrierte. Damit war die Sache für ihn abgehakt und uns blieb nichts anders übrig, als mit seiner Aussage vorlieb zu nehmen. Es war auch nicht ganz so wichtig, denn schließlich wollten wir nur ein bisschen Konversation mit einer neuen Bekanntschaft betreiben. Doch die Worte setzten sich in unseren Ohren fest und stichelten uns bei zahlreichen folgenden Gelegenheiten. Ja, ich werde wieder darauf zurückkommen.
In dem Restaurant angekommen, durften wir das Ambiente eines typischen Chinesen in uns aufnehmen. Da fühlten wir uns wieder nach Deutschland versetzt, denn die Inneneinrichtung war wie man sie eben in solch einer Lokalität erwartet. Chinesische Muster, chinesische Schriftzeichen, Drachen, Holzvertäfelung, etc. All das war vorhanden.
Man geleitete uns an unseren Tisch, an dem ich etwas fand, das ich aus Deutschland noch nicht kannte: ein großes Loch in der Mitte. Darunter fand sich ein Heizsystem. Nun erklärte Beverly uns, wie das ganze Mahl ablaufen würde. Zuerst brachte man uns ein Edelstahlbecken, das in der Mitte geteilt war, so dass die zwei verschiedenen Saucen sich nicht mischen konnten. Dieses Becken wurde in das Loch in der Mitte gehievt, man stellte die Heizspiralen an und dazu bestellten wir die eigentlichen Zutaten, denn was da bisher auf dem Tisch stand, war Suppe. Wir entschieden uns für eine Variation an Gemüse, Pilzen und ein bisschen Fleisch. Wie die Chinesen nun einmal so sind, befürchtete Beverly die ganze Zeit, dass wir zu wenig geholt hatten, doch diese Sorge erwies sich als unberechtigt. Letzten Endes rollten wir alle kugelrund vom Tisch – und es gab keine Reste, was ich persönlich als Erfolg werte, auch wenn unsere Chinesisch da dachte.

Man aß wie folgt: Alle Zutaten wurden in die Suppe geworfen. Da die zwei Becken sich vor allem im Schärfegrad unterschieden, verteilten wir Gemüse und Fleisch recht gleichmäßig auf beide Behälter, da einige Leute am Tisch saßen, die nicht so erpicht darauf waren, sich die Geschmacksnerven wegätzen zu lassen. Weicheier. Tatsächlich war die scharfe Suppe einfach nur überpfeffert, was mich effizient davon abhielt, sie zu essen.
Da die Fleischstückchen hauchdünn geschnitten worden waren, garten sie entsprechend schnell. Während dieser Zeit konnten wir uns nach Herzenslust an dem kalten Buffet bedienen, an dem es verschiedene Beilagen, Gewürzmöglichkeiten sowie Nachtische gab. Wir mussten auch nicht befürchten, dass die Suppe irgendwann nicht reichen würde, weil diese nachgeschenkt wurde, wenn der Kellner den Eindruck hatte, dass wir schon zu viel daraus geschöpft hatten – ohne Zuschlag, versteht sich. Nach diesem mehr als üppigen Mahl kugelten wir nach Hause. Erstaunlicherweise war es günstiger, als wir vorher ausgerechnet hatten, was natürlich zur guten Laune beitrug. Der Geschmack tat sein Übriges.
Ein schöner Zeitvertreib, besonders zwischen Essensbestellung und -lieferung, war das Kickerspiel, das in der Lounge nur darauf wartete von eifrigen Gästen benutzt zu werden. Nachdem wir es einmal gewagt hatten unsere koreanischen Mitarbeiter herauszufordern, wurde es ihr innerstes Bestreben uns in diesem Spiel zu schlagen. Also spielten wir jeden Tag mehrere Partien gegen den einen oder anderen Gegner, manchmal zwei gegen zwei. Es war äußerst amüsant, zumal besonders Jae Won schnell lernte und zu einer tatsächlichen Herausforderung wurde. Nicht dass irgendjemand von uns es in irgendeine Liga geschafft hätte, aber es war genug Können dabei, um uns zu unterhalten – und das alleine zählt.

Seol Hee, die ein natürliches Talent für die Verteidigung bewies, gab immer wieder komische Geräusche von sich, wenn der Ball sich in ihrem Bereich bewegte.
Hulk freute sich diebisch über jedes Tor, das er – mit welchem Spielpartner auch immer – gegen das Team Deutschland – bestehend aus Franziska und mir – schoss. Danach kassierte er für gewöhnlich auch einige, weil seine Konzentration der Euphorie wich.
Jae Won probierte bei jedem Spiel sein neu erlangtes englisches Vokabular gegen uns aus. Darunter fielen Sätze wie „You’ve got the ball.“ („Ihr habt den Ball.“) oder aber „I kill you.“ („Ich bringe euch um.“) Damit erschöpfte sich auch schon der englische Wortschatz unseres Jüngsten. Selbstverständlich übertreibe ich hier.
Ich kam sogar in den zweifelhaften Genuss gegen Kenneth, also den „Boss“, zu spielen, der gar nicht mal schlecht war.
Martin war der Einzige, der sich kein einziges Mal an das Spiel wagte.
Unsere Partien zogen abends sogar eine Schaulustige an und überzeugten Gäste davon, es selbst mal auszuprobieren. So oder so entstanden immer wieder Situationen, bei denen ich Tränen lachte. Es war zu herrlich.
Sam hatte uns bereits vorgewarnt, dass einige Koreaner Ausländer ansprechen, nur um an ihnen ihre Englischkenntnisse zu testen. Womit wir allerdings nicht rechneten, war so einfach neue Bekanntschaften zu schließen. Als wir in unserer ersten Woche in Seoul an einer Fußgängerampel standen, sprach uns eine Koreanerin an, stellte uns die üblichen Fragen und nach Beantwortung dieser gingen wir wieder getrennter Wege, nur um einige Minuten später wieder aneinander vorbei zu laufen. Diese Gelegenheit nutzend tauschten wir Kontaktdaten aus, um uns zu einem Treffen in baldiger Zukunft zu verabreden.
Als dieser Tag dann endlich gekommen war, lud MJ, die Mutter der Familie, uns zu sich in die Wohnung ein. Sie hielt losen E-mailkontakt mit meiner Reisebegleitung, so dass es einige Zeit dauerte, bis wir endlich einen passenden Termin gefunden hatten. Schließlich klappte es dann doch.
Die Wegbeschreibung war hervorragend, so dass wir uns relativ sicher waren, die richtige Wohnung zu finden. Allerdings mache ich noch einmal darauf aufmerksam, dass es keine Straßennamen gab. Auch die Hausnummern funktionierten anders als in Deutschland. Trotzdem fanden wir die Wohnung problemlos und schneller als erwartet. Tatsächlich wohnte MJ mit Familie in demselben Viertel wie wir gerade, was das ganze Unterfangen umso einfacher machte.
Es war eine sehr schöne Wohnung, sehr geräumig, dezent eingerichtet, schöne Steinfußböden, Klimaanlagen in der Decke und sehr praktisch geschnitten. Sie lag im 34. Stockwerk.
Wir wurden von MJs Sohn, Chi U, empfangen, der dank seines jahrelangen Aufenthaltes in den USA hervorragend Englisch sprach, wahrscheinlich sogar besser als wir beide zusammen. MJ erwartete uns im Wohnzimmer. Beide unsere Gastgeber waren erstaunt, dass wir vor der Wohnungstür standen, weil sie davon ausgingen, dass wir unten klingeln würden, aber das war wegen der guten Beschreibung gar nicht nötig. Außerdem hatten wir keine Ahnung, wie diese hochmodernen Gegensprechanlagen funktionierten und wie man bei einer bestimmten Wohnung klingeln sollte. Es war ja nicht so, dass irgendwo Klingeln mit Schildern angebracht gewesen wären. Ein Pförtner öffnete uns allerdings die Tür, als wir erklärten zu welcher Wohnung wir wollten.
MJ entschuldigte sich vielmals, dass sie nicht selbst gekocht hatte, da ihr etwas dazwischen gekommen war. So mussten wir uns mit dem Essen „begnügen“, das ihr Sohn ausgesucht, bestellt und schön angerichtet hatte. Es war vorzüglich. Eine Mischung aus verschiedenen europäischen Gerichten präsentierte sich uns bunt auf verschiedenen Schüsseln. Salat mit leckerem Dressing und panierten Hähnchenstreifen; Pommes; ein anderer Salat auf Blätterteigtaschen; ein geschichtetes Toastgericht, dessen Namen ich vergaß, mit Blaubeersauce. Chi U hatte definitiv die richtige Wahl getroffen.
Während des Essens unterhielten wir uns über verschiedene Themen: Gesellschaft, Politik, Geschichte, Small Talk, etc. Es war richtig angenehm mit dieser Familie, in der alle eine ruhige Art an den Tag legten, die Zeit zu verbringen. Einige Zeit bevor wir gingen, kam der Vater Chi Us nach Hause und unterhielt sich ebenfalls mit uns. Obwohl wesentlich distanzierter als sein Sohn, zeigte auch er ein offenes Wesen und eine kommunikative Ader. Es war ein äußerst angenehmes Lunch in phantastischer Gesellschaft.
Eines Tages herrschte betriebsame Spannung im Hostel als angekündigt wurde, dass eine Lieferung mit unschätzbarem Wert eintreffen sollte. Jae Wons Eltern schickten eine große Packung Sashimi, also rohen Fisch, der der Belegschaft zum Verzehr vorgesetzt wurde. Es war eine wirklich große Kiste und der Inhalt hatte sehr gute Qualität, was unsere koreanischen Kenner mit einem zufriedenen Nicken zur Kenntnis nahmen.

Zum feierlichen Anlass wurden alle eingeladen: Mitarbeiter, Chefs, Gäste, eigentlich jeder, der am Tisch vorbei kam. So verbrachten wir einen lustigen Abend. Es gab uns zudem die Möglichkeit ein bisschen mehr über unsere koreanische Gastfamilie zu erfahren. Daher erfuhren wir nun, dass Jae Won sehr wohl Englisch sprach, zumindest wenn er betrunken war– was bei dem Jungen sehr schnell ging–, sich aber nicht traute. Hulk hingegen vergaß mit jedem Glas ein bisschen mehr seiner Sprachkünste, was die Verständigung auf Dauer schwierig machte. In dieser Atmosphäre reger Kommunikation in verschiedenen, oft nicht zusammenpassenden Sprachen, stellten die Koreaner fest, dass Franziskas Name einfach zu schwierig für ihre schwer gewordenen Zungen war, weshalb sie ihr einen neuen, koreanischen verpassten. Ab sofort durfte man sie mit gongju (zu Deutsch: Prinzessin) anreden, was vor allem Martin dankend annahm und vorbehaltlos ausnutzte. Wenigstens hielt man sie so nicht mehr für einen Vampir.
In diesem Zuge erhielt auch ich einen neuen Namen, dessen europäische Rechtschreibung ich allerdings nicht kenne, mir nichts aus den Fingern saugen will und es daher dabei belasse. Zumal er nur äußerst selten zum Einsatz kam, weil mein Name, im Gegensatz zu Franziska, äußerst einfach für alle war.
Jae Won hingegen bekam bei der ganzen Feier nur einen auf den Deckel. Wie bereits erwähnt war er ein großer Anhänger des weiblichen Geschlechts und verstand sich darauf (auch in nüchternem Zustand) eine Unterhaltung mit vorbeilaufenden Damen zu initiieren. Da sich nun einige Damen sogar bereitwillig an denselben Tisch setzten, nutzte er diese Gelegenheit schamlos aus. Ich möchte unseren kleinen Charmeur hier keineswegs schlechtreden, denn es gab keinen Moment, in dem er sich nicht wie ein Gentleman benommen hätte. Worauf ich hinaus will, ist folgendes: Hulk fiel das Verhalten seines Schützlings selbstverständlich auf, und als guter, verantwortungsbewusster Chef sah er sich in der Pflicht, den Jüngsten wieder in seine Schranken zu weisen. Just in diesem Augenblick fiel ihm genau die richtige Strategie ein. Während Jae Won also auf der Couch saß und sich gerade mit einem Mädel unterhielt, schrie Hulk quer durch die Lounge: „Stop hitting on her!“ („Hör auf, sie anzumachen.“) Jae Won fuhr erschrocken herum. Mit stolzgeschwellter Brust verkündete unser Gastgeber, dass er diesen Spruch bei der Serie „Friends“ aufgeschnappt hatte. Vorerst war der Junge still – und sollte es für den Abend auch bleiben. Denn obwohl er den ein oder anderen Versuch unternahm, mit einer Maid ins Gespräch zu kommen, wurde er jedes Mal von seinem Vorgesetzten mit eben diesem Spruch auf seinen Platz verwiesen. Es ging so weit, dass Jae Won nicht einmal mehr eine Begrüßung aussprechen durfte, ohne Rüge zu bekommen. So saß er den Rest des Abends, den Kopf auf Hulks Schulter ruhend, mit einem Hundeblick am Tisch und warf mehr als einer Dame einen schmachten Blick hinterher.
Nach reiflicher Überlegung, kamen wir zu dem Schluss, dass dieser Abend so etwas wie ein Aufnahmeritual war und wir nun offiziell dieser Mafia angehörten. Welche Folgen das für uns haben würde, konnten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht absehen. Vielleicht würden wir es nie erfahren, immerhin hatten sie sich uns nicht offiziell zu erkennen gegeben, aber wir rückten definitiv näher in den Kreis der Eingeweihten vor.
Später am Abend sorgte diese Szene für allgemeine Belustigung. Ein Freund von Martin, der ebenfalls zugegen war und Chefkoch von Beruf war, hatte etwas Leckeres gezaubert. Selbstverständlich wollte Franziska es probieren. Als sie den Happen auf ihrer Gabel hatte, schrien verschieden Koreaner wild durch die Gegend. Martin meinte aufgebracht: „Das ist scharf!“ Hulk hingegen japste: „Das ist Fisch!“ Noch bevor einer der beiden die Gelegenheit hatte, ihr ihr Essen streitig zu machen, verspeiste sie den Bissen. Es musste kein Notarzt gerufen werden, ich hörte keinerlei Beschwerden von ihr, alles ging glimpflich aus. Nur unseren Gastgebern stand der Schweiß auf der Stirn.
Mittlerweile war einige Zeit ins Land geflossen, wir verstanden uns hervorragend mit unserem Arbeitgeber sowie weiterem Personal, woraufhin ich einen Vorstoß wagte, den ich mich sonst nicht getraut hätte. Aber ich wollte meinem Vater Ehre machen und zeigen, dass ich seine Lebenslektionen ernst genommen hatte. Obwohl der koreanischen Sprache nicht mächtig, kam ich nicht umhin, einige Begriffe aufzuschnappen, wodurch ich mittlerweile ein beachtliches Repertoire aufweisen konnte – in Anbetracht der Tatsache, dass ich nicht lernte. Also entschied ich mich, einen entscheidenden Schritt weiter zu gehen.
So kletterte ich eines Nachmittags von unserer Dachwohnung hinunter und fand sowohl Hulk als auch Seol Hee an der Rezeption. Ein bisschen verschüchtert, weil ich nicht wusste, wie meine Gastgeber auf meine Anfrage reagieren würden, sprach ich sie an. Ich entschied mich für eine deutsche Herangehensweise, was bedeutet, dass ich offen aussprach, weshalb ich gekommen war. So bat ich Hulk, mir einige koreanische Schimpfwörter und Flüche beizubringen. Er sah mich groß an. Noch bevor er den Gedanken verarbeitet hatte, sprudelte es nur so aus Seol Hee heraus. Sie sagte etwas und fing zu kichern an. Nach einigem Hin und Her, gaben sie mir einige Begriffe, mit denen ich arbeiten könnte. Es dauerte einige Zeit, bis ich das alles richtig aussprechen konnte, aber ich war auf dem richtigen Weg. Zufrieden zog ich von dannen, während meine Gastgeber teils lachend, teils grübelnd zurückblieben.
Kurz bevor wir unsere Abreise antraten, kamen unsere Nachfolgerinnen an. Ihre Namen waren Edyta und Dominka und die beiden recht jungen Mädels stammten aus Polen. Sie verbrachten ihren Urlaub in Seoul, weil sie sich sehr für K-Pop interessierten und gerne ihre Lieblingsband SHINee live sehen wollten. Das ist gar nicht mal so abwegig, denn selbst wenn es keine direkten Konzerte einer bestimmten Band gibt, besteht immer noch die Möglichkeit sie bei einem Festival, einer Vorstellung oder einer Aufzeichnung anzutreffen.
Wir arbeiteten die Damen schnell ein, so dass wir einige Tage noch weniger zu tun hatten als sonst. Wie dem auch sei, wir versuchten auch die Mädels ins Geschehen zu integrieren, was wesentlich einfacher wurde, nachdem die beiden erfuhren, dass ich ihre Sprache sprach. Bis dahin hatte ich den Eindruck gewonnen, dass sie sich ihrer Englischkenntnisse nicht ganz so sicher waren. Ehrlich gesagt waren sie dafür am richtigen Platz, da Koreaner auch nicht gerne Englisch reden. Außer Hulk und Seol Hee.
Die Mädels waren allerdings immer freundlich, unkompliziert und recht offen, so dass wir schnell und gut miteinander auskamen. Leider teilten wir aber auch wenige Interessen, weshalb ich nicht immer wusste, worüber ich mit ihnen sprechen sollte. Aber uns waren eh nur wenige Tage zusammen gegönnt.
tbc...
... link (0 Kommentare) ... comment
... older stories