... newer stories
Sonntag, 3. Januar 2016
Seoul – Juni-August 2015 (Leute)
atimos, 10:05h

Egal, wie sehr ich mich bemühe, ich werde nicht drum herum kommen, lang und breit über das Essen in Südkorea zu schreiben. Das hat zwei Gründe. Zum einen liebe ich Essen. Zum anderen unterschied sich das koreanische Essen in zu vielen Punkten vom europäischen, als dass ich darüber hinwegsehen könnte. Außerdem fand ich in Südkorea Bingsu – meine neue Liebe.
Nicht nur die Zutaten und Gerichte waren anders als in Deutschland, auch die Art und Weise wie man aß, wies markante Unterschiede auf.
Schon am ersten Arbeitstag meinte unsere Gastfamilie es zu gut mit uns. Sie fragten uns tatsächlich, was wir essen wollten. Woher sollten wir das wissen? Meine Erfahrungen mit koreanischer Küche beschränkten sich bis zu diesem Zeitpunkt auf den einen Besuch in einem Restaurant, von dem ich noch nicht einmal mit Sicherheit sagen konnte, dass es authentisch war, weil ich mich bis dahin nicht sonderlich gut auskannte. Ich kannte Bibimbap. Punkt. Wir sahen unsere Gastgeber Hilfe suchend an und erklärten ihnen unsere missliche Lage, woraufhin sie uns einen Flyer unter die Nase hielten, der ungefähr so hilfreich war, wie ein Schraubenzieher bei einer Laufmasche. Der Flyer war schön und gut. Es waren auch einige Bilder drin. Alles in allem war er allerdings auf Koreanisch, in koreanischer Schrift mit koreanischen Lebensmittelbezeichnungen. Ich hoffe, ich muss mein Problem nicht noch deutlicher schildern. Ich glaube, wir einigten uns letzten Endes auf Bulgogi, weil es ein einfaches Fleischgericht war, bei dem man nicht allzu viel falsch machen konnte, wenn man gerade neue Essgewohnheiten ausprobierte. Zudem wir unseren Gastgebern von Anfang an einige Einschränkungen auferlegten: Franziska mochte keine Meeresfrüchte, während ich so meine Probleme mit scharfen Speisen hatte. Bei Bulgogi gingen wir beiden Hindernissen gekonnt aus dem Weg. Wie dem auch sei, die Portion war riesig (das aus meinem Mund, ja), und Hulk war so vorsichtig, dass er noch eine Extraportion Reis bestellte – nur für alle Fälle. Letzten Endes brauchten wir diese nicht, weil wir alle sehr gut satt wurden. Ungefähr so ähnlich ging es die nächsten Wochen weiter.
Auf diese Weise lernten wir viele, leckere Speisen kennen. Da gab es, wie bereits erwähnt, Bibimbap, Bulgogi, Jjajamyeong, Jjajambap, Kimbap, Mandu und vieles mehr.
Unsere erste Erfahrung mit Jjajamyeong war allerdings durchwachsen. Schmackhaft war dieses eigentlich chinesische Gericht auf jeden Fall, keine Frage. Aber die Geschichte, die Seol Hee dazu auspackte, erzeugte eine unwillkürlich wettbewerbliche Situation am Mittagstisch. Unsere Gastgeberin erzählte uns, dass Hulk es zu Militärzeiten geschafft hatte, eine Portion Jjajamyeong in ungefähr einer halben Minute zu verputzen. Hier bietet sich ein Erklärung an, was diese Speise überhaupt ist: Nudeln mit schwarzer Bohnenpaste. Dass Asiaten in der Lage sind, Nudeln jeglicher Art fast schon zu inhalieren, ist kein Geheimnis. Eine halbe Minute war dann aber doch eher unglaublich in Anbetracht der Größe der Portion. Dennoch ließ sich unser jüngster Mitarbeiter, Jae Won, davon nicht abhalten, diese Herausforderung anzunehmen. Bevor ich den zweiten Happen geschluckt hatte, war der Junge mit seinem Teller fertig – und grinste breit. Ich nahm es mir heraus, ihn wie ein Auto anzusehen und fragte mich bis zum Ende, ob das eine Fähigkeit war, die man im Lebenslauf erwähnte.
Und dann entdeckten wir Bingsu.
Unsere erste Erfahrung mit Bingsu zeigte deutliche die kulturellen Unterschiede. Wie bei allem Essen in Korea wurde auch jedes Bingsu mit einem Bild angepriesen, um dem interessierten Kunden eine visuelle Hilfe bei der Bestellung zu geben. Allerdings kann man Bilder immer in Perspektive setzen, so dass wir nicht wirklich wussten, was uns erwartete.
Wir spazierten also ganz unvoreingenommen in ein Café – derer gibt es in Seoul zu genüge – und besahen die große Auswahl an Bingsu. Draußen war es brütend heiß, so dass diese Abkühlung mehr als willkommen war. Das heißt nicht, dass ich mich über mangelnde Klimatisierung des Cafés beschweren möchte, keinesfalls – auch diese war top. Aber wir wollten doch koreanische Speisen in Hülle und Fülle probieren, so dass ein Dessert zweifelsohne auch darunter fiel.
Nun standen wir am Tresen, entschieden uns für ein Brownie-Bingsu und bestellten für Franziska und mich. Der Preis war schon happig, aber in Deutschland sind große Eisbecher auch nicht gerade billig, weshalb wir uns den Luxus gerne gönnen wollten. Zu diesem Zeitpunkt hatten wir die koreanischen Essgewohnheiten noch nicht so ganz verinnerlicht und wollten nach deutscher Manier zwei Bingsu bestellen. Die Verkäuferin sah uns an wie ein Auto. Anstatt unsere Anfrage kommentarlos hinzunehmen, stellte sie sicher, dass wir einander verstanden und dasselbe meinten. Zu diesem Zweck holte sie eine leere Schüssel, die in kürze von unserem Bingsu gefüllt sein würde. Als wir diese Salatschüssel sahen, entschieden wir uns für eine Portion für uns beide und dankten der Verkäuferin, dass sie so geduldig mit uns unwissenden Ausländern war. Denn hier ist die Crux: Bingsu isst man nie alleine. Das ist undenkbar. Die Portion ist extra so groß, dass man teilen muss.
Bingsu ist nicht einfach Eiscreme, nein, Bingsu ist eine Kunst. Es gab verschiedene Formen, Konsistenzen, Geschmacksrichtungen und Toppings. Es fing mit einer Basis an, die aus crushed Ice, fein geschabten Milcheisflocken oder Milcheisschnee bestand. Dazwischen kamen oft noch Bestandteile der eigentlichen Geschmacksrichtung, aber nicht zwangsläufig. Was dann folgte, gab dem Ganzen nicht nur den Geschmack, sondern auch die kunstvolle Struktur. Traditionell wurden süße, rote Bohnen darauf drapiert, aber heutzutage sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt. Ob Bohnen, Sojamehl, Reiskuchen, Eiscreme, Saucen, Tiramisu, Brownie, Nüsse, alles war möglich. Wir hatten sogar ein Bingsu mit Parmesan. Abgerundet wurde das eine oder andere Bingsu dann mit süßer Kondensmilch, die man wahlweise drauftröpfeln lassen konnte.
Seitdem sind viele Bingsu durch unsere Hände gewandert und ich habe an allen diese koreanische Sache gemacht: Sie fotografiert. Hier einige Beispiele:

(Für dieses Wunderwerk an Collage bedanke ich mich bei meiner guten Fee mit ausgeprägten Kenntnissen in Bildbearbeitungsprogrammen. Sie ist hier zu finden: http://myungsoomp3.tumblr.com/)
Da Teilen in der koreanischen Küche zum guten Ton gehörte und Bingsu – wie bereits erwähnt – darauf ausgelegt war, genossen wir immer wieder den Anblick von zwei oder drei erwachsenen Kerlen, die sich in einem Café über ein einziges, (in diesem Verhältnis) schmächtiges Bingsu beugten. Es ging dabei tatsächlich recht zivilisiert zu.
Insa-Dong
Selbstverständlich ließen wir uns Insa-Dong nicht entgehen, da es in unserer Broschüre in den buntesten Farben angepriesen wurde, doch dafür brauchten wir einen Schlachtplan. Denn Insa-Dong ist eine Touristenstraße, ja, nahezu eine Touristenhochburg, in der traditionelles koreanisches Handwerk in verschiedenen Läden dargestellt wird. Dank des ausgeklügelten Metro-Systems gepaart mit einer intelligenten Person im Kultusministerium, die daran gedacht hatte, die Nummern des nächsten Ausgangs bei jeder Sehenswürdigkeit zu erwähnen, kamen wir punktgenau an unserem Ziel an. Dort sahen wir beispielsweise Geschäfte, die einzig und allein Pinsel in verschiedenen Größen und Dicken verkauften. Daneben fanden sich Unmengen an Souvenirs und – endlich, endlich! – auch Postkarten. Hier konnte man diese bemalten Pappkartonzuschnitte auch einzeln kaufen, auch wenn es sich überhaupt nicht lohnte, weil sie im Packen entschieden weniger kosteten. Dennoch, für all jene, die nur ein, zwei Kärtchen verschicken wollen, Insa-Dong bot uns diesen Service an. Ja, die Sache mit den mangelnden Postkarten hat mich stark mitgenommen.
Das war allerdings nicht alles, was Insa-Dong zu bieten hatte. Souvenirs gab es in allen Farben, Formen und Variationen, ob es nun etwas Traditionelles war oder ob es sich um Kitsch in Form von Schlüsselanhängern handelte. Wer irgendetwas aus Korea suchte, fand es hier mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. Wir waren in einem Gebäudekomplex, Ssamjigil Street genannt, der nur aus kleinen Läden bestand, fast schon wie eine Mall, nur offener. In einer ständigen Schräge wanden sich die vier Stockwerke übereinander, so dass man keine Treppen steigen musste und trotzdem vom Erdgeschoss bis in den vierten Stock kam. Während man zur einen Seite die Schaufenster hatte, fand sich zur anderen ein offener Hof, so dass man immer wieder einen Blick auf die vergangene Etage werfen konnte.

Es war dort so voll, dass ich nach nur wenigen Minuten nicht mehr wusste, wohin mit mir. Menschen aller Nationen wuselten umher, schlenderten von einer Seite der Rampe zur anderen, während sie die verschiedenen Waren diverser Handwerker und Einzelhändler begutachteten. Obwohl schon seit geraumer Zeit in Seoul unterwegs, hatte ich bisher nie den Eindruck gehabt, dass es so überlaufen gewesen war, was wahrscheinlich nur daran lag, dass andere Touristenplätze weitläufiger waren. Für Tempel und Schreine stellte man bereitwillig viel Platz zur Verfügung, und auch wenn die Metro mal zur Stoßzeit fuhr, arrangierte man sich mit dem erhöhten Menschenaufkommen.
Glücklicherweise war Insa-Dong mehr als nur diese eine belebte Straße. Die zahlreichen Gassen, die von der Haupteinkaufsstraße abzweigten und ein wirres Muster städtischer Entwicklung darstellten, boten einem die Möglichkeit vor den gewaltigen Menschenmassen zu fliehen, ohne sich zu weit von diesem Touristenmagneten zu entfernen. Auf diese Weise tauchte man in eine andere Welt ein. Dort fanden wir niedrige Häuser in traditioneller Bauweise mit eingemauerten Vorgärten und von Drachen sowie Fischen geschmückten Dachziegeln. Verandas und Innengärten waren ebenfalls zu sehen. Auch wenn mittlerweile alle Straßen mit Steinen bedeckt oder asphaltiert waren, konnte man sich in diesen Hinterhöfen und Seitengassen sehr gut vorstellen, wie die normale Bevölkerung vor vierhundert Jahren gelebt haben könnte. Selbstverständlich waren die Häuser modernisiert, verfügten über einen Anschluss an Strom und Abwasser ebenso wie mehrfach verglaste Fenster. Dessen ungeachtet sahen die Gebäude einfach nur alt und urig aus. Sackgassen, enge Passagen und Eingangstore bestimmten hier das Bild. Es war so verwinkelt wie die Paläste, weshalb wir uns das ein oder andere Mal ein klein bisschen verliefen. Daraus resultierte, dass wir ein bisschen zu früh oder einfach nur überraschend wieder auf der Hauptstraße standen. Man hatte schon fast den Eindruck aus der Millionenstadt hinaus aufs Land gefahren zu sein. Aber nur fast.
In einer dieser winzigen Gassen fanden wir ein traditionelles Teehaus, das einen wirklich schmucken Eindruck machte. Ein wohlgepflegter Garten im hauseigenen Hof lud nahezu dazu ein näher zu kommen. Die Fassade aus unbehandeltem Holz und Glas tat ihr übriges. Ein Besuch solche einer Einrichtung stand eh auf unserer To-Do-Liste, also spazierten wir schnurstracks hinein. Drinnen fand sich eine Mischung aus Ost und West, aus papierbezogenen Schiebetüren und Glasvitrinen, aus auf dem Boden sitzen und Tischen mit Stühlen. Es war eine lustige Mischung, obwohl alles doch sehr passend wirkte und sehr gut aufeinander abgestimmt war.

Wir entschieden uns dafür den traditionellen Teil des Hauses in Beschlag zu nehmen und setzten uns an einen niedrigen Tisch auf den Boden. Dieses Mal gab es keine Rückenlehnen, was uns allerdings überhaupt nicht störte. Der Kellner brachte uns eine Speisekarte in englischer Sprache mit Bildern und nach einigem hin und her entschieden wir uns für ein „Menü“, das aus zwei Tees und einigen traditionellen Süßigkeiten bestand. Unsere Wahl fiel auf Omija-Tee (beide von uns nahmen diesen, obwohl wir unterschiedliche hätten wählen können) und einen Haufen aus gepufften, süßen Reisbällchen sowie einigen Yaguas. Es klingt nicht nach viel, war es aber. Vor allem die Yaguas hatten es in sich, da es kleine in Öl frittierte Teigtaschen waren.
Der Omija-Tee war ein Erlebnis für die Geschmacksknospen. Aber auch die anderen Sinne hatten was davon. Er war rot, schmeckte süß, salzig, sauer zugleich und man hatte ihn mit Pinienkernen garniert. Man konnte ihn heiß oder kalt trinken. Trotz der brütenden Temperaturen hatten wir uns für die warme Variante entschieden. Serviert wurde das Erfrischungsgetränk in einer großen Schüssel, so dass wir lange davon zehren konnten. Omija wird in Korea im Sommer getrunken, weil er viele Nährstoffe enthält, die man während der heißen Jahreszeit ausschwitzt. Trotzdem weiß ich bis heute nicht, woraus oder wie genau er gemacht wird. Jedenfalls schmeckte er uns beiden sehr gut und wir genossen ihn in vollen Zügen.
Die Süßigkeiten, die wir dazu erhielten, waren einfach nur phantastisch. Der gepuffte Reis hatte sogar unterschiedliche Geschmacksrichtungen, je nachdem welche Farbe man aß. Ich mochte die gelben am liebsten. Es fühlte sich fast an, als würde man auf Luft kauen. Ich war begeistert. Die Yaguas waren auch richtig gut, mit Honig überzogen, aber so mächtig. Zusammen mit dem Tee ergänzten sich die Speisen hervorragend.

Die Preise waren mehr als stattlich, doch hatten wir das in unserem Budget einkalkuliert, so dass wir uns keine Sorgen machen mussten. Immerhin zahlte man hier auch für das Ambiente sowie den Service, und da Koreaner das Prinzip von Trinkgeld nicht verstehen, stimmte der Preis für uns schon.
Mit diesen köstlichen Naschereien hatten wir einen weiteren wichtigen Punkt erfüllt, nämlich traditionelle koreanische Süßigkeiten essen. Der Tee war ein zusätzlicher Bonus. Nach einer langen Verweildauer in gemütlicher Atmosphäre entschieden wir uns dafür weiter durch Insa-Dong zu ziehen.
Auf der großen Straße gab es noch viel zu sehen. Obwohl es viele Geschäfte in den Häuserzeilen gab, verlagerten viele Verkäufer ihre Einkaufsmöglichkeiten nach draußen. Manchmal war es nicht nur eine Erweiterung des Angebots drinnen, sondern ein ganzer Stand, der mitten auf der belebten Fußgängerzone stand. Ob es nun um Snacks oder Souvenirs ging, spielte dabei keine Rolle, denn es war mal wieder von allem etwas dabei. Auch internationale Spezialitäten, wie türkisches Eis, fanden wir vor, konnten es leider aber nicht probieren, weil die Yaguas immer noch sättigten. So streiften wir einige Zeit ziellos durch die Gegend, bis wir unser Augenmerk wieder auf weitere Attraktionen richten konnten.
Unhyeongung Palast
In der Nähe der Insa-Dong Straße befand sich der Unhyeongung Palast. Da wir gerade in der Gegend und wieder erfrischt waren, gingen wir auch dort hin. Im Gegensatz zum Gyeongbokgung Palast war dieser hier klein, überschaubar und schlicht. Es gab keine bunten Wände, Thronsäle oder Säulen, sondern nur einfaches Weiß und naturbelassenes Holz. In Anbetracht der Tatsache, dass es sich hierbei um die Privatresidenz eines ehemaligen Herrschers handelte, wundert es nicht sonderlich. Schließlich funktionierte dieser Gebäudekomplex anders als der große, repräsentative Palast eine Haltestelle weiter. Es gab hier sogar einen Fotopunkt, an den man sich stellen sollte, um ein postkartenmotivwürdiges Foto von der Anlage zu schießen.
So sieht es aus:

(Bei strahlendem Sonnenschein ist die Wirkung natürlich wesentlich imposanter.)
Mit diesem Palast waren wir auch wesentlich schneller durch, weshalb wir uns noch die Zeit nahmen, kurz in das angebaute Museum einzutreten, um ein bisschen über die Historie dieser Gegend zu erfahren. Es war im Eintrittspreis von „freier Eintritt“ bereits enthalten.
Jogyesa Tempel
Auf der – so zu sagen – gegenüberliegenden Seite von Insa-Dong lag der berühmte Jogyesa Tempel, in dem jedes Jahr zum Geburtstag von Buddha das Lotus Laternen Festival stattfand. Es war nicht diese Zeit des Jahres, also betrachteten wir den Tempel einfach nur in seiner alltäglichen Pracht.
Im Hof des Tempels waren zahlreiche Bottiche mit riesigen Lilienblättern drin, die beinahe schon überquollen. Man konnte zwischen ihnen umherspazieren oder sich zielgerichtet dem Tempel zuwenden.

Eine riesige Buddha-Statue saß an der hinteren Wand des Hauptgebäudes. Fotos davon waren nicht gestattet, aber niemand störte sich daran, dass wir rein gingen, um uns ein wenig umzusehen. So lange man die Gläubigen respektvoll behandelte und in ihren Gebeten oder Ritualen nicht störte, blieb man unbehelligt.
Es war überraschend zu sehen, wie viele Lebensmittel in dem Tempel gelagert wurden. Ob es nur Opfergaben waren oder es sich um die Verpflegung der Mönche handelte, war für uns nicht ersichtlich. Berge von Reissäcken stapelten sich im Hauptgebäude. Was noch darunter war, kann ich nicht einmal erahnen. Daneben standen riesige Tontöpfe, die nur auf ihren Inhalt vermuten ließen.
Eines Tages unterhielten wir uns mit unserer jüngsten Mitarbeiterin Beverly. Ich weiß nicht mehr, wie wir auf das Thema kamen, aber wir sprachen über Kim. Genau da fing auch schon das Problem an, denn sie sprach die ganze Zeit über Kim, während Franziska und ich uns wunderten, wen sie überhaupt meinte. Wir fragten nach, woraufhin Beverly uns erklärte, dass die den jungen Kollegen meinte. Gefolgt wurde das Ganze von diesem Wortwechsel: „You mean Jae Won?“ – „Who is Jae Won?“ – „Who is Kim?“ („Du meinst Jae Won?“ – „Wer ist Jae Won?“ – „Wer ist Kim?“). Nach einigem Hin und Her stellten wir fest, dass wir tatsächlich von derselben Person redeten, die in unseren Lettern Kim Jae Won geschrieben werden würde. Beverly, die ein Problem damit hatte sich koreanische Namen zu merken, machte es sich einfach, indem sie einige Leute nur mit Nachnamen ansprach. Darunter auch Jae Won. Die meisten Koreaner machten sich auch nichts daraus. Für uns führte es allerdings zu großen Kommunikationsproblemen, da wir dies zu dem Zeitpunkt nicht wussten. Davon abgesehen, ist Kim der häufigste koreanische Familienname, was allein schon daran deutlich wurde, dass wir in unserer Mafia-Gemeinde drei Leute mit diesem Namen vorfanden: Kim Hulk, Kim Jae Woo und Kim Jae Won. Es kann gut und gerne vorkommen, dass man in einen Raum mit zehn Leuten „Kim“ hineinruft und sechs sich angesprochen fühlen. Irgendwann begriffen wir dann aber doch, wann Beverly wen meinte, so dass wir uns weiterhin gut unterhalten konnten.
Mapo-Gu
Eines Tages beschlossen wir, dass es an der Zeit war, unsere Gegend ein bisschen näher kennenzulernen, so dass wir auszogen, Hongdae unsicher zu machen. Praktisch vor der Haustür gab es mehrere Universitäten. Mal von, wie soll ich es nur richtig nennen?, kollegialer Neugier abgesehen, interessierte sich vor allem Franziska dafür, wie ihr künftiger Arbeitsplatz aussehen könnte. Natürlich ist diese Aussage nicht allzu ernst zu nehmen.
Wir entschieden uns dafür, die zwei Haltestellen hin zu fahren, um dann gemütlich zu Fuß zurück zu spazieren. Den Anfang nahm die Ewha Frauen-Universität, die wir an der gleichnamigen Haltestelle fanden. Zuerst stolperten wir in eine Information, weil wir einige Hilfe zu der Gegend brauchten, nur um dann festzustellen, dass diese Einrichtung samt Museum sich ausschließlich um die Belange der Ewha-Universität kümmerte. Auf diese Weise erfuhren wir einiges über die Entstehungsgeschichte, Philosophie und Entwicklung dieser Einrichtung.
Weiter ging es zum Gebäude selbst. Vor uns erstreckte sich ein Hügel mit einer hübsch angelegten Parklandschaft darauf. Gepflegte Wege, gestutzte Hecken, gewässerter Rasen, all dies bot sich unseren Augen dar. Gespalten wurde dieser majestätische Hügel von einer Schneise aus sorgsam angelegten Steinen, die in einer Treppe endeten. Links und rechts säumten gläserne Wände diesen Durchgang. Es war das Gebäude mit den Hörsälen, das unter diesem künstlichen Hügel begraben lag. Oder hatte man den Hügel drum herum errichtet? Ich weiß es nicht.
Drum herum gab es noch weitere Universitätsgebäude, die eher traditionell gehalten wurden, also aus steinernen Wänden, einem Dach und einigen Fenstern bestanden.

Nachdem wir einmal bis zur Treppe und zurückgegangen waren, machten wir uns auf den Weg zur nächsten Universität, die nicht weit entfernt lag: die Yonsei Universität. Zuerst ging es durch eine fußgängerfreundliche Zone mit breiten Gehwegen und viel Platz für alle Leute, die kein Vehikel bei sich hatten. Unterwegs stürmte eine eifrige Verkäuferin aus einem der Geschäfte, sprach uns in gutem Englisch an und drückte uns eine Feuchtigkeitscreme auf die Hände, die wir unbedingt ausprobieren mussten. Ehre, wem Ehre gebührt: Mit ihrem kecken Auftreten und ihre unverfänglichen Art fiel es mir sehr schwer, ihr abzulehnen und einfach so weiter zu gehen. Als wir weiterzogen, ohne ihre Produktpalette in Augenschein zu nehmen oder gar etwas zu kaufen, machte sie ein übertrieben trauriges Gesicht und wischte sich gespielt die Tränen ab. Zwei Tage später fühlte ich mich deshalb immer noch schlecht. Zurück zum Thema.
Schon bald stellte sich allerdings heraus, dass unsere Reise zur Yonsei Universität doch nicht so unbeschwerlich sein würde, wie zuerst angenommen. Denn die Straße zum Universitätsgelände befand sich gerade im Umbau, wodurch wir gezwungen wurden, der Beschilderung zu folgen und einen Umweg zu nehmen. So schlossen wir uns den Menschenmassen an, gingen über verschlungene Pfade, durch andere Gebäude, über Treppen, Wege und Hügel, bis wir vor diesem Gebäude standen, das uns den Eindruck vermittelte, wir wären wieder in Europa oder Neuseeland gelandet, denn es sah ganz und gar englisch aus. Damit niemand auch nur auf die Idee kam, den wohlgetrimmten Rasen mit den dazu passenden Buchsbaumhecken zu betreten, hatte man vorsorglich einige niedrige Barrieren aufgestellt. Ob man es nun glauben mag oder nicht, dadurch wirkte das Ganze noch britischer.

Franziska fiel zwischendurch ein, dass unsere Universität eine Partnerschaft mit einer der Unis in Seoul hatte. Just in diesem Moment wünschte sie sich, dass kein Koreaner jemals das Angebot des Studentenaustausches annehmen würde. Unser 70-erjahrebetonbau konnte mit den architektonischen Kunstwerken dieser Millionenmetropole keineswegs mithalten.
Nach kurzer Verweildauer zogen wir weiter. Der Tag war noch jung und wir frisch auf den Beinen, so dass wir uns entschlossen, auch die restlichen Sehenswürdigkeiten des Universitätsviertels auf uns wirken zu lassen. Wir spazierten – oder besser gesagt: marschierten – weiter. Unser Ziel war diesmal die Sangsu-dong Café Straße.
Es gab eine Reihe von Möglichkeiten, dorthin zu gelangen, und auf unserer Karte war das gesamte Viertel als Sehenswürdigkeit markiert. Wir kamen nicht nur an der Hongik Universität vorbei, sondern auch an der Hongdae Straße, die vor allem bei jungen Leuten als Party-, Einkaufs- und Kulturmeile hohes Ansehen genießt. Auch die Hongik Universität hatte mehr Stil als die Universität Siegen. Wie ein riesiger Triumphbogen aus Glas und Marmor erhob sich dieses Monument über den Straßen von Seoul.

Wir gingen nicht hinein, es hätte zu deprimierend werden können. Außerdem mussten wir noch die Hongdae Straße unsicher machen. Es war schlichtweg voll und laut. So viele Menschen, so viele Geschäfte und verschiedene Angebote. Irgendwie war es aber weder hektisch noch aggressiv. Nur hin und wieder teilte ein Auto die Menschenmassen, die sich sonst gemütlich zwischen den Läden umherbewegten. Überall war Werbung, Musik und etwas zu essen. Es war sonderbar – gleichzeitig aber auch amüsant. Zwar kauften wir an diesem Tag nichts, aber wir gewannen einen guten Eindruck davon, was einen jungen Koreaner mit Modebewusstsein ausmachte.
Als wir dann endlich in den Teil kamen, in dem sich Cafés nur so häufen, hatten wir die Qual der Wahl ein geeignetes Lokal für uns zu finden. Wir irrten von links nach rechts (Straßennamen gab es immer noch nicht so richtig), drehten uns im Kreis, schlichen durch enge Gassen und entschieden uns schließlich für ein Café, das einfach nur interessant aussah. Die zwei jungen Männer hinter der Theke schienen gleichzeitig begeistert und verloren. Zum einen freuten sie sich wahrscheinlich darauf endlich mal ihre Englischkenntnisse unter Beweis zu stellen; zum anderen hatten sie wohl Angst, dass wir Fragen stellen würden, auf die sie keine Antwort wussten. Wie dem auch sei, das Grinsen in ihren Gesichtern war schon ein Punkt beim Unterhaltungsfaktor.
Wir schlossen diesen wanderfreudigen Tag ab, indem wir noch ein bisschen durch die Straßen in Richtung Hostel schlenderten. So sahen wir noch ein bisschen mehr von dem Vierteln, das wir derzeit unser zu Hause nannten.
Yanghwajin Foreign Missionary Cemetery
Eines Nachmittags war es so heiß, dass wir uns nur einen kurzen Ausflug zutrauten. Wir wollten ja immer noch etwas von der Stadt sehen. So zogen wir ans Ufer des Hangang-Flusses, um diesen ominösen Friedhof ausländischer Missionare zu finden. Bisher hatten wir nicht sonderlich viel Glück damit, da unsere Karte nicht genau genug war. An diesem Tag wollten wir uns nicht so schnell unterkriegen lassen. Nach einigem Hin und Her, rechts und links, vor und zurück stolperten wir dann doch darüber. Es erstreckte sich ein Meer an Grabsteinen vor uns, durchbrochen von Grünflächen und sorgsam gepflegten Pfaden. Nach all der Zeit in fernen Ländern war es seltsam mal wieder so viele europäische Namen zu lesen – und das auch noch in einer Schrift, die ich beherrschte. Wir drehten eine kurze Runde und beschlossen wieder in die Beschaulichkeit klimatisierter Räume zurückzukehren.
Es war mal wieder so weit, ein Kickerspiel gegen unsere koreanischen Gastgeber zu bestreiten. Es spielten Hulk und Jae Woo gegen Franziska und mich. Hulk schien nicht ganz so vorbereitet, wie es gut gewesen wäre. Zumindest sah er mit Zahnbürste im Mund sehr lustig aus. Jae Woo übernahm die Verteidigung.
Das Spiel begann spannend und lustig. Beide Seiten hatten bereits einige Tore kassiert und das ein oder spektakuläre geschossen. Doch just in diesem Moment wendete sich das Blatt. Ein Ball kullerte ganz gemächlich an der gegnerischen Zweierreihe vorbei; Jae Woo versuchten hektisch den Torwart in Position zu bringen – was gehörig schief ging. So kullerte der Ball seelenruhig ins Tor. Jae Woo erstarrte für einen Moment. Hulk drehte – mit der Zahnbürste immer noch im und Schaum vor dem Mund – langsam den Kopf zu seinem Mitspieler. Jae Woo ahmte ihn nach. Während Hulks Augen fast schon Dolche warfen, entwickelte Jae Woo einen bemitleidenswerten Hundeblick. Kleinlaut sagte er: „Sorry, boss.“ Das war ein Bild! Wir brauchten mehrere Minuten, um uns wieder so weit einzukriegen, dass ein vernünftiges Spiel möglich war. Selbstverständlich nutzte unser Gastgeber die Gelegenheit, um ein aggressives Angriffsmanöver durchzuführen. Vergebens.
Koreanisches Nationalmuseum Seoul
(nicht zu verwechseln mit dem National Folk Museum of Korea)
Wenn man sich das Nationalmuseum Koreas ansehen möchte, muss man sehr viel Zeit einplanen. Um es kurz zusammenzufassen: Bescheiden ist anders. Hier präsentierte sich Südkorea mit stolzgeschwellter Brust.
Ich weiß gar nicht so recht, wo ich anfangen soll. Wie bereits erwähnt, erlaubte unsere Arbeitsvereinbarung es nicht, dass wir beide gleichzeitig einen freien Tag hatten. Also blieb uns nichts anders übrig, als nachmittags zum Museum zu fahren, um es sowie die ihm inne liegenden Schätze zumindest für einige Stunden in Augenschein zu nehmen und zu bewundern. Da der Eintritt generell frei war, konnte man auch einige Male hinein gehen, ohne irgendetwas Wichtiges auslassen zu müssen, wenn man so viel Hingabe zeigte.
Die Fahrt war – für Seouler Verhältnisse – kurz und wir mussten nur einmal umsteigen. An der Zielhaltestelle war der Weg zum Museum hervorragend ausgeschildert, so dass man nicht einmal die Gelegenheit bekam, sich irgendwie zu verlaufen. Wenn man den Schildern folgte, kam man in einen unterirdischen Gang, der einen schon einmal auf die Kunstwerke im Museum vorbereitete. Auf den ersten Blick sah dieser Tunnel recht trostlos und langweilig aus. Grauer Stein bedeckte den Boden, grau waren die Wände und auch die Decke glänzte nicht in Farbenbracht. Schaute man allerdings genau hin, erkannte man schnell, dass die kleinen Löcher in den Metallverkleidungen der Wände verschiedene Muster ergaben. Zudem wurden sie von hinten beleuchtet, so dass man verschiedene Figuren oder Umrisse erkannte. Anfangs dachte ich, dass es nur eine einfache Zierde sei, doch nach dem Besuch des Museums begriffen wir, dass dort die Konturen der Ausstellungsstücke ausgeleuchtet wurden. Es war einfach nur genial.

Da der Tunnel sich schon einige Meter hinzog, erleichterte ein Rollband wie am Flughafen das Vorankommen. Für all jene, die doch lieber zu Fuß gehen wollten, standen in geringen Abständen Bänke am Rand, so dass man sich problemlos ausruhen konnte.
Oben angekommen standen wir auf einem riesigen Platz, an dessen Ende die Umrisse des Museums zu erkennen waren. Davor war ein einfacher Teich mit Pavillon angelegt worden; Bänke standen am Ufer.

Wir stapften die Stufen mit katastrophal ausgemessenen Abständen empor, um uns diesem Ungetüm von Gebäude zu nähern. Während der Großteil des Gebäudes in hellem Grau und Beige erstrahlte (die Steine waren blank poliert), bestand der Eingangsbereich aus einer runden Glaskonstruktion, die über alle drei Etagen ging. Zu unserer Linken gab es eine (kostenpflichtige) Sonderausstellung zur polnischen Kunst. Diese sahen wir uns nicht an. Der kostenlose Teil des Museums nahm schon genug unserer Zeit in Anspruch – und im Gegensatz zu Franziska kenne ich mich mit Kunst, insbesondere mit Gemälden, überhaupt nicht aus. Ein freundlicher Mitarbeiter in weißen Baumwollhandschühchen öffnete uns die Tür, so dass wir uns nicht die Finger schmutzig machen mussten (wir denken dran, dass gerade eine Epidemie herrschte). Im Eingangsbereich standen zudem Desinfektionsmittelspender, an denen die Besucher sich gütlich tun konnten, wenn ihnen der Sinn danach stand. Einige Hinweisschilder erklärten in Bildern, was man machen durfte und was untersagt war. Beispielsweise durfte man gut und gerne Fotos schießen, so lange man keinen Blitz benutzte. Das war doch was.
In der Glaskonstruktion fand sich ein Informationsschalter, an dem Schilder darüber Auskunft gaben, welche Sprachen der jeweilige Mitarbeiter sprach. Es überraschte mich positiv, dass es sogar einen Schalter für Gebärdensprache gab. Wir griffen uns je einen Flyer mit Lageplan in verständlicher Sprache und stapften zielsicher und gleichzeitig orientierungslos in das Museum hinein. Besonders schön war an dem Merkblatt, dass man eine Auflistung verschiedener Highlights für jeden Flur und Raum zur Hand hatte. So konnte man explizit nach einem bestimmten Ausstellungsstück Ausschau halten.

In der Mitte gab es einen breiten Gang, der es jedem Besucher erlaubte, die Pracht dieses Bauwerks in sich aufzunehmen. Heller Stein von derselben Farbe wie draußen verkleidete jede Fläche, so dass die gesamte Konstruktion noch größer und beeindruckender wirkte, als sie ohnehin schon war. Ein gläsernes Dach ließ das Sonnenlicht ungehindert einstrahlen, was selbstverständlich auch dazu beitrug, den Raum noch größer wirken zu lassen. Als ob das noch nötig wäre. Einen krassen Kontrast dazu bildeten die Ausstellungsräume, die stellenweise so stark abgedunkelt waren, dass man die Ausstellungsstücke nicht in allen Details erkennen konnte.
Das gesamte Museum war äußerst übersichtlich strukturiert. Im Erdgeschoss fanden die Besucher die Geschichte Koreas von der Steinzeit bis zum 20. Jahrhundert vor. Im Stockwerk darüber fand man verschiedene Ausstellungsstücke, die unterschiedliche Themengebiete wie Malerei, buddhistische Kunst, Kalligraphie und Anderes abdeckten. Außerdem gab es dort auch Schenkungen verschiedener Privatpersonen, was oftmals ein buntes Sammelsurium unzusammenhängender Werke darstellte. Ganz oben wiederum fanden sich Kunstschätze verschiedener asiatischer Herkunftsländer, Skulpturen sowie Porzellanwaren.
Zwischen all den Räumen und Gängen hatte ein mitdenkender Kopf dafür gesorgt, dass sich genügend Nischen für ermattete Besucher fanden. Es gab Sitzplätze in Hülle und Fülle, an den Ausgängen fanden sich Wasserspender und neben zahlreichen Souvenirshops boten auch ein Café sowie Restaurant ihre Waren preis. Man hätte dort einziehen können und würde vermutlich nichts missen.
Aber auch die große Halle, der Gang zwischen all diesen Räumen, bildete einen kleinen Ausstellungsraum. Klein in dem Sinn, dass nicht viele Stücke darin zur Schau gestellt wurden. Diejenige, die man fand, waren aber auch protzig. So beispielsweise die Pagode mit zehn Stockwerken. Oder eine Stele auf dem Rücken einer Schildkörte.

Wir beschlossen kurzerhand links abzubiegen und durch die erste Tür in einen der zahlreichen Ausstellungsräume einzutreten. Wie sich schon bald herausstellte, war das keine sonderlich gute Entscheidung. Pfeile auf dem Boden machten uns schon früh darauf aufmerksam, dass wir genau entgegen der Richtung wanderten, die der Kurator für die Besucher vorgesehen hatte. Doch wir waren zu stur uns etwas von unsichtbaren Museumsmitarbeitern vorschreiben zu lassen, also blieben wir auf dem von uns eingeschlagenen Pfad und stolperten dadurch rückwärts in der Zeit durch die koreanische Geschichte. Es begann mit dem Ende, also mit der Joseon Dynastie.
Da dieser geschichtliche Teil eben auch jener war, der uns beide am meisten interessierte, nahmen wir uns viel Zeit, um auch alles Interessante durchzulesen, uns mal hier, mal dort ein Filmchen anzusehen, gebührend Fotos zu machen und manchmal einfach nur zu bestaunen. Dies Verhalten hatte allerdings auch zur Folge, dass wir nur langsam vorankamen. Nach mehreren Stunden Aufenthalt hatten wir nicht einmal die Hälfte des Erdgeschosses hinter uns, und obwohl wir viele Informationen in uns aufnahmen, fand ich, dass mancherorts nicht genug für ausländische Besucher übersetzt worden war. Während man nämlich zu einigen Ausstellungsstücken einen langen Text auf Koreanisch vorfand, gab es im Englischen nur eine Übersetzung zum Titel oder den Namen des Gegenstandes selbst. Am Ende dieser ersten Erkundung waren wir gerade erst einmal mit einer Ära sowie einer Sonderausstellung durch. Doch unsere Köpfe wollten nichts mehr in sich aufnehmen, so dass wir uns dazu entschieden, an einem anderen Tag noch einmal hierher zurückzukehren.
Mittwochs war das Museum länger geöffnet, weshalb wir unsere nächsten Ausflüge auf diesen Tag legten. Wir dachten uns, dass mit mehr Pausen und mehr Zeit auch mehr zu schaffen war.
Bei jedem weiteren Besuch schafften wir immer ein bisschen mehr, so dass wir letzten Endes, also nach der dritten Visite, das gesamte Museum durchschritten hatten. Das war eine enorme Leistung. Durch einige Räume liefen wir mehr oder weniger ohne uns etwas durchzulesen durch, weil uns das Thema nicht wirklich interessierte. Ich weiß beispielsweise bis heute nicht, was es mit den Dachziegeln und ihren Endstücken auf sich hat, aber sie sorgen bis zu diesem Tag für unruhige Verhältnisse zwischen Korea und Japan. Ebenso wenig war der Bereich mit Kalligraphie interessant, weil ich es schlichtweg nicht verstand.
Hier nur einige interessante oder lustige Sachen, die mir beim Besuch aufgefallen waren.
Es gab eine Statue von einem Pferd, die aus China stammte und eine hervorragende Erklärung dafür war, warum die Pferde im Disney-Film Mulan so gezeichnet worden waren, wie sie nun einmal waren: Die Statue sah genauso aus! Ein viel zu mächtiger Körper mit riesigem Hals auf viel zu dünnen Beinchen.

In einem Raum gab es fünf Bildschirme, die unterschiedliche Bilder in asiatischem Stil zeigten und doch zusammenhingen. Sie stellten eine Landschaft dar, die sich im Lauf der Jahreszeiten veränderte. Ein Pfad führte über alle Bilder hin zu einer Burg oder einem Tempel und kleine Figürchen bereisten diesen in verschiedenen Tempi. Es war richtig klasse gemacht.

Franziska faszinierte insbesondere der Goldbronzene Bodhisattva in nachdenklicher Haltung.

Ich war von der Töpferware angetan.
Zum Abschluss einer unserer Besuche nahmen wir eine andere Route hinunter, um einen kurzen Spaziergang um den Teich zu drehen. Dort fanden wir eine große Glocke, einen schmucken Rastplatz vor dem Museum und einen Garten mit kleinen Pagoden. Die gesamte Anlage war sehr schön und auf jeden Fall einen Ausflug wert.
Wir sprachen uns schon früh mit Hulk ab, wann wir das Inno Hostel verlassen würden, damit er sich rechtzeitig um Ersatz für uns kümmern konnte. Umgekehrt gab es uns die Gelegenheit einen Plan zu machen, wie lange wir überhaupt in Busan bleiben wollten. Seoul gefiel uns sehr, unsere Gastfamilie war klasse, also blieben wir länger als die mindestens geforderte Zeit von einem Monat. Dies stellte uns allerdings vor das Problem, dass wir in Busan nur als Touristen unterwegs sein würden, weil man auch dort Leute für mindestens einen Monat suchte. Wir rechneten also mit zwei Wochen in der zweitgrößten Stadt Südkoreas.
Glücklicherweise waren wir bei der Mafia gelandet, was uns Beziehungen im ganzen Land verschaffte, insbesondere in Busan, auch wenn wir davon noch nichts wussten. Eines Tages fragte Hulk uns, ob wir nicht auch in Busan arbeiten wollten. Wir bejahten, erklärten ihm aber die Schwierigkeit, die wir darin sahen. Er meinte selbstsicher, dass das gar kein Problem sei – er würde schon einen Job für uns finden. Das freute uns sehr. Auch wenn der erste Vermittlungsversuch aus organisatorischen Gründen nicht klappte, war Hulks Repertoire damit noch lange nicht ausgeschöpft. Bei seinem ehemaligen Arbeitgeber fand er einen Ansprechpartner mit offenem Ohr und verschaffte uns somit binnen weniger Tage eine neue kostenlose Unterkunft. Wie lange wir bleiben konnten, spielte plötzlich keine Rolle. Das lief doch hervorragend.

Wie man an diesem Bild vielleicht erkennen kann, hatte das Inno Hostel eine gläserne Front, was wahrscheinlich nur damit zusammenhing, dass man die Gäste trockenen Fußes (oder trockener Haare; ich bin mir nicht sicher, was in Korea höher gehandelt wurde) in ihre Zimmer geleiten wollte. Jedenfalls kamen wir oft durch bestimmte Teile dieses Gebildes, weil es auf dem Weg zu unseren Dienstbotenquartieren lag, die sich auf dem Dach befanden. Diese Konstruktion half uns dabei so etwas wie ein Haustier zu halten. Es war keine bewusste Entscheidung, nein, mehr eine Fügung des Schicksals. Eines Tages spazierte ich also über die verglaste Terrasse, als ein goldenes Geschöpf mir ins Auge stach. Es war ein ziemlich großer Käfer, der es nicht schaffte, das Glas zu überwinden oder zu umgehen und definitiv auf Hilfe angewiesen war, wenn er den nächsten Tag noch erleben wollte. Ich half dem armem Racker seinem unsichtbaren Gefängnis zu entfliehen – nur um ihn oder einen seiner Verwandten am nächsten Tag wieder im Treibhaus zu begrüßen. Daraufhin nannte ich ihn Hubert.

Franziska half mir gerne dabei, Hubert immer wieder freizusetzen, was einige Male notwendig war, weil der Racker sich unentwegt in Lebensgefahr brachte. Wir schimpften mit ihm, schüttelten die Köpfe und ließen ihn fliegen. Besonders tragisch war der Vorfall, als ein toter Hubert mal auf unserem Dach lag. Jede Hilfe kam zu spät. Es war nichts mehr zu machen. Tagelang machte ich mir Vorwürfe, fragte mich, ob ich irgendwelche Zeichen falsch gedeutet hatte, ob es irgendetwas gab, was ich anders hätte machen können. In dieser Zeit der Trauer sah ich mich nicht in der Lage, diese lebelosen kleinen Körper zu bewegen. Als wir ihn dann endlich fachmännisch entsorgten, tauchte am nächsten Tag ein weiterer toter Hubert auf. Ich war von da an davon überzeugt, dass wir diesen liegenlassen mussten, damit er eine Warnung für jeden kommenden Hubert darstellen konnte. Erstaunlicherweise half es.
Das soll jetzt nicht heißen, dass andere Huberts nicht auch in den Glaskäfig geflogen wären. Wir mussten sie immer wieder retten.
N Seoul Tower
In unserem Bestreben unsere touristischen Neigungen offen ausleben zu können, ließen wir es uns selbstverständlich nicht entgehen, die größte, bekannteste und meist besuchte Attraktion Seouls zu besuchen: den N Seoul Tower.
Aber ein Ausflug zu dem Turm allein war uns nicht genug, so dass wir noch einige Sehenswürdigkeiten auf dem Weg dorthin mitnahmen. Es fing alles am Bahnhof Seoul an, also am Hauptbahnhof, diesem modernen neuen Prachtgebilde aus Glas und Stahl, das sich hoch erhoben auf einer Plattform den Ankömmlingen und Abreisenden (oder auch nur Passanten) präsentiert. Wir gingen zielsicher hinein – und fragten uns, ob wir am Flughafen waren. Eine riesige, sonnendurchflutete Abfertigungshalle mit zahlreichen Schaltern sowie Geschäften auf mehreren Etagen umfing Menschenmassen, die verschiedene Ziele verfolgten. Einige wollten verreisen, andere nur einkaufen, wieder andere holten Freunde und Bekannte ab. Es war wie ein überdimensionaler Ameisenhaufen und doch sehr entspannt. Metallstreben an der Decke verstärkten den Eindruck einer industriell genutzten Lagerhalle, ebenso wie der viel zu hohe Lärmpegel. An der Akustik hätten sie noch was machen sollen. Wie dem auch sei. Wir drehten nur eine kurze Runde, erkundigten uns über Fahrkarten nach Busan und zogen weiter.

Dicht neben diesem modernen Bauwerk stand der alte Bahnhof, der heutzutage nur noch kulturelle Zwecke erfüllt und als Kulturzentrum sowie Ausstellungsraum und Galerie fungiert. Wir gingen dran vorbei, aber nicht hinein. Anfang des 20. Jahrhunderts erbaut, erfreute man sich am Anblick des Gebäudes auch von außen.

Nicht weit die Straße runter fanden wir dann eines der Stadttore, die wir unbedingt sehen wollten. Inmitten von Hochhäusern, nicht weit einer belebten Kreuzung, stand auf einem kleinen, mit Gras bewachsenen Hügel das Sungnyeumun Tor mit einem Stück Stadtmauer an den Enden. Leider war es derzeit wegen Bauarbeiten für Besucher nicht zugänglich, aber die Dimensionen dieses Bauwerks waren beeindruckend. Allein der Durchgang war ungefähr vier Meter hoch. Früher bildete dieses Tor den südlichen Eingang zur Stadt. Heute stand es – mehr oder weniger – nutzlos im Zentrum. Immerhin konnte man einfach drum herum gehen, da die Stadtmauern schon vor langer Zeit geschleift worden waren.

Wir marschierten weiter, daran vorbei, nicht hindurch, weil es leider nicht möglich war, um uns auf unserem Weg zum Turm noch den Namdaemun Markt anzusehen. Das war im Grunde genommen ein Viertel aus mehreren Straßen, alles eine große Fußgängerzone, versteht sich, das vor kleinen Geschäften nur so überquoll. Mitten im Weg standen Verkaufsstände, die verschiedene Waren feilboten. Darunter fanden wir auch eine Bude, die Obst am Spieß anbot, was mich natürlich anlockte, weil ich der Überzeugung bin, dass am Spieß alles besser schmeckt. Also kaufte ich mir ein Stück grüner Melone (mittlerweile weiß ich, dass die Gattung Futuramelone heißt) und genoss dieses erfrischende Obststück in vollen Zügen. Es war deliziös.
In einem Café zwischen Sungnyeumun Tor und N Seoul Tower holten wir uns – mal wieder – ein Bingsu. Wie immer war es vorzüglich und nach einer kurzen Rast zogen wir auch schon wieder weiter.
Es gab mehrere Möglichkeiten auf den Berg zu gelangen, auf dem der N Seoul Tower stand. Entweder man spaziert gemütlich durch den ihn umgebenden Park oder man nahm eine Gondel. Selbstverständlich entschieden wir uns für die Gondelfahrt. Das hatte nicht nur damit zu tun, dass es viel cooler war, nein, wir hatten schon einen langen und ereignisreichen Tag hinter uns, so dass wir nicht noch einen Berg hinaufkraxeln wollten. Außerdem hofften wir noch auf einen Grillabend in der Herberge. Kaum waren wir vor dem Abfahrtsgebäude angelangt, schwand meine Begeisterung rapide. Ein Schild informierte uns darüber, dass man von dem Punkt, an dem wir uns gerade befanden, noch zwei Stunden warten musste, bis man eines der hiesigen Gefährte betreten würde. Unglücklicherweise war diese Zeiteinschätzung äußerst realistisch.
Während wir uns also draußen die Beine in den Bauch standen und nur im Schneckentempo vorankamen, machte ich mir Gedanken ums Essen. Mit Wehmut dachte ich an das Bingsu zurück, wünschte mir sogar ein neues herbei und überlegte, ob es oben wohl auch ein Lokal mit Bingsu gäbe. (Ja, gab es tatsächlich, und die Preise waren sogar vertretbar.) Einige Besucher waren nicht so ausharrend wie wir und verließen die Schlange, noch bevor sie zur Tür vorgedrungen waren. Besser für uns – jede Minute, die wir weniger warten mussten, brachte uns unserem Ziel näher. Ich hatte zwar den Eindruck, dass wir recht zügig vorankamen, aber dennoch war kein Ende in Sicht. Nachdem wir endlich unsere Tickets – Hin- und Rückfahrt – gekauft hatten, durften wir in den Wartebereich im Inneren des Gebäudes vordringen. Er unterschied sich in nur einem Aspekt von den Verhältnissen draußen: Hier gab es entscheiden mehr Leute. Zuerst ging es die erste Treppe hoch in einen großen Raum mit angrenzendem Kiosk, wo die Schlange einer vorgegebenen Route folgte, so dass noch mehr Menschen ordentlich gestapelt hinein passten. Nachdem wir diese Hürde genommen hatten, folgte eine weitere Treppe. Endlich in der Abfahrtsetage angelangt, wo das Meer an Besuchern in zwei Gruppen geteilt wurde, um gleichmäßig auf beide Gondeln verteilt zu werden. Und nach langweiligen zwei Stunden, die wir mit diskutieren und Fotos knipsen verbracht hatten, ging es endlich los Richtung Bergspitze, Richtung Turm.

Mit ein bisschen mehr Platz als Sardinen in ihrer Büchse fuhren wir mit der Gondel gemächlich die Strecke hoch. Ein organisatorisches Genie hatte das Gefährt so platziert, dass man direkten Blick auf den Turm hatte, während man sich noch auf dem Weg nach oben befand. Das war wirklich klasse, weil es aussah, als würde der Turm das Gondelhäuschen krönen. Wir stiegen aus, stapften einen hölzernen Pfad mit vielen Stufen hoch, um oben auf einer Aussichtsplattform den Blick in aller Ruhe über Seoul schweifen zu lassen. Zahlreiche Verliebte hatten hier an einem Zaun Schlösser mit Liebesschwüren befestigt. Seol Hee hatte uns erzählt, dass auch sie und Hulk das gemacht hatten, aber einen Tag später hatten die Ordnungskräfte alle Schlösser abmontiert, weil der Zaun dem Gewicht nicht mehr standgehalten hatte.
Für müde Füße fanden sich zahlreiche Sitzgelegenheiten sowie ein Pavillon. Auch Lokale und Snackbars gab es zu genüge. Von dem Souvenirshop fange ich gar nicht erst an.
Als nächstes betraten wir die Halle am Fuß des Turms, in der man Eintrittskarten für die Fahrt nach oben kaufen konnte. Tatsächlich war es das erste Mal, dass wir von dem System ein bisschen verwirrt waren. Wir fragten uns zuerst, welche Art von Karte wir brauchten, sprachen daraufhin eine der Verantwortlichen an, klärten dies, holten uns die richtigen Karten, waren traurig, dass nicht jede von uns eine bekam (ich verstehe ja, dass man umweltfreundlich sein will und möglichst wenig Papier benutzt, aber wir waren Touristen, die sich für Souvenirs, die man in Alben einkleben konnte, interessierten) und begaben uns zu den Aufzügen. Was uns zusätzlich verwirrte, war die angedrohte Sicherheitskontrolle. Franziska hatte ihr Schweizer Taschenmesser dabei. Ich hatte auch Zeug in meinem Rucksack, von dem ich mir nicht sicher war, ob es einen Sicherheitscheck passieren würde. Glücklicherweise klärte man uns auf, dass es keine Durchsuchung unserer Taschen geben würde. Leider sagte man uns auch, dass wir den Fahrstuhl noch nicht betreten konnten, weil unsere Nummer noch nicht aufgerufen worden war. Wie man sieht, ging hier alles streng nach Vorschrift. (Ich verweise noch einmal auf die Bürokratieliebe der Koreaner.)
Daher hatten wir genug Zeit, uns in den Geschäften umzusehen. Wir fanden nichts, das unsere Aufmerksamkeit erregt hätte oder uns zum Kauf anregte. Dafür war die Beleuchtung, die den Turm in verschiedenen Farben erstrahlen ließ, umso interessanter.
Nach endlos scheinenden Minuten (ich glaube, es waren 20) des Wartens, durften wir endlich in den Bereich vor dem Aufzug – nur um wieder zu warten. Dort stand eine lange Schlange an Besuchern, die ebenfalls nach oben wollten. Zwischen Eingang und Aufzug gab es noch das Fotostudio, bestehend aus einer grünen Wand und einigen Requisiten, die man verwenden konnte, um ein einzigartiges Bild über den Dächern von Seoul zu schießen. Selbstverständlich wurde man später irgendwo hinein retuschiert. Wir verzichteten dankend auf diesen Spaß. Die Fotos hätten wir nicht kaufen wollen.
Die Fahrt mit dem Aufzug, obwohl äußerst kurz, ist dennoch erwähnenswert. Anstelle von typischer dudelnder Fahrstuhlmusik begrüßte uns ein fetziger Song, der die wenige Sekunden dauernde Fahrt zur zweiten Aussichtsplattform auf 138 Metern Höhe spaßig machte. Doch das war noch lange nicht alles. An der Decke waren große Bildschirme angebracht, die einen lustigen Kurzfilm zeigten: Der Aufzug schoss vom Erdgeschoss ab, flog durch den Turm hindurch, über Seoul hinweg ins Weltall, von wo aus man auf die Erde, später sogar auf das Sonnensystem blicken konnte. Ich war äußerst hingerissen.
Endlich! Endlich, nach ungefähr drei Stunden, waren wir auf dem Turm angekommen. Mittlerweile war es draußen dunkel, so dass wir das Lichtermeer unter uns genießen konnten. Es war eine herrliche Aussicht. Wie so oft in dieser Art Turm standen markante Städtenamen auf die Scheiben sowie die Entfernung zu diesen geschrieben. Nach Berlin waren es von hier aus rund 8.235,4 km.

Wir verbrachten einige Zeit dort oben, drehten die eine, dann die andere Runde, sahen uns um, sahen nach draußen und entschlossen uns, dass wir wieder ins Hostel zurückkehren sollten.
Auf dem Rückweg stellten wir fest, dass wir – oh Wunder, oh Staunen – warten mussten. Die Schlange für die Rückfahrt mit der Gondel war fast so lang wie auf dem Hinweg. Zur Stärkung meiner traumatisierten Nerven holte ich mir einen Snack. Wie an vielen anderen Orten in Seoul verkauften sie auch hier Tornadopotatos.

Ich hatte Glück, denn ich bekam die letzte Kartoffel am Spieß. (Ja, am Spieß schmeckt immer noch alles besser.) Sie war phantastisch, süß und knusprig. Ich habe keine Ahnung, welche Sauce sie dafür verwenden, aber es war ein gelungenes Geschmackserlebnis.
Im Inno Hostel angekommen, stellten wir fest, dass wir leider den Grillabend verpasst hatten. Das Buffet war geplündert, die Gäste angeheitert, die Koreaner betrunken und nichts mehr für uns übrig. Keiner hatte mit so langen Wartezeiten gerechnet. Diesbezüglich hatten wir Pech. Trotzdem war es ein sehr schöner Tag gewesen, den ich in vollen Zügen genoss.
Zurück zu dem Teil mit dem Essen:
Eines Abends – wir saßen nach einem ereignisreichen und betriebsamen Tag erschöpft in unserem Zimmer – klopfte es an unserer Tür. Verwirrt blickten wir einander an, da wir keine Gäste erwarteten. Als wir nach draußen lugten, um unseren Besucher in Augenschein zu nehmen, entdeckten wir Seol Hee, die vom Aufstieg ganz geschafft war. Es war eher der mentale Aspekt, der sie außer Atem brachte.
Aufgeregt erzählte sie uns, dass sie zum ersten Mal aufs Dach gestiegen war und wie spannend sie die Treppe doch fand, bevor sie zum Anlass ihrer Klettertour kam: Martin hatte sich zu einem Grillabend mit Freunden entschieden, bei dem wir herzlich eingeladen waren.
Ich musterte kurz meinen Pyjama und Franziskas Kopfschmuck (ein kunstvoll gebundenes Handtuch), um Seol Hee mitzuteilen, dass wir in wenigen Minuten dazu stoßen würden. Es war keinesfalls Hunger, der uns trieb, denn wir hatten genügend gegessen. Das gesellige Miteinander war Ansporn genug.
So trotteten wir kurze Zeit später nach unten, ließen uns Getränke servieren und nahmen draußen auf einer Bank Platz. Einige Freunde von Martin waren ebenfalls zugegen, so dass wir uns erst einmal vorstellen durften, so lange das Feuer die richtige Größe annahm. Dann warf Martin – Chefkoch des Abends – ein großes Stück Fleisch auf das Rost und behielt es genau im Auge, während wir anderen uns unterhielten. Es gab viel zu lachen, da niemand in der Runde sich zu ernst nahm und man den ein oder anderen Spaß gerne mitmachte. Irgendwann holte Hulk noch drei Europäer hinzu. Wir erfuhren, dass sie aus Island stammten und nur wenige Tage im Hostel bleiben würden, bevor sie zu weiteren Sehenswürdigkeiten zogen.

Zwischendurch versorge Martin uns immer wieder mit kleinen Happen Fleisch. Anscheinend hatte er Angst, wir würden uns zurückhalten und daher nicht satt werden, denn er schob uns immer wieder etwas an den Rand und zeigte explizit drauf, damit wir es nahmen. Hier sei noch erwähnt, dass unser Chefkoch ganz selbstverständlich eine Schere benutzte, um das große Fleischstück in kleine Fleischhappen zu zerteilen. Das ist in Korea nun einmal so üblich.
Irgendwann kamen wir auf das Thema kuriose Essgewohnheiten zu sprechen, was die Isländer mit ihrem abgehangenen Hai klar für sich entschieden. Dennoch erinnerte es unsere koreanischen Gastgeber an ein Video, das den Abend zu einem feurigen Untergang verurteilte. Es ging um die Spicy Korean Noodle Challenge (also, die würzige Koreanische Nudel Herausforderung), bei der die Teilnehmer sich dazu verpflichteten, eine ganze Schüssel äußerst scharfer Fertignudeln zu verspeisen. Sofort kam Seol Hee auf die Idee, dass wir das auch machen müssten. Wie selbstverständlich hatten unsere Gastgeber einen Vorrat explizit dieser Nudeln in der Küche. Sie scheinen zum koreanischen Haushalt dazu zu gehören.
https://www.youtube.com/watch?v=JWZmdWP67DA
Ich sah sie einen Moment ausdruckslos an und lehnte dankend ab. Doch nein, so einfach ließ unsere Gastgeberin sich nicht abwimmeln. Stattdessen lachte sie ehrlich amüsiert auf. Franziska, die diese Nudeln schon lange probieren wollte und hier eine unvergleichliche Gelegenheit witterte, war sofort mit von der Partie. Sie wollte nur, dass auch die koreanischen Gäste mitmachten. Gesagt, getan. Nach langem hin und her, während Martin in der Küche verschwand, um seines Amtes zu walten und eine passende Portion für alle vorzubereiten, rang Seol Hee mir das Versprechen ab, EINE Nudel aus dem Haufen zu essen. Im Gegenzug bekam ich ein schönes Schälchen mit gelbem, eingelegtem Rettich, 단무지 genannt. Es geht das Gerücht umher, dass dieser den Speisen ihre Schärfe zu nehmen vermag. Dies war mir relativ egal, denn ich liebe diese Beilage einfach nur und würde so Einiges dafür in Kauf nehmen. Das hätte ich wahrscheinlich nicht verraten sollen.
Wir hatten also eine Verabredung mit dem Feuerkessel. Als das Mahl zubereitet war, stellte Martin es auf den langsam ausbrennenden Grill, man drückte jedem von uns Schüsseln sowie Stäbchen in die Hand und es wurde aufgetischt. Ich bediente mich einfach bei Franziska. Seol Hee stellte mit misstrauischem Blick sicher, dass ich eine ganze Nudel erwischte, um mir meine Belohnung zu verdienen.
Während ich diese rot gefärbte Teigware mit einem Schärfegrad von viel-zu-hoch-für-mich hinunterkämpfte, genoss meine Reisebegleitung den Snack in vollen Zügen. Tatsächlich merkte sie lapidar an, dass es gar nicht so scharf sei; das Hähnchen einige Tage zuvor sei wesentlich schärfer gewesen. Diese Aussage versetzte alle Anwesenden in Staunen. Kein Wunder. Immerhin waren die Isländer mittlerweile krebsrot im Gesicht angelaufen, was sie keinesfalls davon abhielt, ihre Portion ganz aufzuessen. Sie nahmen sogar einen Nachschlag. (In meinen Augen ein verzweifelter Versuch irgendjemandem zu imponieren.) Unser Chefkoch war wenigstens ehrlich genug aufzugeben und in einer Ecke still weinen zu gehen. Er gab sogar zu, dass er noch nachgewürzt hatte.
Bilanz des Abends war, dass Franziska sich neue (koreanische und ausländische) Bewunderer angelte, während ich meinen Rettich knabberte. Wir waren alle äußerst amüsiert und zufrieden.
Dank unserer neuen Bekanntschaften ergaben sich auch neue Möglichkeiten. Anneena, die unbedingt Englisch sprechen wollte und neue Freunde auf der ganzen Welt suchte, lud uns zu einem koreanischen Grill ein. Natürlich war es ihre Mutter, die ihm Hintergrund das Sagen hatte, aber das verraten wir der jungen Dame einfach nicht. Sie war so begeistert, nicht nur weil sie uns wiedersah, sondern auch weil sie uns zeigen konnte, wie die Koreaner aßen. Wir hatten nämlich keine Ahnung und brauchten die Instruktionen dringend. So trafen wir uns an einem viel zu heißen Tag mit unserer Dreizehnjährigen und ihrer Mutter, um ein bisschen mehr über koreanische Essgewohnheiten zu erfahren. Die beiden hatten das Lokal auserkoren und führten uns zielsicher dort hin. Wir nahmen einen traditionellen Tisch, so dass wir auf den Boden anstatt auf Stühlen saßen. Als das Essen kam, blieb mir erst einmal die Sprache weg:

Ich hätte es ja schon ahnen können, immerhin gab es bisher bei jedem Essen hier in Korea eine Unmenge an Beilagen. Doch das hier war wirklich eine ganze andere Kategorie. Der Blattsalat spielte dabei eine entscheidende Rolle, wie wir später erfahren sollten, aber zuerst einmal schweifte unser Blick von rechts nach links, von oben nach unten und dann in die Mitte des Tisches. Wir hatten keine Ahnung, wo wir wie beginnen sollten.
Um unserer Aufgabe als Gesprächspartner gerecht zu werden, unterhielten wir mit Anneena. Dabei kam die Frage nach unserem Alter auf, und als das Mädchen erfuhr, dass uns drei Jahre trennten, bekamen sowohl sie als auch ihre Mutter tellergroße Augen. Entsetzt schrien sie aus, dass wir ja gar keine Freunde sein könnten, weil der Altersunterschied zu groß war. Wir sahen sie verwirrt an, um ihr dann zu erklären, dass das in Europa gar kein Problem darstellen würde. In Korea war es aber eine große Sache.
Wie es der Fall mit Hulk und Honza war, hätte ich Franziska als meine kleine Schwester vorstellen müssen. Im Umkehrschluss müsste ich auch die Verantwortung für ihr Verhalten übernehmen, wenn irgendwann mal etwas schief lief. Aber nur Gleichaltrige durften sich Freunde nennen. Es begann richtig kompliziert zu werden. Entsprechend weiß ich nun auch nicht, in welchem Verhältnis ich zu Anneena stehe.
Während wir uns mit Small Talk aufhielten, legte Anneenas Mutter geübt die ersten Stücke Fleisch auf den Grill. Pilze, Knoblauch und Kimchi kamen hinzu. Auch hier war es selbstverständlich das Fleisch mit einer Schere in Stücke zu schneiden. Erst wurde es ein bisschen angebraten, dann zerteilt, dann konnte jeder sich bedienen. Ich mochte diese Art des geselligen Teilens. Nicht nur, dass es einfacher war von allem ein bisschen zu probieren, es hatte auch etwas Familiäreres als wenn jeder seinen eigenen Teller vor sich stehen hat. Vermutlich wird sich diese Art des Servierens von Lebensmitteln aus hygienischen Gründen nie in Deutschland durchsetzen.
Als das Fleisch endlich knusprig war, zeigte Anneena uns voller Begeisterung, wie wir es zu essen hatten. Natürlich konnte man es einfach vom Grill in den Mund stopfen, aber das war langweilig und nur etwas für Anfänger. Stattdessen ahmten wir unsere junge Mentorin nach: Man nahm erst ein Salatblatt, das man flach auf die Handfläche legte; darauf kam ein Stück Fleisch, das mit ein bisschen Salz und / oder Sauce gedippt wurde; darauf kam alles andere, was man gerade essen wollte, aber bloß nicht zu viel auf einmal; denn zum Schluss wurde das Salatblatt in einen (großen) mundgerechten Happen eingerollt und in einem Stück in den Mund gesteckt. Kauen und schlucken nicht vergessen. Es war einfach nur göttlich! Ein tolles Geschmacks- und Essenserlebnis, das ich jedem Gourmet wärmstens empfehle.
Die Tofu-Suppe in der Mitte der Platte war für meinen Geschmack ein bisschen zu scharf, aber wir waren hier in Korea, also war das oft der Fall. Dafür tat ich mich an der Vielfalt an Salaten und Beilagen gütlich. Außerdem durfte ich eine Fanta-Sorte probieren, die es nur in Korea gab: Ananas. Es war süß und sprudelig, schmeckte aber tatsächlich nach besagter Frucht.
Nach dem Barbecue gingen wir noch in ein Café um die Ecke, um noch ein Getränk nach den ganzen Speisen zu uns zu nehmen. Die Grundidee hinter dieser Wanderschaft von Gaststätte zu Gaststätte war es offensichtlich, die drückende Hitze draußen zu meiden. Selbstverständlich würde ich mich nie gegen solche Manöver zur Wehr setzen. Obwohl die Klimaanlage im Grillrestaurant schon beängstigend war: Sie versprühte wabernde Wolken weißer Kälte. Genauso gut hätte man in einem Gefrierschrank stehen können. Die offene Gasflamme des Grills hob die Temperatur auf erträgliche Zustände.
Letzten Endes wagten wir uns doch noch nach draußen, aber es hatte sich trotz mittlerweile später Stunde kaum abgekühlt. Leider würden die Temperaturen auch in der Nacht nicht sinken. Dessen ungeachtet zogen wir in einen nahe gelegenen Park, um uns ein buntes Schauspiel anzusehen.
Wir gingen nicht auf direktem Weg dorthin, machten zwischendurch Pausen, dann Fotos, dann wieder Pausen, um letzten Endes bei diesem Farbe sprühenden Brunnen stehen zu bleiben. Es war ein sehr schöner Anblick.

Mehr wegen der Hitze und des daraus resultierenden Durstes als aus einem anderen Grund zogen wir in die nächste Gaststätte, die klimatisiert war und eisgekühlte Getränke anbot. Anneenas Mutter entschied sich für ein Bier, während sie uns ein Bingsu aufschwatzte, obwohl keiner von uns es wirklich wollte. Ein Getränk wäre vollkommen ausreichend gewesen. Aber Koreaner trinken keinen Alkohol, ohne etwas dabei zu essen – vermutlich zählt ein Eis da schon als ganze Mahlzeit. Bei der Größe würde es mich keinesfalls wundern. Ich möchte nur anmerken, dass noch genug von der kalten Nachspeise übrig blieb, obwohl wir alle uns größte Mühe gaben, es zu vertilgen.

Besonders merkwürdig fand ich die Kirschtomaten, die neben Ananas, Melonen, Orangen und Äpfeln in unserem Nachtisch mitschwammen. Nach einer Weile gaben wir auf und brachen nach Hause auf. Mittlerweile war es spät und wir alle waren müde. So trennten sich unsere Wege, doch nicht ohne Anneena zu versprechen, dass wir uns wiedersehen würden.
Im Hostel angekommen stellten wir fest, dass unser Gastgeber seine eigene Party feierte – und uns dazu einlud. Es gab jede Menge Essen – nochmals: Koreaner trinken keinen Alkohol ohne Essen – und genug Alkohol. Tatsächlich waren alle Koreaner äußerst überrascht, als wir ihnen erzählten, dass man in Deutschland gut und gerne in eine Kneipe gehen konnte, nur um ein Bier zu trinken. Oder zwei. Es passte einfach nicht in ihr Weltbild.
tbc...
... link (0 Kommentare) ... comment
Sonntag, 27. Dezember 2015
Seoul – Juni-August 2015 (Land)
atimos, 12:36h

Tatsächlich müsste ich den Zeitraum dieses Kapitels früher ansetzen, denn das Working Holiday Abenteuer Südkorea begann schon in Deutschland.
Nachdem das Working Holiday-Visum Neuseeland so einfach und schnell erledigt war, wagten wir uns auch an das südkoreanische Pendant. Wer hätte geahnt, dass die Unterschiede so groß sein könnten?
Während die Neuseeländer die Bürokratie bei der Visumsausstellung auf ein Minimum beschränkten, liefen die Koreaner hier geradezu zur Höchstform auf. Im Internet konnte man sich darüber erkundigen, welche Dokumente man mit dem Antrag zusammen vorlegen musste. Auch das Antragsformular konnte man herunterladen und ausdrucken. So weit, so gut. Leider unterscheiden sich die geforderten Unterlagen, je nachdem in welcher Botschaft man den Antrag stellt, was wiederum vom Wohnsitz abhängt. Für Nordrhein-Westphalen ist Bonn zuständig. Bedauerlicherweise weiß die linke Hand auch in Korea nicht, was die rechte tut, und so kam es, dass wir mit widersprüchlichen Informationen konfrontiert wurden. Das Internet schrieb: „Nach Ausstellung des Visums muss man innerhalb von zwölf Monaten in Südkorea einreisen, bevor es verfällt.“ Die Dame am Telefon sagte: „Nein, es sind nur drei Monate.“ Nicht nur Verwirrung, sondern auch Sorge machte sich breit. Immerhin hatten wir den Flug schon gebucht, er lag aber noch viele Monate in der Zukunft und dazwischen planten wir noch zwei weitere Länder zu besuchen. Die Sachbearbeiterin schlug uns tatsächlich vor, dass wir von Australien zurück nach Deutschland fliegen sollten, um das Visum dort zu beantragen und dann von Deutschland aus nach Korea zu fliegen. Denn wenn es um die Beantragung eines Visums geht (egal welches Visums), geht die südkoreanische Bürokratie noch einen gehörigen Schritt weiter. Nicht nur, dass das Internet keine Option darstellt, auch der postalische Weg ist ausgeschlossen. Um das Visum zu beantragen, muss man die Dokumente persönlich bei der zuständigen Botschaft abgeben. Die Internetseite weist mit einem Ausrufezeichen darauf hin, dass sie es ernst meinen. Das war völlig absurd – und viel zu teuer. Doch eine Lösung schien in Sicht: das Auswärtige Amt in Südkorea. Wir schrieben die Behörde direkt an, die uns eine Zwölfmonatsfrist bestätigte. Geht doch.
Immerhin verschaffte uns diese Nachricht ein bisschen mehr Spielraum und passte hervorragend in unseren Plan. Da kein Weg dran vorbei führte, zogen wir eines Morgens mit allen Unterlagen und der Antwortmail aus Seoul gewappnet nach Bonn, um uns diesem bürokratischen Ungetüm entgegen zu stellen.
Es war ja nicht so, dass wir mehrfach in diesem Büro, in genau dieser Botschaft in Bonn angerufen hätten, um Informationen einzuholen. Nein, wir betonten nicht unentwegt, dass wir uns für das Working Holiday-Visum interessieren. (Vorsicht, das war ironisch gemeint und meine Worte trieften hier vor Sarkasmus.) Jetzt erst, als wir vor dieser Sachbearbeiterin standen und auf die Internetseite sowie die Antwort des Auswärtigen Amtes verwiesen, begriff sie endlich, was wir von ihr wollten: Working Holiday-Visum. Nun bestätigte auch sie uns, dass wir zwölf Monate für die Einreise hatten. An diesem Punkt waren wir schon ein bisschen gereizt, doch solch niedere Gemütsschwankungen durfte man vor einem bürokratischen Feind nicht zeigen, insbesondere dann nicht wenn man etwas von ihm wollte. Also atmeten wir tief durch und nickten energisch.
Die nächste Überraschung folgte auf dem Fuße: Der Preis von 64€ traf nicht zu, stattdessen sollten wir 72€ für das Visum zahlen. An sich ist das immer noch keine große Sache, da andere Länder wesentlich mehr für ein Working Holiday-Visum nehmen (Australien ist beispielsweis mit ca. 300€ dabei), aber wenn man gerade nicht so viel Bargeld dabei hat, machen diese acht Euro Unterschied einiges aus. Mal davon abgesehen freue ich mich nie über Fehlinformation. Hier möchte ich auch anmerken, dass die Internetseite sich immer in Europreisen ausdrückte und nie von Won sprach, so dass ich mir über eventuelle Schwankungen im Wechselkurs keinerlei Gedanken machte. Ich ging davon aus, dass sie diesen feststehenden Betrag in Euro meinen. Die Neuseeländer hatten es begriffen, machten alle Angaben in Dollar und stellten dem einen ungefähren Eurowert gegenüber. Die Dame am Schalter klärte uns auch nie darüber auf, weshalb die Preiseangaben unterschiedlich waren.
Die Sachbearbeiterin warnte uns auch vor, dass die Bearbeitungszeit sich auf zwei bis drei Wochen ausdehnen würde, weil gerade sehr viele Anträge eingegangen wären. Noch immer von der einfachen Art der neuseeländischen Bearbeitung eingenommen, sahen wir darin nicht das geringste Problem. Sie bot uns sogar die Möglichkeit an, uns das Visum auf postalischem Weg zurückzuschicken, damit wir nicht noch einmal den Weg auf uns nehmen müssten. Das klang doch ganz vernünftig, wenn sie schon nicht mit dem Internet arbeiten wollten. Aber wir wurden schnell wieder daran erinnert, dass es sich um Südkoreaner handelte. Die Sachbearbeiterin wollte uns nicht das Visum per Post zukommen lassen, sondern unsere Pässe, in die das Visum eingeklebt werden würde. Wir stutzen. Wir sahen uns verdattert an, dann die Dame auf der anderen Seite des Schalters. Hatte sie uns soeben hinten herum mitgeteilt, dass wir unsere Pässe abgeben sollten? Hatte sie darüber hinaus tatsächlich erwartet, dass wir uns auf die Post verlassen würden, dass diese unsere Pässe sicher und fristgerecht bei uns abliefern würde, noch dazu ohne einen versicherten Brief per Einschreiben zu schicken? Ja, und ja.
Noch nie hatte uns irgendjemand dazu aufgefordert, unsere Reisepässe abzugeben, zumal es der einzige Ausweis war, den ich vorzeigen konnte. Die Skepsis wuchs, wir brachten unsere Zweifel und Sorgen zum Ausdruck, die Sachbearbeiterin blieb hart, wir wiesen auf Termine hin, bei denen wir den Pass brauchen würden (Internationaler Führerschein), sie wollte nicht einlenken, stattdessen verschränkte sie die Arme vor der Brust, wir sahen auf die Uhr und schlugen vor, dass wir es uns überlegen würden und nach der Mittagspause wiederkämen. Mit diesem Angebot war die Dame zufrieden und wir verabschiedeten uns – vorerst. Nach unserem Mittagessen riefen wir beim deutschen Auswärtigen Amt an, da wir naiven, Schengener-Abkommen gewöhnten Landeier noch nie unsere Pässe hatten abgeben müssen und Neuseeland keine solchen Forderungen gestellt hatte. Eine höflich klingende Dame am anderen Ende der Leitung meinte nur fröhlich, dass wir – also das deutsche Auswärtige Amt – es genauso handhaben würde, und sie lachte sogar auf, als ich meinte, dass von zwei bis drei Wochen die Rede gewesen war. Das wäre ja nichts, da müsse man sich nicht einmal die Mühe machen, einen Antrag auf vorübergehende Aushändigung des Passes zu stellen. Ich stutzte und fragte mich, wie lange die durchschnittliche Bearbeitungszeit in Deutschland war, ließ diese beunruhigende Frage allerdings unausgesprochen in meinen Gedanken schwirren.
Erstaunlicherweise beruhigte mich diese Information kein bisschen. Dennoch wollten wir nach Südkorea und dort nach Möglichkeit wenig Geld für Verpflegung und Unterkunft ausgeben. Es blieb uns also keine Wahl, als in den sauren Apfel zu beißen, geknickt zu lächeln und der Sachbearbeiterin im Konsulat mitzuteilen, dass wir das Visum gerne hätten. Allerdings bestanden wir darauf, dass wir wieder persönlich vorbeikommen würden, um die Dokumente abzuholen. Konsulat ist eine Sache, die Post eine andere.
Ich rechne es der Sachbearbeiterin sehr hoch an, dass sie die ganze Angelegenheit beschleunigte, als wir darauf hinwiesen, dass wir noch weitere Termine vor unserer Abreise hätten und den Pass dabei brauchen würden. Mal davon abgesehen brauchten wir die Pässe auch schneller zurück, weil wir bald fliegen würden.
Nachdem dies also geklärt war, ließen wir alle Unterlagen bei ihr und fuhren mit einem mulmigen Gefühl im Bauch wieder nach Hause.
Als die verabredete Frist verstrichen war, brach Franziska erneut nach Bonn auf, um unsere Ausweisdokumente abzuholen.
Tatsächlich verstand ich nicht, weshalb die Bearbeitung des Antrags so viel Zeit in Anspruch nehmen sollte. Die Sachbearbeiterin am Schalter prüfte alle Dokumente, die wir vorgelegt hatten, was sie einiges an Zeit kostete. Bei jeder Frage konnten wir ihr Auskunft erteilen, die Papiere waren vollständig und sie beschwerte sich nicht, dass irgendetwas fehlerhaft oder unzureichend wäre. Sie hätte genauso gut das Visum innerhalb einer Stunde ausstellen können. Aber gegen Bürokratie kommt man mit logischen Argumenten nicht an.
Den folgenden Abschnitt gebe ich so wider, wie er mir erzählt worden war, da ich bei den Ereignissen nicht zugegen sein konnte.
Als Franziska an besagtem Tag in der südkoreanischen Botschaft in Bonn frühzeitig eintrudelte, standen schon einige wartende Bürger vor dem Schalter. Ordnungsgemäß stellte sich meine Reisebegleitung hinten an, doch kaum dass die Sachbearbeiterin sie sah (es war dieselbe Dame wie bei unserem letzten Besuch), rief sie sie zu sich und verbannte die Anderen auf den letzten Platz der Warteschlange. Offensichtlich hatten wir einen bleibenden Eindruck hinterlassen – ich weiß noch nicht so ganz, ob uns das zum Vorteil gereichen würde. Die Dame nickte eifrig, zeigte stolz all die fertigen Dokumente, erzählte Franziska, dass sie ihrem Vorgesetzten die Papiere persönlich unter die Nase geschoben hatte und dabei zusah, wie er unterschrieb. Mit allen nötigen Materialen bewaffnet ließ sie Franziska glücklich aber baff gehen.
Fazit: Wer ein Working Holiday Visum für Südkorea will, sollte es mindestens sechs (6) Wochen im Vorfeld beantragen und sich auf etwaige Überraschungen gefasst machen. Man weiß nie, was einen tatsächlich erwartet.
Das Abenteuer Südkorea erreichte dann aber in Australien seinen Höhepunkt. Am Flughafen von Sydney gedachten wir nur unser Gepäck abzugeben und einzuchecken, doch entwickelte sich dieses Prozedere zum Labyrinth ohne Sinn und Verstand.
Wir legten unsere Koffer auf das Band, wie es so üblich ist, gaben unsere Pässe der Dame hinter dem Schalter und warteten auf unsere Bordkarten. Dann fragte sie uns, wann wir wieder aus Korea ausreisen würden. Wir stutzen, sahen uns verwirrt an und nannten ihr den ungefähren Zeitraum. Sie wollte die Buchungsbestätigung für unseren Flug AUS Korea sehen, während sie uns erklärte, dass sie (Australisches Lieschen Müller) sicherstellen musste, dass wir ein Ausreiseticket aus Korea hatten, weil sie uns sonst die Einreise verweigern würde. Um das noch einmal klar zu stellen: Die koreanischen Behörden hatten uns schon die Einreise genehmigt und uns ein Visum für den Aufenthalt ausgestellt, aber eine australische Schalterdame wollte uns die Einreise in ein fremdes Land verweigern.
Mit knirschenden Zähnen packten wir unser Ausreiseticket aus. Glücklicherweise hatten wir es, denn man braucht eins für das koreanische Visum, und ebenso froh waren wir, dass wir es ausgedruckt mit uns führten. Leider reisten wir nicht aus Seoul, der Stadt, in der wir ankommen würden, ab, sondern aus Busan, der zweitgrößten Stadt Südkoreas. Die Dame am Schalter wies uns darauf hin, dass sie das Abreiseticket aus Südkorea sehen wollte. Wir erklärten ihr, dass Busan in Korea lag. Sie meinte, wir müssten aus derselben Stadt ausreisen, in die wir eingereist waren. Wir guckten sie dämlich an. Sie warf einen Blick auf das Ticket und betonte noch einmal, dass es um die Reise aus Korea ging, nicht um die Einreise nach Japan. Wir pochten darauf, dass Busan in Korea lag. Um den Vorgang abzukürzen, verwiesen wir auf das Visum, das uns die Einreise bereits erlaubte. Sie verlangte es zu sehen, woraufhin wir auf unsere Pässe, die sie noch immer in der Hand hielt, verwiesen. Als sie die Visa gesehen hatte, meinte sie trocken, dass sie doch danach gefragt hatte. Es fiel mir in dem Moment schwer, ihr keine Beleidigung an den Kopf zu werfen. Stattdessen atmete ich einige Male tief durch, lächelte freundlich und checkte ein. Immerhin hatten wir einen Flug zu kriegen.
Aber damit war das australische Martyrium noch nicht beendet. Es stand uns eine Sicherheitskontrolle bevor, die es in sich hatte. Es begann damit, dass die Schlange so lang war, wie ich noch keine an einem Flughafen gesehen hatte. Das hieß für die australischen Behörden keineswegs, dass man noch einen weiteren Schalter für die Abfertigung geöffnet hätte. Als wir dann endlich in Sichtweite der Kontrollstellen kamen, pampte uns der Angestellte an, um uns zu sagen, in welche Reihe wir treten sollten. Mag sein, dass die Australier im Allgemeinen freundliche Leute sind, aber am Flughafen traf sich jeder Nörgler, Giftpilz und Schnauzer, den das Land beherbergte.
Bei dieser Gelegenheit wurden uns beiden zweifelhafte Ehren zuteil: Meine Wenigkeit durfte durch einen Ganzkörperscanner spazieren. Anscheinend habe ich das Gesicht dafür. Dieses Ereignis freut mich keinesfalls und ich weiß bis heute nicht, wie viele Details diese Variante dieses menschenunwürdigen Gerätes tatsächlich enthüllt. Human Rights Watch machte auf sich aufmerksam, dass man gegen diese Maßnahmen protestieren kann – was ich auch später tat. Franziska hingegen kam durch die normale Kontrolle, musste aber auf mich warten, weshalb ein anderer Sicherheitsbeamte sie ansprach. Sie wurde einer schnellen Sprengstoffkontrolle unterzogen. Man nahm einen Abstrich von ihren Sachen und begutachtete das Ergebnis. Es versprach ein interessanter Flug zu werden. Wir waren anscheinend keine Terroristen. Welch Glück, ich hatte schon Angst. (Wenn meine Leser doch bloß sehen könnten, wie weit ich hierbei die Augen verdrehen kann.)




Dieses Mal flogen wir mit Garuda Indonesia, einer indonesischen Fluggesellschaft, die Emirates Konkurrenz machen will. Der Service war top, die Flugbegleiterinnen trugen schicke Kostüme, das Essen war hervorragend, ebenso das Unterhaltungsprogramm und das Gesamtkonzept überzeugte deutlich. Leider bekamen wir auch dieses Mal keinen Direktflug, so dass wir eine Zwischenlandung in Jakarta einlegen mussten. Der Flughafen dort war überschaubar, obwohl es verschiedene Läden gab. Da das Leitungswasser keine Trinkwasserqualität besaß, es aber selbst zu später Stunde noch sehr warm und schwül war, so dass wir dringend mehr brauchten, musste ich zu meinem Bedauern ein bisschen indonesisches Geld besorgen. Besonders schön waren die Steckdosen, an denen man kostenlos seine elektrischen Geräte wieder aufladen konnte. Auch hier machten wir einige flüchtige Bekanntschaften und unterhielten uns mit Leuten aus aller Welt. Dennoch zog sich die Wartezeit. Endlich durften wir in den nächsten Flieger steigen, wo ich das einzig sinnvolle tat: schlafen. Nur zu den Mahlzeiten ließ ich mich wecken. Einen Punkt, den Emirates Garuda Indonesia voraus hat: Es gibt kleine Aufkleber, die man an die Sitz anheften kann, um den Flugbegleitern mitzuteilen, ob man zum Essen geweckt werden will oder nicht. Das ist eine wirklich hervorragende Erfindung.
Am Flughafen von Seoul angekommen, merkten wir nichts von der Epidemie, die in den deutschen Medien so breit dargestellt worden war, obwohl wir zu ihrem Höhepunkt einreisten. Es gab Wärmebildkameras am Ausgang, um Leute mit Fieber herauszufischen, ja, aber da war auch schon alles. Stattdessen amüsierten wir uns über die technischen Wunderleistungen, die es in Deutschland (und erst recht in Neuseeland) nicht gab, wie beispielsweise Wasserspender, die völlig ohne Berührung funktionierten. Sobald man nah genug an ihnen stand, gingen sie an. Ich bin mir fast sicher, dass wir mehr Zeit an diesen Geräten verbracht hätten, wenn wir nicht so müde gewesen wären.
Die Einreise war auch unspektakulär. Man prüfte unsere Pässe, unsere Visa und winkte uns durch. Im Gegensatz zu den anderen Flughäfen auf der bisherigen Reise wurde unser Handgepäck nicht noch einmal durchleuchtet, was mich positiv überraschte. Mittlerweile war es ein Novum. Die ersten Koreaner, denen wir begegneten, waren zudem so freundlich uns Atemschutzmasken anzubieten. Wir lehnten dankend ab. Von wegen ausverkauft.
Von unserem neuen Host hatten wir eine ziemlich genaue, wenn auch seltsame Wegbeschreibung bekommen. Es gab ein ausgeklügeltes U-Bahnsystem, das uns recht nah an die Herberge bringen würde, in der wir die nächsten Wochen verbringen sollten. So suchten wir nur kurz nach der Airport Railway Line, kauften schnell ein Ticket (es war eine Plastikkarte, auf die Pfand war, so dass man sie zurückgeben sollte, nachdem man die Strecke gefahren war) und saßen schon im Zug nach Hongdae. An der richtigen Haltestellte stiegen wir um, folgten den farbigen Schildern zur nächsten Bahn und fuhren zielsicher an unserer Endhaltestelle ein. Das ganze dauerte ungefähr 70 Minuten und kostete keine 4000 Won (weniger als 4€). Danach folgten wir einer kleinen Stadtkarte, auf der verschiedene Geschäfte vermerkt waren, aber keinerlei Straßennamen. Zu diesem Zeitpunkt wussten wir noch nicht, dass das in dieser 10-Millionen-Stadt gang und gäbe war.
Das Hostel, in dem wir untergekommen waren, trug den Namen Inno Hostel & Pub Lounge, lag recht zentral nur fünf Minuten zu Fuß von der Hapjeong Station entfernt und wurde wahrscheinlich von der Mafia betrieben. Dazu später mehr.

Jetzt, da ich darüber nachdenke, sind wir wohl den falschen Weg gegangen. Zuerst waren wir im Gefängnis, dann bei der Mafia.
Als erstes lernten wir den Manager dieses Etablissements kennen. Seinen koreanischen Namen nannte er uns nur einmal, denn er mochte seinen englischen Namen sehr gerne: Hulk. Hulk war ein lustiger Zeitgenosse und entgegen der Namensgebung nicht grün im Gesicht. Der Name rührte aus vergangenen Tagen, als er noch Bodybuilder war und erheblich mehr Brustumfang aufwies. Seitdem waren viele Jahreszeiten ins Land geflossen, so dass er „nur noch“ gut gebaut war. Er mochte seinen jetzigen Job und seine Kunden, die aus aller Herrenländer kamen. Es war erst drei Jahre her, dass er richtig mit dem Erwerb der englischen Sprache begonnen hatte, aber man konnte sich ziemlich gut mit ihm verständigen. Früher oder später verstand er schon, was wir von ihm wollten.
Gleich neben Hulk stand bei unserer Ankunft Amy. Die junge Koreanerin verdiente sich hier ihr Zimmer und Mahlzeiten, so wie wir, mit einigen Stunden Arbeit pro Tag. Zusätzlich hatte sie noch einen Abendjob, um tatsächlich ein bisschen Geld zur Seite legen zu können. Ihr Ziel war es nächstes Jahr das Studium zu beginnen. Obwohl sie die Schlafstatt neben uns einnahm, hatten wir recht wenig mit ihr zu tun. Jeden Tag zog sie aus, irgendetwas zu unternehmen, was hauptsächlich darin bestand sich mit Freunden zu treffen oder arbeiten zu gehen. Morgens war auch nicht viel Zeit mit ihr zu reden, da sie für gewöhnlich kurz vor Arbeitsbeginn aufstand und kurz nach Arbeitsbeginn auf der Arbeit eintrudelte. Während der Arbeit schien sie mit offenen Augen zu schlafen, was gar nicht so unüblich ist, wie wir im Laufe der Wochen lernten.
Draußen saßen noch Martin und Kenneth, die wir zu diesem Zeitpunkt nur flüchtig wahrnahmen. Hulk stellte sie uns als Besitzer der Herberge vor, doch bin ich mir bis heute nicht sicher, welche Position Martin tatsächlich in dieser Konstellation einnahm. Er war einfach da. Auf beide komme ich später noch zu sprechen.
Da wir gerade zu Beginn der Putzzeit eintrafen, war unser Zimmer noch nicht hergerichtet. Nach der langen Reise völlig fertig und alles andere als frisch war das ein kleiner Rückschlag, weil nichts ansprechender war als eine lauwarme Dusche und eine große Portion leckeren Essens. Auf beides mussten wir warten. Hier lohnt es sich noch zu erwähnen, dass wir im Hochsommer ankamen und dieser, im Gegensatz zu seinem deutschen Kollegen, durchaus diesen Namen verdiente.
Als wir dann endlich zu unserer ersten Mahlzeit in Seoul aufbrachen, mussten wir erst einmal ein Lokal finden, in dem gutes und gleichzeitig bezahlbares Essen serviert wurde. Hulk empfahl uns einen Gebäudekomplex mit der Bezeichnung Mecenatpolis Mall. Gleichzeitig erklärte er uns den Weg dorthin, wobei dieser nicht schwierig war, weil wir bei unserer Ankunft in Hapjeong bereits daran vorbeigegangen waren. Außerdem ist das Gebäude so groß, dass es schon fast selbstverständlich als Landmarke der Region dient.


So stiefelten wir los unsere Mahlzeit zu suchen – und fanden heraus, dass man hier ganz schnell verloren gehen kann. Die Mall fanden wir problemlos, aber das Angebot, das sie einem bot, war erschlagend. Es gab einen ganzen Flügel, der nur aus Restaurants bestand. Dann fand man dort noch Cafés, Bekleidungsgeschäfte, Friseure, Banken, Tiergeschäfte, Drogerien und vieles mehr. Eingebettet waren diese Läden in eine gepflegte Gebäudelandschaft, die mit künstlichen Blumen geschmückt, mit bunten Lichtern bestrahlt, mit zahlreichen Schirmen abgedeckt und mit drahtigen Skulpturen aufgelockert wurde.



Ich war hin und her gerissen zwischen staunen und hungern. Dies war wirklich nicht der richtige Moment mich mit neuen, faszinierenden und sehenswerten Dingen zu konfrontieren. Es war nur ein kurzes Gefecht, aber der Hunger siegte deutlich, wobei er einen Dämpfer einstecken musste, denn wir mussten uns in diesem Komplex erst einmal zurechtfinden und ein für unsere Wünsche geeignetes Restaurant aussuchen.
Endlich fanden wir eine Lokalität, die nicht McDonald's hieß. (Ja, es gab in der Mecenatpolis Mall auch einen McD.) Unsere Wahl fiel auf ein Currylokal, CoCo Curry, das diese würzige Speise in verschiedenen Variationen anbot und dazu einen großen Haufen Reis servierte. Als Gast bestimmte man, wie groß die Reisportion sein sollte, wie scharf das Curry war und woraus das Curry bestand. Es war klasse und schmackhaft zugleich. Allerdings brauchten wir die Hilfe einer Kellnerin, die – glücklicherweise – Englisch sprach, weil wir mit der doch sehr koreanischen Speisekarte überfordert waren. Letzten Endes klappte alles reibungslos, wir bekamen unser Essen und zogen glücklich wieder ab. Zu diesem Zeitpunkt wussten wir noch nicht, wie glücklich wir uns schätzen mussten, dass die Kellnerin tatsächlich der englischen Sprache mächtig war. Uns standen noch weitere Begegnungen bevor, die weniger glimpflich ablaufen würden.
Praktischerweise war es in Korea üblich ein Bild oder sogar eine plastische Darstellung von den Gerichten vorgesetzt zu bekommen, die in diesem Restaurant angeboten wurden. So konnten wir uns im schlimmsten Fall immer noch mit Händen und Füßen verständigen. Verhungern war keinesfalls möglich.
Als wir nach diesem ersten Abenteuer wieder im Hostel ankamen, erfuhren wir, dass ein zweites auf uns wartete: unsere Koffer auf unser Zimmer bringen. Im Erdgeschoss befanden sich nur die Bar, Lounge und Bäder. Zuerst mussten wir eine recht steile Treppe in den ersten Stock hinauf gehen, gefolgt von einer normalen Treppe in den zweiten. Schließlich führte uns eine spektakuläre Treppe auf das Dach, auf dem ein Taubenschlag für Angestellte bereitstand.

An dieser Stelle möchte ich hervorheben, dass Hulk, ganz gut erzogener und kundenorientierter Gentleman, uns mehrfach angeboten hatte, die Rucksäcke an unserer statt hochzutragen. Wir lehnten es nur höflich ab, weil wir es uns zur Regel gemacht hatten, dass wir nur das mitnahmen, was wir auch tragen konnten – ungeachtet der Umstände.
Im Taubenschlag begrüßten uns (ungefähr) kuschelige neun Quadratmeter inklusive Badezimmer. Es gab ein Hochbett, Garderobe sowie Nachttisch, wobei wir letzteren wegen mangelhafter Bauweise vor die Tür verbannten. Zwar hatten wir drinnen nicht sonderlich viel Platz, dafür genossen wir draußen ein ganzes Dach für uns. Es erlaubte uns eine völlig neue Perspektive, die Seoul in einem neuen Glanz erscheinen ließ. Obwohl wir definitiv nicht mehr Platz als zu viert in Franz Josef hatten, fühlte ich mich dennoch nicht so eingeengt. Vielleicht hatte die lange Reise meine Perspektive verändert – vielleicht war es auch nur eine subjektive Wahrnehmung, die schon den ersten Hinweis auf meine Beziehung zu dieser Stadt geben sollte – vielleicht war ich einfach nur zu müde, um zu meckern.

Es gefiel mir, dass die Schiebefenster nicht nur doppeltverglast, sondern auch doppelt vorhanden waren und durch ein integriertes Fliegengitter abgeschlossen wurden. Da hatte jemand mitgedacht. Noch besser gefiel mir allerdings meine neue beste Freundin. Wir einigten uns auf den Namen Theodora und sie war eine Klimaanlage. Bei meiner Erfahrung mit Dachwohnungen hätte ich es sonst nicht überlebt. In Südkorea war es aber selbstverständlich Räume zu klimatisieren, ungeachtet dessen ob es sich um öffentliche Räume, U-Bahnen, Restaurants oder Wohnungen handelte. Alte Gebäude wurden nachgerüstet; bei neuen war die Klimaanlage oft schon in der Decke mit eingebaut. So konnte man auch einen tropischen Sommer ertragen.
Tatsächlich erzählte Hulk uns aber, dass der ständige Wechsel von kalt zu warm vielen Leuten zu schaffen machte und zu sommerlichen Erkältungen führte.
Ich schweife ab.
In unserem Badezimmer gab es kein Waschbecken. Stattdessen musste man sich hinhocken oder bücken, um an den Wasserhahn zu kommen. Dabei musste man allerdings darauf achten, dass er richtig eingestellt war, weil man anderenfalls eine ungewollte Dusche hätte nehmen können, was überhaupt nicht abwegig war.
Wir hatten die Frage des Abendessens noch nicht geklärt, weshalb wir wieder in die brütende Hitze hinauszogen, um mir ein günstiges Mahl zu suchen. Auf dem Weg zum Hostel waren wir an einigen kleinen Supermärkten vorbeigekommen und hofften dort fündig zu werden. Es gab tatsächlich etwas, das den Geldbeutel nicht zu sehr sprengte, aber zu dem Zeitpunkt hatte ich noch keine Ahnung von koreanischen Finanzmitteln.
Bei unserer Ankunft zurück im Hostel lernten wir dann auch noch Yuri kenne, die nachmittags und abends an der Rezeption arbeitete. Sie war freundlich und höflich, hatte mit uns aber sehr wenig zu tun. Kurze Zeit nach unserer Ankunft verließ sie das Inno Hostel dann auch.
Nach diesem nicht enden wollenden Tag mit viel zu hohen Temperaturen fiel ich wie ein Stein ins Bett und wachte nicht allzu früh auf.
Hulk bat uns um 11 Uhr zur Arbeit einzutreffen, was wir nach deutscher Pünktlichkeit als 10:55 Uhr interpretierten.
Am nächsten Morgen erklärte Amy uns dann in aller Ruhe und mit mehr Taten als Worten, wie unsere zukünftigen Aufgaben vonstattengehen würden. Wir fingen unten in den Bädern an.
Common Sense Stuff. Mülleimer leeren, Oberflächen mit feuchten Reinigungstüchern abwischen, Spiegel putzen, Toiletten mit einer Chemikalie aus der lila Flasche einsprühen und mit einer Bürste abschrubben und das gleiche mit den Duschen. Das Lustige war aber, wie man die Chemikalien wieder von den Toiletten und aus der Dusche entfernte: Es gab einen langen, grünen Wasserschlauch, den man voll aufdrehte und zielgerichtet auf das gesäuberte Inventar richtete, um es dann gehörig abzubrausen. Jetzt ergab es einen Sinn, warum sie uns Badelatschen zur Verfügung stellten. Ich hielt es auf einmal auch für äußerst durchdacht, extra Badelatschen nur für das Bad anzubieten, auch wenn man zu Hause war. Wir setzten das ganze Badezimmer unter Wasser und es war genauso beabsichtigt. Mitten im Flur war ein Abfluss. Mit Musik von Rammstein im Ohr war das Bild komplett.
Die Betten zu machen war auch keine allzu große mentale Herausforderung: gebrauchte Bettlaken und Kissenbezüge abziehen, Matratze mit einer Fusselrolle abziehen, dicke Bettdecken mit Febrez einsprühen, Decken ordentlich falten und mit Kissen sowie frischen Laken garnieren.
Dann gab es im ersten Stock noch eine kleine Küche, die geputzt werden musste. Diese hatte allerdings, meiner bescheidenen Meinung nach, schon viel zu lange keinen ordentlichen Schwamm mehr gesehen. Ich machte es mir zur Lebensaufgabe, diesen Teil des Hostels in neuem Glanz erstrahlen zu lassen – und wies Hulk erst einmal darauf hin, dass der Kühlschrank vollkommen ausgemistet werden müsste. Er machte es mir einfach, indem er einen neuen bestellte. Das war meine Rettung.
Zum Thema Staubsaugen muss ich wohl kein Wort verlieren.
Ich fand es sehr praktisch, dass jede Etage mit eigenen Putzzeug und -gerät ausgestattet war, so dass mehrere Leute parallel arbeiten konnten und man nicht alles drei Stockwerke rauf und runter tragen musste.
In Zimmern mit eigenem Bad galt es am Ende nur noch an die Handtücher zu denken und schon war man durch.
Amys freie Tage waren am Wochenende, so dass wir uns je einen freien Tag in der Woche aussuchen durften. Leider konnten wir ihn nicht gemeinsam nehmen, weil sonst zu wenige Leute zum Aufräumen da gewesen wären. Aber auch so arrangierten wir uns sehr gut.
Außerdem dauerte die Arbeit selten so lange, dass wir nachmittags keine Zeit mehr für Sehenswürdigkeiten gehabt hätten.
Am ersten Wochenende erwartet uns beim Frühstück eine Überraschung. Da stand ein junger Mann hinter dem Tresen, den wir noch nicht kannten. Er kannte uns dementsprechend auch nicht. Wir stellten uns ihm vor, er nannte uns den Namen June und ließ uns glücklicherweise hinter die Theke, damit wir unser Frühstück machen konnten. Immerhin wollte ich Pfannkuchen machen und da verstehe ich keinen Spaß.
June war ein angenehmer Zeitgenosse. Er war ruhig und sprach genug Englisch, um sich mit uns ein wenig zu unterhalten.
Wir fragten uns so langsam, wie viele Mitarbeiter dieser Betrieb hatte. Kurzerhand erklärten wir das Inno Hostel zu einer Mafiahochburg und vergaben eifrig Rollen.
Da war „der Boss“, den man nur selten zu Gesicht bekam und dessen Namen wir so richtig erst irgendwann am Ende erfuhren. Er knüpfte die Kontakte – nach Japan. Er brachte neue Verkaufsideen mit – Tarnung der tatsächlichen Operation. Er redete kaum mit uns – wahrscheinlich besser so. Trotzdem machten wir uns einen Reim auf seine Person: Vom obersten Oberboss in Busan wurde er nach Seoul geschickt, um neue Leute anzuwerben und den langen Arm der Mafia ins politische Zentrum zu bringen, damit die Organisation dort ihr unheimliches Unwesen treiben konnte. Am Anfang baute man noch auf alteingesessene Mitarbeiter aus der Heimat, doch bald schon würde man die Seouler überzeugen können. Es war nur eine Frage der Zeit. Doch „der Boss“ hatte alles gut im Griff und sein Fünf-Jahres-Plan befand sich gerade in Phase 2.
Welche Rolle genau Martin in diesem Gebilde einnahm, bleibt uns bis heute ein Rätsel. Er half manchmal aus, wenn Hulk seinen freien Tag hatte, er kochte für uns, er liebte es gesellige Abende zu veranstalten. Gleichzeitig war er schüchtern und still. Vielleicht war das aber nur reine Fassade. Immerhin hatte er die breitesten Schultern und war alles andere als klein. Wir machten jedenfalls einen Geldeintreiber und Schläger aus ihm, indem wir sein ganzes Gehabe für eine raffinierte Tarnung erklärten.
Hulk, als Manager fast ununterbrochen im Hostel anwesend (er stammte übrigens aus Busan), fiel die Aufgabe zu den ganzen Haufen zu koordinieren und das Geschäft am Laufen zu halten. Immerhin stellte er das Gesicht und Aushängeschild des Scheinunternehmens dar. Er war sehr gut mit Gästen, sprach genügend Englisch, um sich verständigen zu können – mehr als die Touristeninformation in Hongdae jedenfalls – und war ein atypischer Koreaner. Sehr offen und kontaktfreudig. Er war von morgens bis abends da, wobei er zwischendurch Pausen fürs Schlafen machte. In der Zeit übernahm seine Frau das Geschäft. Darüber hinaus fiel ihm die Aufgabe zu, Neulinge auszubilden und in die Familie einzugliedern. Immerhin war das ein strikt unterteiltes Unternehmen, in dem jeder seinen Platz kennen und lieben musste. Um den Plan des Bosses weiter voran zu treiben, hatte er eine Einheimische geheiratet.
Seol Hee, Hulks Ehefrau, gebürtige Seoulerin, war super. Sie war lustig, freundlich, offen und für viele Späße zu haben. Wahrscheinlich sollte sie die ganze Gasthausgeschichte glaubhafter machen und nach außen hin verkaufen. In diesem Bestreben interessierte sie sich sehr dafür, was wir unternahmen, wohin wir gingen und womit wir uns beschäftigten. Aber so manches Mal machte sie ihren Mitarbeitern sowie ihrem Mann deutlich, wo sie stand, wo die anderen standen und dass sie nicht nur lieb konnte. Das war gruselig. Vielleicht wollte sie auch nur auskundschaften, ob wir die Pläne schon durchschaut hatten oder ob wir irgendwie in die tatsächliche Organisation eingegliedert werden könnten. Wir werden es nie erfahren.
Am Wochenende kam immer wieder June vorbei, den wir aufgrund seiner ruhigen Art sowie seines gepflegten Äußeren zum Buchhalter erklärten. Mit seiner Brille wirkte der junge Mann so, als könne er gut mit Zahlen umgehen. Außerdem strahlte er Zuverlässigkeit aus.
Amy hingegen war ein tückischer Fall. Sie stammte aus Busan, integrierte sich aber nicht in das ganze Gefüge, sondern setzte ihren eigenen Kurs durch. Daher erklärten wir sie zur Tochter des Oberbosses in Busan, die aus Sicherheitsgründen nach Seoul geschickt worden war, um dort vom Manager an die Hand genommen zu werden. Sie musste aber so tun, als würde sie nicht dazu gehören, um die ganze Operation nicht zu verraten oder die Organisation in Gefahr zu bringen. Immerhin durfte niemand wissen, wer sie tatsächlich war.
Bisher weiß keiner von den oben aufgeführten, welche Rollen wir ihnen andichteten. Bisher hatten wir auch nicht das Bedürfnis unser Glück aufs Spiel zu setzen. Wer weiß, was für Geister wir aus den Tiefen der Unwissenheit rufen könnten.
Ungeachtet unseres Working Holiday Visums waren wir letzten Endes doch Touristen und gedachten uns wie solche zu benehmen. Also brachen wir immer wieder in diese riesige Stadt auf, um uns verschiedene Sehenswürdigkeiten anzusehen. Gewappnet mit Fotoapparat, Metroplan und Stadtkarte zogen wir in verschiedene Teile dieser Metropole. In Anbetracht der sommerlichen und stellenweise tropischen Wetterbedingungen war das nicht immer ein einfaches Unterfangen, doch wollten wir unsere Zeit bestmöglich nutzen.
Seoul ist eine sehr laute Stadt. Bei der Konzentration von Menschen auf geringem Raum überrascht das wenig, doch es gibt schon einige Unterschiede zu Deutschland. Vor allem die zahlreichen Einkaufsstraßen haben Lärmquellen, die es bei uns schlichtweg nicht gibt: Geschäfte posaunten ihre Musik auf die Straße heraus; Leute schrien einem irgendwelche Angebote entgegen (die ich allerdings nicht verstand). Ich kam mir stellenweise wie auf einem Jahrmarkt vor. „Hereinspaziert, hereinspaziert, nur hier gibt es die besten Angebote. Bitte nehmen Sie diesen Flyer mit, damit Sie auch all unsere Angebote wahrnehmen.“ Auch in den Geschäften herrschte reges Treiben. Stellenweise war die Musik nicht nur eine Begleiterscheinung, die den Kunden im Hintergrund zu weiteren Käufen animierte, sondern diskoreife Lautstärken erreichte. Hinzu gesellten sich Verkäufer, die diesen Lärm mit ihrer Stimme oder einem Mikrofon samt Lautsprechern zu übertönen suchten, um die Kunden entweder zu begrüßen und zu verabschieden oder ihnen die aktuellen Angebote um die Ohren zu knallen.
Erstaunlich war nur, dass man nichts von diesem Trubel mitbekam, sobald man sich von diesen Straßen entfernte. Wir wohnten recht zentral, nur fünf Minuten zu Fuß von der nächsten Metro-Haltestelle, doch es war still dort. Ebenso wenig war der Straßenverkehr laut. Es gab viele Autos, ja, aber kaum jemand hupte. Bei den abenteuerlichen Verkehrsbedingungen, die ich hier beobachtete, wäre es in Deutschland zu Unfällen, Hupkonzerten und Schimpftriaden ohne gleichen gekommen. Aber in Seoul nahmen die Leute es gelassen hin, dass ein Taxi am Straßenrand parkte, dass die Kreuzung von einem quer stehenden Bus blockiert wurde, dass der Motorradfahrer sich zwischen den Autos hindurchschlängelte. Ab und zu hupte mal jemand, wenn es nun wirklich gar kein Durchkommen gab, doch das war schon alles. Stellenweise hatte ich den Eindruck, dass die Koreaner von Australiern ihren Führerschein bekamen, doch erst nachdem sie verinnerlicht hatten, was gemeint ist, wenn jemand „Dude, relax“ („Alter, entspann dich.“) sagt. So gelassen war der australische Verkehr nie gewesen. Es war schlichtweg bizarr.
In einer Informationsbroschüre, die wir in der Touristeninformation Hongdae ergattert hatten (wir mussten uns selbst durch die Regale lesen, weil die Damen hinter dem Schalter so gut wie gar kein Englisch konnten), gab es verschiedene Tourvorschläge und Sehenswürdigkeiten.
Noch ein Wort zu dieser Touristeninfo: Anstatt uns bei unserem ersten Besuch mit ausreichenden Informationen bezüglich Sehenswürdigkeiten, Preisen, Broschüren und dergleichen zu versehen, bekamen wir einen Fragebogen zögerlich in die Hand geschoben. Man sah den Damen sichtlich an, wie unangenehm es ihnen war nicht mit uns kommunizieren zu können, aber sie schafften es sich verständlich zu machen. Sie baten uns darum, dieses Formular auszufüllen. Das Thema: MERS.
In Deutschland kursierten zu dieser Zeit schreckenerregende Geschichten zu dieser Krankheit. So war – laut deutschen Medien – Südkorea kurz davor zu einem Katastrophengebiet erklärt zu werden. Schutzmasken, Desinfektionsmittel und Handschuhe waren schon gar nicht mehr käuflich zu erwerben, weil verschreckte Koreaner Hamsterkäufe getätigt hatten und die Lieferungen ins Stocken gerieten. Mehr und mehr Ansteckungen sowie Todesfälle waren täglich zu verzeichnen. Hier stand eine Gesellschaft kurz vor dem Zusammenbruch. Es fehlte nur ein Streichholz, das das Pulverfass zum Explodieren brachte. Das war ungefähr der Ton, der in Deutschland angeschlagen wurde.
Bei unserer Ankunft in dem ostasiatischen Land merkten wir allerdings nichts davon. Die Leute waren so gelassen, wie die Menschen in Franz Josef, die immer noch auf ihrer Verwerfungslinie sitzen. Ja, es gab einige Ansteckungen und Todesfälle, aber die Regierung unternahm alles in ihrer Macht stehende, um die Krankheit einzudämmen. Dabei wäre es kaum nötig gewesen, weil alle gemeldeten Fälle im engen Familienkreis stattfanden oder von Leuten verursacht wurden, die sich im Nahen Osten aufgehalten hatten. Überall an öffentlichen Orten konnte man Schutzmasken und Desinfektionsmittel kostenlos bekommen. Es wurde in zahlreichen Medien unmissverständlich und sprachenübergreifend klar gemacht, wie man sich zu verhalten hatte, damit die Krankheit zu keiner Seuche wurde. Wir nahmen die ganze Angelegenheit nicht sonderlich ernst, zumal Ebola noch kurz vorher ein wesentlich schlimmeres Ausmaß angenommen hatte, ohne dass man auch nur halb so viel Panik verbreitet hatte. Mein Vertrauen in die deutsche Nachrichtenübermittlung schwand.
Wie dem auch sei. Letzten Endes füllten wir den Fragebogen nach bestem Wissen und Gewissen aus, gaben ihn an die verschüchterten Damen zurück und erhielten als Bonus ein abgepacktes Küchelchen. Das nenne ich einen tollen Handel. Zwar hatten wir keine sinnvollen Informationen erhalten, dafür aber gutes Essen.
Gwanghwamun Square und Gyeongbokgun Palast
Wir besuchten Gwanghwamun Square und Umgebung. Dies war eine große Straße mit breiter Fußgängerzone in der Mitte, die direkt auf den Gyeongbokgung Palast hinzu führte. Links und rechts waren noch zwei schöne Bächlein mit Jahreszahlen drin, die den Fluss der Zeit seit Gründung Koreas symbolisieren sollten.

Die erste Statue stellte einen berühmten Admiral, Yi Sun-Shin, dar, während die zweite, größere einen bedeutenden Herrscher Koreas verewigte. In der Mitte thronte er, der ehemaligen König Sejong, der u.a. dafür berühmt ist das koreanische Alphabet entwickelt zu haben, während man im Hintergrund den Palast vor einer Berglandschaft bewundern konnte.

Unser Besuch war zeitlich genau mit dem Wachwechsel vor dem Gyeongbokgun Palast abgestimmt, so dass wir genug Zeit hatten, die Männer in ihren bunten Gewändern zu bestaunen, bevor sie dann von anderen Männern in den gleichen Gewändern abgelöst wurden. Unter dem riesigen Eingangstor zog sich das ganze Prozedere natürlich zeremoniell hin. Die Wachen nahmen Aufstellung, gingen eine bestimmte Runde ab, standen sich gegenüber, Siegel wurden begutachtet, um die Authentizität zu prüfen, Ausrüstungsgegenstände und Aufmachung wurden geprüft, bis schließlich jeder zufrieden war und man den Wechsel vollziehen konnte. Dann standen die Männer wieder reglos auf ihren Positionen. Untermalt wurde das Ganze von einigen Instrumenten, allem voran Trommeln, die den Takt vorgaben.

Kaum war das Spektakel vorbei, begaben wir uns zielgerichtet Richtung Ticketverkauf, wo wir 3000 Won zahlten, was umgerechnet weniger als 3 Euro waren, wofür uns ein riesiges Areal mit zahlreichen Gebäuden zur Verfügung gestellt wurde. Das war ein Preis, bei dem selbst Studenten problemlos Kultur genießen konnten.
So spazierten wir gelassen durch weitläufige Anlagen mit alten Gebäuden, die zwar nur Rekonstruktionen vergangener Herrlichkeit waren, aber durch die detailgetreue Wiedererrichtung nichts an Stil verloren hatten. Auch wenn alles einen typisch asiatischen Stil hatte, waren doch Unterschiede zu japanischen oder chinesischen Häusern dieser Epochen zu erkennen, wenn man darauf achtete. Die Bauart, Farbgestaltung und der Häuseraufbau hatten doch etwas Koreanisches an sich. Umgeben wurden die zahlreichen Häuser von großen Grünflächen, die sehr schlicht gehalten wurden. Keine komplizierten Gärten, sondern simple Strukturen beherrschten hier das Bild. Selbstverständlich kam man um den einen oder anderen künstlich angelegten Teich nicht herum, denn die Verwendung verschiedener Elemente gehört zum grundlegenden Konzept asiatischen Denkens. Obwohl die Gärten nicht so aufwändig wie ihre japanischen Pendants gehalten wurden, waren sie schön anzusehen und luden zum Flanieren ein. Dies war wahrscheinlich mit ein Grund, warum wir uns alle Zeit der Welt ließen.

Im Zentrum der Anlage stand ein prachtvoller Bau, der nicht nur durch seine Größe, sondern auch durch sein Gesamterscheinungsbild Staunen erregte. Schlicht war hier nicht angesagt, ganz im Gegenteil. Immerhin war es der Palast eines Kaisers, da war es mit Bescheidenheit nicht getan. Prunkvoll erhob sich der rote Thron in einem bunt bemalten Raum, dessen Decke man in der Finsternis des zweiten Stockwerks suchen konnte. Gestützt wurde das Ganze von zahlreichen roten Säulen – alles aus Holz. Goldene Drachen wanden sich hoch über den Köpfen der Palastbesucher ineinander. Allgemein war es sehr farbenfroh.

Nicht weniger Kreativität legten die Koreaner bei den anderen Gebäuden an den Tag. Selbst wenn ein Raum innen nur weiß verkleidet war, gab es immer wieder auflockernde Elemente in Form von Kissen oder Möbeln, um bloß nicht langweilig zu wirken.

Zwar gab es nicht die Möglichkeit viele der Gebäude zu betreten, aber es war dennoch schön aufgebaut. Dadurch dass man die Wände hochklappen konnte, bekamen die Besucher einen hervorragenden Einblick in die Wohnwelt vergangener Zeiten. Ja, man klappte die Wände hoch. Schiebetüren gab es auch, allerdings waren sie eher im Inneren der Gebäude gebräuchlich.

Dafür fanden wir viele Mäuerchen vor, die verschiedene Häuser oder Komplexteile voneinander abgrenzten. Auf diese Art entstanden Gässchen, in denen man sich gut und gerne verlaufen konnte. Überhaupt war die Anlage sehr verwinkelt gebaut, so dass es uns sehr viel Spaß machte jede Ecke auszukundschaften.
Unsere Wanderung über das Palastgelände unterbrachen wir für eine Pause im Inneren. Die brütende Hitze wirkte sich zusehends auf unsere Gemüter aus, zumal es nur wenige schattige Stellen gab. Neben der Tempelanlage gab es das National Folk Museum of Korea. Natürlich hatten wir an diese Tag keine Zeit es uns auch noch anzusehen, aber unten im Gebäude gab es eine kleine Caféteria mit Eisstand. Davon abgesehen war es die einzige Möglichkeit mal wieder klimatisierte Luft um uns zu haben. Dies waren die einzigen Gründe für uns, das Museum zu betreten. Nach der Pause ging es weiter im Palast.
Als man uns nach drei Stunden Wanderung mithilfe von Lautsprecherdurchsagen dazu aufforderte, das Gelände zu verlassen, weil der Palast nun geschlossen werden würde, hatten wir noch immer nicht alles gesehen. Dennoch blieb uns nichts anderes übrig, als uns langsam, gemächlich zum Ausgang zu begeben. Der Palastkomplex war einfach nur gewaltig. Außerdem hatten wir uns mit der Besichtigung jede Menge Zeit gelassen. Es war ein toller und lohnenswerter Ausflug.
Auf dem Rückweg gingen wir noch ein Stück weiter die breite Promenade hinunter und fanden einige Zelte sowie Tafeln mit Fotografien von leeren Zimmern vor. Da wir nicht genug Koreanisch verstanden, um den Sinn zu verstehen, gingen wir weiter, bis wir von einer Dame aufgehalten wurden. Sie sprach ziemlich gut Englisch, so dass sie uns erklären konnte, worum es ging. Letztes Jahr hatte ein Fährunglück vor Südkorea für Schlagzeilen auf der ganzen Welt gesorgt. Dabei waren rund 300 Menschen ums Leben gekommen, darunter viele Schüler. Obwohl es Prozesse gab und Leute verurteilt worden waren, war das Unglück bis heute nicht aufgeklärt, so dass viele Leute nicht wussten, was ihren Angehörigen zugestoßen war. Die Fähre war nicht geborgen worden, es gab noch immer zahlreiche Vermisste, weshalb die Familien keine Ruhe fanden. Mit einer Unterschriftenaktion wollten die Veranstalter dieser Aktion die Regierung dazu zwingen, den Vorfall weiter zu untersuchen und – vor allem – die Ergebnisse der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Man bat uns um unsere Unterschrift, die wir bereitwillig leisteten. Im Gegenzug erhielten wir eine kleine, gelbe Schleife, die wir als Zeichen der Solidarität irgendwo befestigen durften.
An der Haltestellte begrüßte uns zum ersten Mal ein Haechi. Haechi ist eine mystische Figur, die wie ein geflügelter Löwe mit Schuppen aussieht und Seoul als Schutzpatron dient. Mittlerweile ist es ein Symbol Seouls und steht überall rum. Leider fanden wir keine Souvenirs von diesem putzigen Tierchen.

Sonntag war Hulks freier Tag. Das war schön für ihn, einerseits. Denn andererseits machte er sich immer Sorgen, was die zwei Jungs, June und Martin, sonntags so anstellen würden. Sie räumten nicht vernünftig genug für seine Ansprüche auf, behauptete er. Jeden Montag beschwerte er sich darüber, dass er sich sonntags Sorgen machte, wie es wohl montags aussehen würde. Er kam zu dem Schluss, dass es am besten wäre, keinen freien Tag zu haben. Doch seine Frau hatte Einwände. Wir übrigens auch, denn wir wollten unseren Boss nicht verstimmt und knartischig erleben, bloß weil er keinen einzigen Tag in der Woche ausschlafen und ausspannen konnte. Ungeachtet des tatsächlichen Zustandes von Küche und Lounge machte Hulk jeden Montag eine Grundsanierung der Räumlichkeiten. Ich gelangte zu dem Schluss, dass es ums Prinzip ging. So schlimm waren die Jungs nämlich nicht immer.
Wir hatten die Ehre, an einen ganz besonderen Tag in Hulks Leben dabei zu sein. Schon Tage vorher kündigte er uns an, dass sein kleiner Bruder ihn endlich mal wieder besuchen würde. Er war aufgeregt wie ein kleines Kind, das sich auf Geburtstagsgeschenke freute und die Stunden bis zum Auspacken zählte. Natürlich musste er alles vorbereiten und natürlich musste es perfekt sein. Es passiert nicht jeden Tag, dass der Bruder, den man seit Monaten nicht gesehen hat, einen besucht.
Wir nahmen es gelassen zur Kenntnis und freuten uns drauf, seinen Bruder kennen zu lernen. Als er dann eintraf, waren wir aber sichtlich verwirrt. Wir erwarteten jemanden, der Hulk auch nur entfernt ähnlich sah, doch dem war nicht so. Sein kleiner Bruder war entschieden größer als er. Na gut, das kann in Familien vorkommen. Sein Bruder war aber auch entschieden blonder als er. Nein, die Haare waren nicht gefärbt. Vor allem war sein Bruder aber Tscheche. Wir waren äußerst verunsichert. Honza, der uns als kleiner Bruder von Hulk vorgestellt wurde, würde in einem europäischen Kontext wohl mit „bester Freund“ tituliert werden. In Korea sind Familien- und Freundschaftsverhältnisse aber ganz anders gestrickt, was wir bei einer anderen Gelegenheit deutlich zu spüren bekamen. Aber dazu später mehr. Jedenfalls war es für unseren Gastgeber selbstverständlich, seinen jungen, tschechischen Freund als seinen Bruder vorzustellen und ihn genauso zu behandeln. Und wenn man einmal Teil einer koreanischen Familie geworden ist, gibt es kein Entrinnen mehr – wie bei der eigenen Familie auch. Mitgefangen, mitgehangen, inklusive aller Rechte und Pflichten.
Ab dem Zeitpunkt, an dem Honza im Hostel ankam, war die Welt drum herum für Hulk vergessen. Er konzentrierte sich vollends auf seinen kleinen Bruder und machte alles in seiner Macht stehende, um ihm die Zeit so angenehm wie möglich zu gestalten. Das endete meist darin, dass sie sich vor die Konsole setzten und Videospiele spielten, während Seol Hee die Rezeption übernahm. Nur bei äußersten Notfällen handwerklicher Art durfte diese intime Beziehung gestört werden.
Eines Tages, nachdem das Tagwerk bereits verrichtet war, kam Hulk zu uns wartenden Helfern und stellte uns einen neuen Mitarbeiter vor. Er sprach hauptsächlich mit Amy und hauptsächlich auf Koreanisch, so dass ich bei vielen Dingen einfach nur nett lächelnd nickte und mich darauf verließ, eine Erklärung von Franziska zu bekommen oder Amy später darauf ansprechen zu können. Auf diese Weise lernten wir, dass der junge Mann Jae Won hieß und nun der Jüngste im Bunde war. Er sah auch sehr jung aus, was uns vor eine geistige Herausforderung stellte, weil er zu viel hinter sich hatte, um das Alter zu haben, das wir an ihm vermuteten. Erst wesentlich später erfuhren wir, dass er „bereits“ zweiundzwanzig Jahre zählte – nach internationaler Zählweise.
Im Laufe der kommenden Wochen lernten wir noch viel mehr über Jae Won, allerdings dauerte es bei ihm einige Zeit, bis er auftaute. Als er eines Morgens beim Frühstück Hulk eine lebhafte Geschichte erzählte, dabei lachte und gestikulierte, fragten wir uns tatsächlich, ob jemand den Jungen ausgetauscht hatte. Solch ein Verhalten kannten wir bis dahin gar nicht von ihm. Es stellte sich allerdings heraus, dass er nur gewartet hatte, bis er sein Naturell offen zur Schau tragen durfte. Alles in allem war Jae Won nämlich ein Sonnenschein, der grinsend durch das Leben rannte – und mit jedem Mädel im Hostel flirtete.
Wir taten uns nicht schwer damit, ihm eine Rolle in unserem Mafiagefüge zu geben: Er war der Azubi, der vom Manager lernen sollte, wie man ein Hostel führt, um für die Expansion des Unternehmens benutzt werden zu können. Diese Theorie mussten wir aber noch einmal überdenken, als Jae Won nach einer Mahlzeit alles Geschirr abräumte und meinte, er wäre doch der Cleaner. Demonstrativ schrie er noch sein putziges „I kill you“ in den Raum, während er die Stäbchen in die Überreste rammte. Sollte er nun doch Martin unterstützen oder ihm Konkurrenz machen?
Mit Jae Won taucht ein anderer junger Mann auf, den wir überhaupt nicht einzuordnen wussten. Er machte nichts im Hostel, sprach Hulk aber mit Boss an und war bei jedem Mittagessen dabei. Sein Name war Jae Woo. Die Sache mit der Mafia schien in Anbetracht seiner Person immer wahrscheinlicher, also erklärten wir ihn aufgrund seiner Statur zum Schläger. (Tatsächlich war er ein ganz lieber Bursche.) Sein plötzliches Verschwinden zusammen mit Hulks Aussage „He's gone.“ („Er ist weg.“ oder „Er ist tot.“) machten die ganze Situation nicht besser. Vor allem die Art, wie Hulk diese zwei Worte aussprach, war beängstigend: traurig, bestimmt und endgültig. Aber es gab Dinge, über die wir nicht Bescheid wissen wollten.
Nach langen Wochen der Ungewissheit tauchte Jae Woo dann wieder auf. Schon Tage vorher hatte man uns angekündigt, dass er wieder im Inno Hostel eintreffen würde, doch wir hielten es für ein Gerücht, das erst bewiesen werden musste. Er blieb für einige Tage und ging wieder, dieses Mal mit einem gebührenden Abschied. Als wir dann fragten, wo er eigentlich war, sagte man uns trocken: „Im Krankenhaus.“ Staunen, Verwirrung, Verständnislosigkeit, all das brachten wir nonverbal zum Ausdruck, um dann die Entwarnung zu bekommen. Es war nur eine routinemäßige Untersuchung, ob er denn völlig gesund war.
Ich gewann langsam den Eindruck, dass die Leute das absichtlich mit uns machten.
Cheonggyecheon
Es ergab sich für uns mehrfach die Gelegenheit am Cheonggyecheon, einem künstlich angelegten, sehr schön gestalteten Wasserlauf im Zentrum Seouls entlang zu spazieren. Cheonggyecheon war eine wirkliche Augenweide. Da gab es eine breite Promenade links und rechts vom Flüsschen, die oft ihr Äußeres änderte, aber immer wohl gepflegt war. Mal gab es nur einen schönen Pfad aus Stein, mal zierten große Pflanzen den Wegesrand. Dazwischen floss immer das klare Wasser in einem sich ständig wandelnden Flussbett. Manchmal wand der Bach sich in symmetrischen Kurven durch das Zentrum der Stadt, während er anderenorts durch künstliche Engen zu einem reißenden Strom gezwungen wurde. Es gab verschiedene Brücken, mit deren Hilfe man ihn überqueren konnte. Für gesetzte Besucher fanden sich einfache Überwege; für verwegene Abenteurer ragten einige Steine gerade mal so aus dem Wasser. Es fanden sich immer Besucher am Wasser, die sich auch nicht scheuten darin knietief zu waten oder die Füße zu benetzen.

Als wir eines Tages zufällig wieder am Flussufer standen und uns orientieren wollten, tauchte plötzlich ein kleines Mädchen neben uns auf. Ganz unverfroren sprach es uns in sehr gutem Englisch an und plapperte drauf los, als wäre es ganz selbstverständlich – wie die Neuseeländer. Es stellte uns viele Fragen, versäumte es aber, sich uns vorzustellen. Nach einigen Sätzen, bei denen seine Mutter ihm einige Fragen diktierte, fragte es freundlich nach einem Foto und unseren Kontaktdaten. Wir tauschten sie bereitwillig aus, weil das Gör wirklich knuffig war. Zugegebenermaßen war ich sehr verwirrt, ein bisschen baff sogar, was nicht nur an seinen Englischkenntnissen, sondern auch an seiner offenen Art lag. Auf diese Weise lernten wir Anneena kennen. Sie sollte eine entscheidende Rolle im weiteren Verlauf unseres Aufenthaltes – und weiteren Lebens – spielen. Dazu später mehr.
Eigentlich wollten wir an diesem Tag schon wieder den Heimweg antreten, aber wir wurden von einem Schauspiel ganz unerwarteter Art aufgehalten, das sich gleich an die Begegnung mit Anneena anschloss.
Oberhalb des Cheonggyecheon, am Anfang des Wasserlaufs, befand sich ein großer Platz. Als wir darüber gingen, sahen wir viele leere Stühle, vor denen einige Instrumente lehnten. Eine Dame drückte uns einen Flyer in die Hand. Es stellte sich heraus, dass das Korean Traditional Music Orchestra an diesem Abend eine spontane Freilichtdarbietung aufführte. Wir entschieden uns dafür, uns dieses Spektakel anzuhören. Eine gute Wahl.
Was uns erwartete war eine Stunde vollen hingerissenen Staunens. Insgesamt wurden fünf Stücke gespielt, von denen eines locker 15 Minuten lang sein konnte. Bei zweien davon gab es je einen anderen Solisten an einem traditionellen, koreanischen Instrument. Um niemandem auf die Füße zu treten, unterlasse ich es hier irgendetwas benennen zu wollen.

Auch wenn diese Lieder hier keine Live-Aufnahmen dessen sind, was wir gesehen haben, demonstrieren sie deutlich, was uns geboten wurde. Da ich davon überzeugt bin, dass Worte nicht ausreichen es zu beschreiben, bin ich froh, dass youtube Aufnahmen mit hervorragender Qualität bietet.
https://www.youtube.com/watch?v=_2Gg0UOeuVU
https://www.youtube.com/watch?v=2HfIrDYb_44
Trotzdem werde ich meine Eindrücke hier in kurze Worte fassen.
Der Anfang eines Stücks ließ nie darauf schließen, wie es beendet werden würde. Ruhige Klänge steigerten sich oftmals in ein Crescendo hinein, nur um wieder ruhig zu verklingen. Es war eine gekonnte Mischung aus traditionell östlichen Melodien mit modernen, westlichen Elementen. Die Instrumente aus verschiedenen Ländern der Welt trugen ihren Teil dazu bei. Ebenso war das Tempo nicht konstant, sondern sehr abwechslungsreich. Es bereitete mir großes Vergnügen, diesem musikalischen Flickenteppich zuzuhören.
Allerdings gebe ich zu, dass es für europäische Ohren oftmals gewöhnungsbedürftig war.
Jongmyo Schrein
Der Jongmyo Schrein liegt ebenfalls im Palastviertel und bietet eine weitere Möglichkeit für traditionelle Bauarten Koreas zu bewundern. Seit zwanzig Jahren UNESCO Weltkulturerbe, werden in dem Schrein bis heute Gedenkfeiern für die Könige und Königinnen der Joseon Dynastie abgehalten. Da die Geister der Vorfahren in Korea eine wichtige Rolle einnehmen, gibt es einen speziellen Pfad für sie, der breit und offensichtlich in der Mitte ist. Als wir dort waren, fanden sich aber einige Besucher vor, die diese Tradition nicht so ernst nahmen. Natürlich waren es Ausländer – in diesem Fall Chinesen.

Wir begannen unsere Tour durch den Schrein mit dem Besuch eines klimatisierten Raums, in dem ein kurzer Film zur Geschichte des Ortes gezeigt wurde. Anstelle von Stühlen fand man Rückenlehnen mit Sitzpolstern auf dem Boden vor, so dass man sich schon gemütlich hinsetzen konnte, nur eben auf dem Boden. In dem kurzen Beitrag lernten wir, dass hinter jeder Tür ein Herrscher seine Ruhe fand und bei Feierlichkeiten eine Prozession jeden einzelnen Herrscher sowie seine Familie aufsuchte, um Opfergaben darzubringen. Bei der Anzahl der Türen, also Würdenträger, dauerte das ganze Spektakel einen ganzen Tag.

Wie jedes Ritual war auch dieses strikt durchorganisiert und hatte seine festen Abläufe sowie Symboliken. Selbstverständlich konnte ich mir nicht alles merken, was uns präsentiert wurde, zumal ich keine buddhistischen Wurzeln habe und das meiste für mich nur reine Informationen ohne persönlichen Bezug waren. Dennoch möchte ich erwähnen, dass diese Gedenkfeier äußerst kompliziert klang.
Zu diesem Anlass wurde auch traditionelle koreanische Windmusik gespielt, die seit 2001 ebenfalls zum UNESCO Weltkulturerbe gezählt wird. Da dieses Ereignis im Mai stattfindet, hatten wir nicht das Vergnügen es live zu betrachten. Die Aufzeichnung, die wir im kurzen Film sahen, vermittelte aber einen guten ersten Einblick.
Auch im Jongmyo Schrein hatte die rote Farbe sehr viel Einsatz gefunden, so dass man sich stellenweise fast schon erschlagen fühlte. Allerdings wirkten die steinernen Höfe um die Bauten herum sehr kalt und neutral, wodurch der Eindruck schon wieder aufgehoben wurde.

An demselben Tag gingen wir noch in den Tapgol Park, der nur einige Minuten zu Fuß vom Jongmyo Schrein entfernt liegt. Bei der Gelegenheit kamen wir auch an der Juwelenstraße vorbei, einer Hauptverkehrsstraße, auf der sich zahllose Juwelierläden aneinanderreihen. Es glitzerte und funkelte uns von allen Seiten an, doch glücklicherweise hat man als Backpacker nicht genügend Ressourcen, um auch nur annähernd in Versuchung geführt zu werden. Wir ignorierten die Kostbarkeiten um uns herum und zogen weiter zum Park.
Auch der Tapgol Park hatte historischen Wert. Es war genau dort, als 1919 die Unabhängigkeitsbewegung ihren Anfang nahm und ihren Protest gegen die japanische Besetzung kundtat, indem sie unter anderem die Unabhängigkeit Koreas ausrief. Zum Gedenken standen dort heute eine Tafel sowie einige Statuen protestierender Leute.

Doch schon davor war es ein wichtiger Ort, da früher ein buddhistischer Tempel dort gebaut worden war. Die Pagode, die noch übrig ist, zählt zu den Nationalen Schätzen Koreas und ist heute hinter Glas, um vor den Witterungsbedingungen geschützt zu sein. Darüber hinaus fanden wir im Park einen Pavillon sowie eine Stele, die die Gründung des (nunmehr nicht vorhandenen) Tempels bezeugte.
Wir gingen ebenfalls zu Bosingak Belfry, einer riesigen Glocke, die zur Joseon Ära die Zeit läutete. Leider durfte man das Grundstück nicht betreten und sah die Glocke gar nicht. Das versetzte meiner Wanderlust einen Dämpfer. Da es gerade eh zu regnen begonnen hatte, machte es uns wenig aus. Wir suchten die nächstbeste Metro-Haltestelle und fuhren zurück ins Hostel.
Als nächstes stellte Hulk eine weitere Helferin ein, die uns bei der Putzroutine unter die Arme greifen sollte. Ihr westlicher Name war Beverly, doch sie stammte aus China. In diesem Moment waren wir uns sicher, dass Hulk sich zu viele Sorgen um uns machte. Vereinbart waren bis zu drei Stunden Arbeit am Tag, doch mit vier bis fünf Leuten, die täglich drei Stockwerke in Schuss hielten, kamen wir selten über eineinhalb Stunden hinaus.
Beverly war ein nettes Mädel, das gerade ihr Studium aufgenommen hatte und die Pause zwischen den Semestern dazu nutzte ein bisschen durch Korea zu reisen. Sie war freundlich und lustig, so dass wir immer wieder schöne Sachen miteinander erlebten. Allerdings wussten wir anfangs nichts mit ihr anzufangen, weil jeder seine Routine hatte und sie mehr oder weniger tatenlos daneben stand. Wir einigten uns aber auf ein neues Protokoll, so dass es nach einigen Tagen glatt lief. Da sie nicht koreanisch war, gehörte sie ebenso wenig zur Mafia wie wir.
Das letzte Mitglied in unserer Arbeitsgemeinde kam wenige Wochen vor unserer Abreise an. Eines Morgens stolperte ich noch halb verschlafen in die Lounge und wurde fast umgerannt. Ein kniehoher Hund beschnüffelte mich aufgeregt und rannte von einem Ende der Lounge zum anderen. Hulk stellte ihn als Inno vor. Er gehörte jetzt auch zur Familie – zu DER Familie. Noch war er nicht ausgewachsen, aber viel würde da nicht mehr kommen. Inno war ein sehr gut erzogener Welpe, der sich hervorragend darauf verstand Gäste um den Finger zu wickeln. Es gab genau zwei Arten von Leuten: Entweder sie liebten Inno oder sie hatten Angst vor ihm. Letzteres traf vor allem auf Chinesen zu. Auch Beverly brauchte ihre Zeit, um mit ihm warm zu werden und zuckte immer wieder ängstlich zusammen, wenn er sich in ihrer Nähe aufhielt und bewegte. Als sie ihre Angst dann aber überwunden hatte, klebte sie förmlich an dem Kleinen. Wie es aber nun mit Welpen so ist, versuchte er immer wieder seine Position in der Gemeinschaft herauszufordern und einen besseren Platz einzunehmen. Viele Leute ließen dies mit sich machen.
Besonders lustig war es, wie Martin und Jae Won sich Inno gegenüber aufführten. Sie knuddelten, streichelten ihn, spielten mit ihm, gingen mit ihm Gassi, aber beide behaupteten steif und fest, dass sie das neue Familienmitglied nicht mochten. Wir erfuhren nie, warum.

tbc...
... link (0 Kommentare) ... comment
Mittwoch, 16. September 2015
JAMBINAI - Düsseldorf – September 2015
atimos, 16:34h
Es folgt ein Sondereintrag, den ich auch nur aus dem Grund an dieser Stelle poste, weil er etwas mit Timing zu tun hat.

Durch unerwartete Umstände ergab sich für mich die Gelegenheit ein Konzert zu besuchen, von dessen Aufführung ich vorher nicht einmal geahnt hatte. Die koreanische Band Jambinai hatte anlässlich des Düsseldorf Festivals ihre Deutschlandpremiere im Theaterzelt auf dem Burgplatz. Möglichst unvoreingenommen, was aufgrund der Tatsache, dass ich mich mit diesem Ensemble überhaupt nicht auseinandergesetzt hatte, sehr einfach war, ging ich also an besagtem Abend hin und ließ mich... berieseln. Dieser Ausdruck trifft den Musikstil allerdings nicht so ganz.
Was Jambinai präsentierte, war eine Mischung aus verschiedenen Musikrichtungen, Klängen, Melodien, Instrumenten, Techniken. Ob psychedelisch, klassich, rockig, es war alles dabei. Die Künstler schafften es, diese verschiedenen Richtungen in mehreren Songs zu kombinieren und immer wieder für Überraschungen zu sorgen.
Es begann mit drei Musikern, die langsam und (relativ) leise ihre Instrumente zupften oder schlugen. Doch schon bald entwickelten sich schnellere und lautere Tonfolgen, die Überhand nahmen und das Publikum in ihren Bann rissen. Spätestens nachdem Schlagzeuger und Bassist das Trio ergänzten, ging es laut daher. Wer behauptet, dass man mit klassichen Instrumenten keine modernen Musikstile spielen kann, versteht sein Handwerk nicht – oder ist nur ein Banause. Gestützt wurde das ganze durch elektronische Hilfen, die zudem für schöne Wawas und lustige Loops sorgten.
Leider muss ich an dieser Stelle zugeben, dass es manchmal doch ein bisschen zu laut war. Dieses Klangvolumen war für das kleine Zelt dann doch zu viel. Ich hatte fast schon den Eindruck, dass man damit die ESPRIT Arena hätte füllen können, was aber nur auf Spekulationen beruht.

Wie dem auch sei. Es spielte keine Rolle, ob die Band einen fast schon unmerklichen Übergang zwischen verschiedenen Musikgenres vornahm oder den Stil urplötzlich änderte, von laut zu leise, von melodisch zu rockig, von schnell zu langsam oder umgekehrt wechselte. Alles war dabei. Die anfänglichen Töne waren kein Garant für den stetigen Fortlauf eines Liedes.
An diesem Abend lernte ich, dass Headbangen in jeder Kultur hervorragend amüsant aussieht und man es sogar mit koreanisch modernem Kurzhaarschnitt hinbekommt. Untermalt wurde das Konzert von einem bunten Lichtspiel, das die Stimmung der Lieder passend hervorhob.

Alles in allem gefiel mir der Abend sehr gut und trug positiv zu meiner Stimmung bei. Ich empfehle die Band jedenfalls weiter. Wer sich einen Eindruck von Jambinai verschaffen möchte, kann dies unter folgenden Links gerne machen:
https://www.youtube.com/watch?v=56dv3XHUISY
https://www.youtube.com/watch?v=hyQoJj94Blw
Das Funkhaus Europa strahlt das Konzert zudem aus. Diesbezüglich erhielt ich allerdings widersprüchliche Informationen, so dass ich mal beide Termine durchgebe. Zuerst sagte man an, es solle am 1.10. um 23:00 Uhr gespielt werden, auf Anfrage nannte man mir dann aber den 20.
Viel Spaß dabei.

Durch unerwartete Umstände ergab sich für mich die Gelegenheit ein Konzert zu besuchen, von dessen Aufführung ich vorher nicht einmal geahnt hatte. Die koreanische Band Jambinai hatte anlässlich des Düsseldorf Festivals ihre Deutschlandpremiere im Theaterzelt auf dem Burgplatz. Möglichst unvoreingenommen, was aufgrund der Tatsache, dass ich mich mit diesem Ensemble überhaupt nicht auseinandergesetzt hatte, sehr einfach war, ging ich also an besagtem Abend hin und ließ mich... berieseln. Dieser Ausdruck trifft den Musikstil allerdings nicht so ganz.
Was Jambinai präsentierte, war eine Mischung aus verschiedenen Musikrichtungen, Klängen, Melodien, Instrumenten, Techniken. Ob psychedelisch, klassich, rockig, es war alles dabei. Die Künstler schafften es, diese verschiedenen Richtungen in mehreren Songs zu kombinieren und immer wieder für Überraschungen zu sorgen.
Es begann mit drei Musikern, die langsam und (relativ) leise ihre Instrumente zupften oder schlugen. Doch schon bald entwickelten sich schnellere und lautere Tonfolgen, die Überhand nahmen und das Publikum in ihren Bann rissen. Spätestens nachdem Schlagzeuger und Bassist das Trio ergänzten, ging es laut daher. Wer behauptet, dass man mit klassichen Instrumenten keine modernen Musikstile spielen kann, versteht sein Handwerk nicht – oder ist nur ein Banause. Gestützt wurde das ganze durch elektronische Hilfen, die zudem für schöne Wawas und lustige Loops sorgten.
Leider muss ich an dieser Stelle zugeben, dass es manchmal doch ein bisschen zu laut war. Dieses Klangvolumen war für das kleine Zelt dann doch zu viel. Ich hatte fast schon den Eindruck, dass man damit die ESPRIT Arena hätte füllen können, was aber nur auf Spekulationen beruht.

Wie dem auch sei. Es spielte keine Rolle, ob die Band einen fast schon unmerklichen Übergang zwischen verschiedenen Musikgenres vornahm oder den Stil urplötzlich änderte, von laut zu leise, von melodisch zu rockig, von schnell zu langsam oder umgekehrt wechselte. Alles war dabei. Die anfänglichen Töne waren kein Garant für den stetigen Fortlauf eines Liedes.
An diesem Abend lernte ich, dass Headbangen in jeder Kultur hervorragend amüsant aussieht und man es sogar mit koreanisch modernem Kurzhaarschnitt hinbekommt. Untermalt wurde das Konzert von einem bunten Lichtspiel, das die Stimmung der Lieder passend hervorhob.

Alles in allem gefiel mir der Abend sehr gut und trug positiv zu meiner Stimmung bei. Ich empfehle die Band jedenfalls weiter. Wer sich einen Eindruck von Jambinai verschaffen möchte, kann dies unter folgenden Links gerne machen:
https://www.youtube.com/watch?v=56dv3XHUISY
https://www.youtube.com/watch?v=hyQoJj94Blw
Das Funkhaus Europa strahlt das Konzert zudem aus. Diesbezüglich erhielt ich allerdings widersprüchliche Informationen, so dass ich mal beide Termine durchgebe. Zuerst sagte man an, es solle am 1.10. um 23:00 Uhr gespielt werden, auf Anfrage nannte man mir dann aber den 20.
Viel Spaß dabei.
... link (0 Kommentare) ... comment
Sonntag, 23. August 2015
Sydney – Juni 2015
atimos, 03:23h
Kurz vor knapp kamen wir wieder zurück zum Hostel, griffen unsere Rucksäcke, schnappten uns unseren temporären Reisegefährten, Patrick, aus Deutschland und warteten eher ungeduldig auf den versprochenen Shuttlebus. In der Zwischenzeit schaffte ich es alles umzupacken, zu sortieren, ein Stück Zitronenkuchen zu kaufen, es zu halbieren, meine Hälfte zu essen, das Messer zu spülen, noch etwas zu trinken und mich noch ein bisschen nervös zu machen. Egal, wie oft ich fliegen, wenn ich noch nicht am Flughafen bin, werde ich hibbelig. Es könnte noch so viel schief gehen.
Das Shuttle kam früher als geplant, lud alle Leute ein, fuhr noch zu einer anderen Unterkunft, um Gäste einzuladen, und es ging weiter zum Internationalen Flughafen von Christchurch. Dort kamen wir auch zeitig an, verabschiedeten uns von Patrick (nur, um ihn einige Minuten später an der Sicherheitskontrolle wiederzusehen) und checkten ein. Alles lief problemlos, so dass wir kurze Zeit später durch den (winzigen) Duty Free Shop schlenderten und uns über die horenden Preise wunderten.
Endlich war unser Flug bereit zum Boarding und wir nahmen unsere Plätze an Bord einer Boing 777-300 von Emirates Airlines ein. Start und Anfang des Fluges waren recht turbulent, doch das legte sich mit der Zeit. Ich vertrieb mir die Reise mit dem Film „Kingsman“, der allerdings nur mäßig unterhaltsam war. Dessen ungeachtet möchte ich an dieser Stelle keine ausführliche Kritik üben.
Bei diesem Flug fiel uns eine Stewardess auf, die sich durch schlechte Laune sowie patziges Benehmen in den Mittelpunkt drängte. Wir waren ein wenig überrascht, schließlich war dies ein Flug von Emirates. Glücklicherweise hatten wir nur wenig mit ihr zu tun.
Um den Service dieser noblen Fluggesellschaft zu testen, bestellte ich mir ein lactosefreies Menü. Es war gut; insbesondere der Nachtisch schmeckte mir.
Gerade als mein Film sein Ende gefunden hatte, setzten wir zur Landung an – zwanzig Minuten früher als geplant. Zuvor hatten wir einige Dokumente bekommen, die wir vor der Einreise ausfüllen mussten. Da auch darauf gefragt wurde, ob wir Dreck an den Schuhen hatten, blieb uns nichts anders übrig, als zu bejahen. Natürlich machte uns dies einige Sorgen, weil wir schon befürchteten, dass uns etwas abhanden kommen könnte – Schuhe beispielsweise. Doch die Einreise war ebenso einfach wie nach Neuseeland. Man besah sich unsere Schuhe, fragte, ob die im Koffer sauber waren, und winkte uns durch. Ich frage mich langsam, ob man als Deutscher einen Freibrief für diverse Länder besitzt, ohne es zu wissen. Sie wollten nicht einmal das Visum sehen. Dabei war es so eine Tortur, es zu bekommen. Das war nur ein Scherz.
Tatsächlich muss man selbst ein Touristenvisum für Australien beantragen. Praktischerweise geht das nur noch online und, wenn man Einwohner Deutschlands ist, geht es auch verdammt schnell. Eine Stunde nach Beantragung hatte ich schon die Zusage: Ich durfte innerhalb des nächsten Jahres bis zu drei Monate in Australien verbringen, um Fotos zu knipsen. Und es hatte mich nichts gekostet.
Ursprünglich hatten wir geplant auch in Sydney eine Gastfamilie zu finden und so unsere Kosten niedrig zu halten. Nachdem wir erfahren hatten, dass es mit einem Touristenvisum völlig legal ist, war es schon fast selbstverständlich. Da sowohl Einreise- als auch Abreisetermin feststanden, nahmen wir schon früh Kontakt zu potenziellen Gastgebern auf. Wir fanden auch eine interessierte Familie und wähnten uns sicher, bis wir einige Tage vor der geplanten Ankunft nach der Adresse fragten und zur Antwort bekamen, dass die Familie gerade jemand anderen hatten. Schnell suchten wir uns eine Herberge für die Dauer unseres Aufenthalts und kamen so in den Genuss von Eva's Backpackers – inklusive einem kostenlosen Shuttleservice vom Flughafen zur Unterkunft. Wir mussten nur ein bestimmtes Formular einem bestimmten Herren zeigen und schon brachte er uns zum richtigen Bussteig.
Es war der erste Australier, mit dem wir Kontakt hatten, und ich war königlich amüsiert. Er erinnerte mich an Hammy aus „Ab durch die Hecke“: aufgedreht, schnell, redselig. Mit riesigen Schritten stapfte er zielgerichtet voran, wobei er ohne Unterlass plapperte. Innerhalb weniger Minuten erfuhren wir alles über sein Alter, seinen Familienstand, seine bisherigen Reisen, Verwandten und noch mehr. Zudem bestätigte er jedes Klischee, das ich über sprachliche Eigenarten des australischen Dialektes kenne. Schon von Beginn an, ja im ersten Satz, ging er zu „mate“ über. So viel Spaß es uns auch machte ihn zu beobachten und mit ihm zu plauschen, sein Zeitverständnis war von einem anderen Stern. Statt der angekündigten fünfzehn Minuten warteten wir über eine halbe Stunde, bis der Shuttlebus ankam.
Als dieser Kleintransporter mit Gepäckanhänger dann endlich vorfuhr, verlagerte sich unsere Sorge vom Begrüßungskommitee zum Fahrer. Wir befürchteten ernsthaft, dass dieser Mann uns hinter dem Steuer mit einem Herzinfarkt zusammenbrechen könnte, und ich fragte mich für einen Lidschlag, ob er beim ersten Weltkrieg in Gallipoli gewesen war. Als wir dann endlich losfuhren, spielte unser Fahrer klassische Musik, was der ganzen Szene einen abstrakten Anstrich gab. Glücklicherweise war das Fahrzeug entschieden jünger als sein Fahrer.
Endlich in Eva's Backpackers angekommen checkten wir provisorisch ein, bezogen unsere Betten und gaben uns der Nachtruhe hin. Immerhin beträgt die Zeitverschiebung Neuseeland-Australien zwei Stunden, also war es schon ein sehr langer Tag gewesen. Außerdem hatte ich lange nicht mehr ein so sicheres Hostel gesehen. Es gab Türcodes und Sicherheitsschlüssel, womit Fremden der Zugang sichtlich erschwert wurde. Eine Bekanntschaft machten wir an diesem Abend noch. Es war eine Deutsche. Der zweite Gast, mit dem wir Kontakt hatten, war Sam, ein Engländer, der von Korea nach Sydney geflogen war. Er gab uns zahlreiche Tipps und Hinweise für unseren bevorstehenden Aufenthalt in dem ostasiatischen Land.
Wir hatten eine lange Liste mit Sehenswürdigkeiten, die uns teils durch öffentliche Werbemaßnahmen der Stadt, teils durch Mundpropaganda zu Ohren gekommen waren. Allerdings war unser Aufenthalt begrenzt, weshalb wir jeden Tag möglichst zum Bersten ausfüllten.
Wieder erhielten wir kostenlose Stadtkarten, Reiseführer, Broschüren und Rabattgutscheine. All das half uns bei der weiteren Planung sowie Durchführung unserer Reise. Schon der erste Spaziergang überzeugte. Sydney war schön. In der Stadt fand sich alles, was ein metropolitisches Herz begehrte, wobei es nicht an Auflockerungen durch Bäume, Grünflächen und Parklandschaften mangelte. Aber auch ein gewisser Charme kam sehr deutlich zum Vorschein. Breite Gehwege sorgten dafür, dass die kärglich tröpfelnden Menschenströme des Winters gemütlich Platz fanden. Im Sommer ist es wahrscheinlich entschieden voller. Die Beschilderung half jedem sich zurecht zu finden. Es war alles sehr sauber und gepflegt. Alte Gebäude im Kolonialstil, gesäumt von Palmen, standen neben modernen Bauten aus Glas, gingen teils sogar gekonnt ineinander über. Natürlich fanden sich dazwischen einige klägliche Beleidigungen der 1970er Jahre; das Problem hat wahrscheinlich jede Stadt, die mit Zement umzugehen weiß. Die Skyline, mit unzähligen Wolkenkratzern, die von Banken und bekannten Firmen beheimatet wurden, verdiente ihren Namen zurecht. Auch wenn die Gebäude alle in die Höhe ragten, hatten sie wesentliche Unterscheidungsmerkmale, so dass dem Auge viel Abwechslung geboten wurde.

Es versteht sich von selbst, dass wir die Oper aufsuchten, um dieses einzigartig Gebäude mit seiner faszinierenden Architektur zu bewundern. Allerdings folgten wir dabei einem vorgegebenen Pfad, der uns an diversen Sehenswürdigkeiten im Zentrum der Stadt vorbeiführte. Krönender Abschluss war die Oper. Dieses Bauwerk übte auf mich eine ungemeine Faszination aus. Entgegen meiner Erwartungen war es aber nicht schneeweiß, sondern mit verschiedenen kleinen Fliesen in Weiß und Beige (vorwiegend letzteres) bedeckt. Ich fand es nicht nur sehr schön, sondern obendrein beeindruckend. Außerdem war es viel größer als erwartet. Eine wohlgepflegte Promenade führte um die Oper herum, wodurch man sie aus allen möglichen Winkeln betrachten konnte. Auch von der Harbour Bridge war eine ungetrübte Aussicht auf diese riesige Muschelansammlung möglich. Zu unserem Bedauern erfuhren wir, dass wir leider einen Tag zu spät für das Lichtspiel „Vivid Sydney“ angereist waren, bei dem die Oper abends von außen mit verschiedenfarbigen Scheinwerfern bestrahlt wurde und in ganz neuem Glanz erstrahlte. Das nennt man dann Pech. Sie ist auch so sehr schön.



Bei der Gelegenheit ließen wir es uns natürlich nicht nehmen einfach mal einen Blick ins Innere des Gebäudes zu werfen. Die Eingangshalle war ebenfalls stilistisch einwandfrei, wodurch wir befanden, dass uns ein rundum gelungenes Konzept präsentiert wurde. Äußerst zufriedenstellend. Für ein Konzert reichte meine Reisekasse dieses Mal allerdings nicht, so dass ich nichts über die Akustik oder den Aufbau des Konzertsaals sagen kann.
Das zweite Wahrzeichen Sydneys, die Harbour Bridge, war nicht so weit von der Oper entfernt, als dass man einen Spaziergang dorthin scheuen sollte. Tatsächlich konnte man sehr gute Fotos mit beiden Motiven gleichzeitig schießen. Also brachen wir zur Brücke auf und sahen auf diese Weise noch einige interessante Teile von der Stadt. Um von der Oper zur Harbour Bridge zu gelangen, konnte man durch den alten Stadtteil Sydney, genannt The Rocks, gehen. Genau dies machten wir auch, aber dazu später mehr.

Als wir endlich eine Möglichkeit fanden, als Fußgänger auf die Brücke zu gelangen, kraxelten wir die unzähligen Stufen hoch, nur um festzustellen, dass noch mehr Treppen auf uns warteten. Endlich waren wir auf dem Fußgängerpfad, der einem riesigen Käfig glich. Wir gingen fast bis zum anderen Ende der Brücke, schossen immer wieder einige Fotos und gingen dann zurück. Ich fand die Aussicht hervorragend und die Tatsache so hoch über dem Boden zu sein spannend.
Zurück ging es wieder durch The Rocks, einen Stadtteil, der sich durch niedrige Bauten stark von der Skyline des Hafenviertels abhob. Die Häuser waren urig, stellenweise noch Originale aus Siedlerzeiten, es gab viele Cafés, Bars, Gaststätten und dergleichen. Wir beschlossen ohne Stadtkarte nur mit einer groben Richtung ausgestattet durch die Straßen zu irren, um die Umgebung auf uns wirken zu lassen, und fanden bei der Gelegenheit ein Haus, das gehegt und gepflegt wurde, um die Lebensbedingungen von vor 150 Jahren darzustellen. Es war ein einfacher Tante Emma-Laden, den man kostenlos betreten durfte. Auf den Regalen standen Kolonialwaren, Lebensmittel (natürlich nicht echt) und Dosen; Kasse und Waage waren noch aus alten Tagen. Es war wirklich schön gemacht. Nicht weit davon war ein – kostenpflichtiges – Museum, das wir allerdings aussparten.
Bei einer weiteren Runde durch The Rocks fanden wir – wieder einmal zufällig – ein kostenloses Museum unter dem Titel Discovery Museum, das die Geschichte des Viertels erzählte. Wir lernten einiges über die Besiedlung, Entwicklung und Umgestaltung der Nachbarschaft, aber auch über den Kampf der Einheimischen, die dafür sorgten, dass The Rocks so erhalten blieb, wie die Touristen es heute vorfinden. Erstaunlich war, dass wir hier auch etwas über die Geschichte der Maori fanden. Vom technischen Standpunkt aus betrachtet waren die Vitrinen ein Highlight: Ein Bildschirm hinter dem Glas lieferte Informationen zu Ausstellungsstücken. Sensoren oben und unten an der Vitrine maßen die Bewegungen der Besucher, so dass man den Bildschirm immer noch wie einen Touchscreen bedienen konnte, obwohl man ihn nicht berührte, sondern nur das leere Vitrinenglas.
Wir spazierten durch den Hyde Park und durch den Royal Botanic Garden. Das allein dauerte schon einige Stunden, da diese Parklandschaften einen enormen Teil der Innenstadt einnahmen. Beide waren sehr gut angelegt, ordentlich und auf jeden Fall sehenswert.
Man erkannte deutliche Unterscheide zwischen Park und Garten, die über die Größe hinausgingen. Im Park fanden sich oft geometrische Formen, was sowohl im Aufbau der Wege als auch in der Bepflanzung sichtbar wurde. Hier gab es Blumenbeete, dort eine Allee, Laternen am Wegesrand, dazwischen Rasen. Zwischendurch gab es noch einige Steinbauten – Pavillons, Brunnen, Statuen. (Ja, die Australier erkannten den Nutzen von Stein als Bauelement und verbauen ihn nun in ihren Gebäuden.)
Der Garten hingegen zeigte wenig Symmetrie, hatte dafür aber eine reiche Beschilderung, was die Pflanzenwelt betraf. Auch hier wurde das didaktische Ambiente durch zufällig eingeworfene Steinelemente – dieses Mal Skulpturen verschiedener Künstler – unterbrochen. Besonders schön fand ich, dass dieses reiche Angebot an Grünflächen tatsächlich von den Einwohnern genutzt wurde. Unterwegs begegneten wir sehr vielen Leuten, die sich sportlich betätigten, wobei joggen definitiv an erster Stelle stand.
Der botanische Garten lag ebenfalls auf einer Landspitze, die eine Spitze einer Bucht bildet. Vor langer Zeit, Anfang des 19. Jahrhundert, fand Mrs. Macquarie diesen Aussichtspunkt bereits hinreißend, so dass sie gerne ihre Freizeit dort verbrachte, um auf den Ozean und die in den Hafen einlaufenden Schiffe zu blicken. Heute kann man sowohl die Harbour Bridge als auch die Oper von dort aus sehen. Es war wirklich ein herrlicher Platz für ein Picknick.

Der Rundgang, auf dem wir uns immer noch befanden, führte uns an der St. Mary's Cathedral vorbei, die dank ihrer Sandsteinfassade in warmen gold-braunen Tönen erstrahlte, auch wenn der Himmel mal bewölkt war. Innen sah man einen klassischen Stil, der sich an alte Architektur anlehnte.

Der Route folgend, kamen wir auch zum Government House, das zwar umzäunt war, generell aber für Besichtigungen offenstand. Das Gelände konnte man auch ohne Führung betreten. Es wirkte doch sehr britisch und erinnerte in seiner Architektur an den Repräsentationszwang vergangener Jahrhunderte.

Wir begingen den Fauxpas zu weit aufs Gelände vorzudringen, weil der Wind ein „Betreten verboten“-Schild umgeweht hatte. Sogleich sprang uns eine verlegene Angestellte entgegen und bat uns diesen Teil des Geländes zu verlassen. Wir zogen uns schnell zurück, bevor man schwere Geschütze auffuhr.
Die Art Gallery of New South Wales betrachteten wir nur von außen, da unser eng bemessener Zeitplan eine Auskundschaftung der kostenlosen Ausstellung nicht zuließ. Da das Gebäude schon riesig war, machten wir uns nichts vor, was die benötigte Zeit anging. Für gewöhnlich tendieren große Gebäude zu vielen Ausstellungsstücken.
Das Australian Museum hingegen stand schon von Anfang an als Ausflugsziel fest, so dass wir es an einem der ersten Tage abhandelten, um es auf gar keinen Fall zu verpassen. Wie so viele kulturelle Einrichtungen Sydneys fand auch das Australian Museum seinen Sitz in einem enormen Sandsteinbau. Pompös erhoben sich die ockerfarbenen Mauern in den Himmel. Von Innen war es nicht weniger gewaltig.

Nachdem wir also den Eintritt gezahlt hatten (auch hier gab es genügend Rabattmöglichkeiten), schnappten wir uns eine Karte des Gebäudes und marschierten die Ausstellungsräume der Reihe nach ab. Schön und verlockend war die Aussage einer Mitarbeiterin, die uns erklärte, dass wir alles anfassen durften, wenn wir es problemlos erreichten – es sei denn ein Schild verbot es explizit. Dadurch wussten wir sogleich, wo wir standen und was zu tun war. Man konnte das Museum also mit allen Sinnen erleben.
Leider war ein besonders wichtiger Teil, die Ausstellung zu den Aborigines, derzeit geschlossen, so dass wir nur einen Bruchteil dieser Geschichte erfahren konnten. Nichtsdestoweniger war es ein Anfang. Es gab einige interessante Informationen zu den veränderten Lebensbedingungen der indigenen Bevölkerung Australiens, nachdem sie auf die Europäer gestoßen waren.
Dieses Museum beschränkte sich allerdings nicht nur auf Geschichte. Ein Großteil der Ausstellungen war den naturwissenschaftlichen Gebieten gewidmet. In diesem Teil rückte der Aspekt mit dem Anfassen der Ausstellungsstücke in den Vordergrund: Man durfte die verschiedenen ausgestopften Tiere streicheln, um zu wissen, wie sie sich anfühlten. Sie liefen auch nicht weg, noch wehrten sie sich, wobei man beim Schnabeligel trotzdem aufpassen musste. Das Opossum hingegen war so flauschig, dass ich es gerne mitgenommen hätte. Wir durften die Knochen verschiedener Tiere in die Hand nehmen, um das Gewicht zu vergleichen. Vögel haben nun einmal eine andere Knochenstruktur als Elefanten.
Dann gab es noch eine Ausstellung zu prähistorischen Tieren Australiens. Dinosaurier sind schon allseits bekannt, aber wer hat schon einmal von der Demon Duck of Doom gehört?
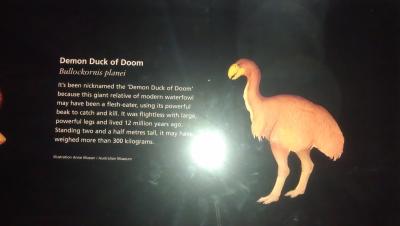
Früher gab es wohl auch noch riesige, teils fleischfressende Wombats und über zwei Meter große Kängurus. Nur weil diese Giganten ausgestorben sind, heißt es nicht, dass mit der Fauna Australiens zu spaßen ist.
Am Eingang zu einem der Ausstellungssäle war eine Statistik aufgeführt, die zeigen sollte, wie wenige Menschen jährlich durch australische Tiere umkommen – im Vergleich zu anderen Erdteilen. Ich vergaß noch an demselben Tag, was die Zahlen genau aussagten, denn ich wurde durch andere Fakten abgelenkt. Beispielsweise durch den Blaugeringelten Kraken, der zwar schön anzusehen ist, wenn er blau aufleuchtet, in dem Moment aber auch besonders gefährlich ist, weil er sich gerade bedroht fühlt und sein Gift vorbereitet. Dieses Gift ist halb so wild, schrieb man auf der Infotafel. Ich fand es allerdings beunruhigend, dass dieses starke Nervengift innerhalb kurzer Zeit zu Atemstillstand führt, es kein Gegengift gibt und die Behandlung darin besteht, den Patienten so lange künstlich zu beatmen, bis die Symptome abgeklungen sind, was gut und gerne 24 Stunden dauern kann. Erst nach einer Woche ist das Gift vollständig abgebaut. Aber man kann es überleben, wenn jemand da ist, der rechtzeitig den Krankenwagen ruft und einen bis zum Eintreffen Erste Hilfe leistet.
Es war ein seltsamer Abschluss des ansonsten doch eher ruhigen Spaziergangs durch das Museum.
An einem sonnigen Tag (derer gab es viele während unseres Aufenthaltes in Sydney) beschlossen wir den Ratschlag vieler Einheimischer zu befolgen, indem wir einen Ausflug nach Manly machten. Der einzig vertretbare Weg, auf dem man diese Halbinsel betreten darf, ist per Fähre, auch wenn man mit dem Auto oder Bus problemlos dahin kommt. So zumindest verkauften es uns die Einheimischen und, ehrlich gesagt, war es ein sehr schöner Ausflug dorthin. Also empfehle ich ihn hiermit weiter. Die Überfahrt dauert nur zwanzig bis dreißig Minuten, ist nicht teuer und gewährt einem einmalige Aussichten auf Oper und Harbour Bridge zugleich.
Natürlich sollte man bei der Gelegenheit sowohl Hin- als auch Rückfahrt mit der Fähre buchen.
Überraschenderweise begrüßte uns ein Aldi-Süd am Ausgang des Kais. Amüsiert stürmten wir dieses Geschäft und stellten enttäuscht fest, dass nicht überall Aldi drin ist, wo Aldi drauf steht. Der Großteil der Produkte war nicht einmal ansatzweise aus Deutschland oder mit deutschen Waren vergleichbar. Man hatte sich voll und ganz auf den australischen Markt eingestellt. Nur der Aufbau des Ladens erinnerte an das Aldi-Konzept, aber da hörte es auch schon auf. Geknickt verließen wir diesen Pseudo-Aldi, um uns Manly zuzuwenden.
Mittlerweile Profis in diesem Spiel stürmten wir als erstes die Touristeninformation, um uns Karte und Tipps für den Tag zu holen.
Erst dann waren wir für den Aufbruch bereit. Es stellte sich heraus, dass wir Manly an einem Punkt betreten hatten, der es uns sehr einfach machte von Küste zu Küste zu spazieren. Zwischen Kai und Sandstrand befand sich eine breite Fußgängerzone mit verschiedenen Geschäften. Alles war schön gepflegt. Die Vorführungen einiger Straßenkünstler waren hingegen sehr anstrengend, selbst wenn man nur flüchtig an ihnen vorbeiging, da akustische Verstärkung in Form von Lautsprechern durchaus gebräuchlich war. Wenn zwei angehende Sänger innerhalb von fünf Metern aufeinandertreffen, ist die Kakophonie einfach grausam.
Wie dem auch sei. Wir spazierten zum Strand, tauchten die Füße ins Meer, spazierten die Strandpromenade entlang, genossen den Sonnenschein, machten Fotos, hatten Spaß und stellten fest, dass es Zeit für ein Mittagessen war. Die Information hatte uns ein Restaurant empfohlen, in dem man sehr gute Fish'n'Chips bekam, also kehrten wir dort – nach einigem Suchen – ein. Das Essen war wirklich hervorragend.

Eine Dame in der Information hatte uns gesagt, dass es einen hervorragenden Aussichtspunkt gibt, von dem aus man auf Sydney schauen kann. Der Hin- und Rückweg dorthin sollte ungefähr 90 Minuten in Anspruch nehmen. Wir haderten ein bisschen mit uns, weil das Essen wirklich mächtig war und nicht viel Bewegung zuließ, entschieden uns dann allerdings dafür. Schnell stellten wir fest, dass die Einschätzung der Mitarbeiterin drastisch nach oben korrigiert werden musste, denn wir brauchten schon die angegebenen 90 Minuten für den Aufstieg. Letzten Endes zogen wir es durch, aber in Anbetracht des späten Aufbruchs und des Missverständnisses, war es nur halb so spaßig, wie es sonst hätte sein können. Darüber hinaus waren die Karten nicht akkurat genug, so dass wir den Großteil der Strecke neben der Straße herliefen, anstatt einen schönen, von Pflanzen gesäumten Wanderweg zu gehen. Die Aussicht hingegen war phantastisch. Wenn man richtig informiert ist und genügend Zeit mitbringt, kann es ein wunderbarer Ausflug werden.

Bevor wir den Rückweg antraten, erkundigten wir uns bei der Information auf dem Gipfel, wie wir am besten wieder in die Stadt kommen. Auf diese Weise kamen wir in den Genuss den eigens für Touristen angelegten Pfad zu sehen, der aus Metallgittern gemacht war. Es war nicht mit Neuseeland zu vergleichen, aber sie gaben sich Mühe.
Endlich wieder in Manly angekommen, suchten wir die Fähre auf, nicht allerdings ohne mir vorher einen wohlverdienten Nachtisch zu organisieren. Es gab Frozen Joghurt. Als wir in den Hafen Sydneys einfuhren, ging gerade die Sonne unter, so dass wir einen atemberaubenden Blick auf Oper und Harbour Bridge genießen durften. Das war es allemal wert.

Der Reiseführer Sydneys empfiehlt einen Besuch von China Town. Da es solche markanten Ortsteile in meiner Heimatstadt nicht gibt, freute ich mich auf dieses Unterfangen. So zogen wir eines Freitagsnachmittags los, um uns dieses Phänomen anzusehen. Schon auf dem Weg dorthin wurde deutlich, dass wir uns einem anderen Bezirk näherten, denn immer mehr asiatische Schüler strömten aus den Bussen in die Straßen. Auf unserer Karte war China Town nicht eingezeichnet, aber wir hatten eine grobe Beschreibung, wo es sein sollte, also hielten wir uns dran. Wir kamen in eine Straße, die sich deutlich von den anderen Sydneys unterschied: viele asiatische Restaurants, chinesische Schriftzeichen, andere Werbung. Ja, das sah schon nach China Town aus. Allerdings war es anders, als wir es uns vorgestellt hatten. Es war einfach nur eine stark asiatisch geprägte Straße. Zu diesem Zeitpunkt wussten wir auch noch nicht, dass dies nicht das „Zentrum“ China Towns war, sondern mehr als „Außenbezirk“ galt. Die Straße parallel dazu war schon mehr das, was man aus Filmen kennt: Große, von Löwenstatuen gesäumte Tore markierten den Eingang. Das zudem Freitagnachmittag war, herrschte reges Treiben, das durch den wöchentlichen Straßenmarkt ausgelöst wurde. Stände boten ihre verschiedenen Waren, Lebensmitteln oder Gebrauchsgegenständen, feil. Menschen drängten sich zwischen den Buden umher. Dahinter fanden sich reguläre Geschäfte und Restaurants, die auf hauptsächlich chinesische Kundschaft ausgelegt waren, wie beispielsweise ein Teeladen oder Massagesalon. Es war ein kunterbuntes Durcheinander, das einen mal hierhin, mal dorthin schob, und eine ganz andere Seite dieser Stadt zeigte.
An einem Ende von China Town findet man Market City, einen Einkaufskomplex von solchen Ausmaßen, dass mir beim Gedanken daran schwindelig wird. Es besteht aus drei Etagen (vier, wenn man Paddy's Market mitzählt), bietet tausendundeine Möglichkeit zum Geldausgeben, beherbergt Bekleidungsgeschäfte, Restaurants verschiedener Nationalitäten und Geschmacksrichtungen sowie Entertainmentbereiche mit verschiedenen Spielen, Automaten und was weiß ich noch. Man könnte täglich über einen Zeitraum von einem Monat drei Mahlzeiten pro Tag in Market City einnehmen und hätte immer noch nicht jeden Laden ausprobiert, auch wenn man jede Mahlzeit in einem anderen Restaurant, Café oder Lokal bestellen würde. Es ist unglaublich, was für eine Auswahl es dort gab. Wir probierten japanische Pizza am Spieß. Sie war ganz gut, aber die Fischflocken, in denen sie gerollt war, passten nicht so ganz in meine kulinarische Welt. Nächstes Mal ohne.
Die Mall ist sehr schön aufgebaut, hell, freundlich, mit genügend Sitzplätzen, um geschundenen Füßen eine kurze Rast zu gönnen, ohne gleich etwas zu Essen bestellen zu müssen. Umgekehrt gibt es auch einen Bereich für Kinder, um die Kleinen zu unterhalten, falls diese noch zu viel Energie haben, die Eltern aber schon fertig mit sich und der Welt sind. Bis heute zweifle ich dran, dass ich jede Ecke dieses Gebäudes sah, denn es ist sehr weitläufig und verwinkelt. Während wir die Rolltreppen rauf und runter fuhren, fiel uns wieder Hillarys Aussage ein: „Und dann stellten wir fest, dass Christchurch doch nicht so groß ist.“ In diesem Moment hatte ich den Eindruck, dass sogar diese Arkade größer als Christchurch war. Auf jeden Fall sollte man es mal mit eigenen Augen sehen.
Zum Abschluss wagten wir uns in Paddy's Market hinunter. Das war... anders... ein Erlebnis von ungewohnten Eindrücken. Paddy's Market ist ein riesiger überdachter Basar mit angrenzendem Frischgemüsemarkt. Anders kann ich es nicht in Worte fassen.
Wir befanden uns in einer riesigen Lagerhalle, in der kleine Marktstände in ihren vorgezeichneten Parzellen dicht an dicht standen. Jeder Stand war zum Bersten mit Waren gefüllt. Einige nützlich, andere dekorativ. Manchmal hatten die Leute hinter der Theke gerade genug Platz, sich einmal im Kreis zu drehen; ansonsten liefen sie Gefahr von ihren Beständen erschlagen zu werden. Wenn mal eine Parzelle groß genug war, um einen Durchgang für Kunden zu bieten, passten diese nur hindurch, wenn sie den Bauch sowie Kopf einzogen und Arme dicht am Körper hielten. Die Stände sowie Reihen zwischen den Ständen waren sorgsam durchnummeriert, so dass man ein komplexes Straßennetz mit distinktiven Bezeichnungen hatte, um sich zurecht zu finden. Ansonsten hätten wir wohl nie einen bestimmten Laden wiedergefunden.
Die Abteilung mit den frischen Lebensmitteln, also mit Obst und Gemüse, war noch ganz anders. Es war ein überdachter Markt. Man hatte Tische, die sich unter dem reichen Angebot fast schon bogen. Überall standen gefüllte Kisten herum, Preisschilder aus Pappe prangerten unordentlich an den Lebensmitteln, Leute wuselten überall umher, ein Gabelstapler fuhr vorbei. Es war überwältigend.
Einer noch nicht so alten Tradition folgend beschlossen wir ein Lunch bei Hungry Jack's einzunehmen. Die Tradition beläuft sich darauf, dass wir in jedem Land die einheimische Burgerkette ausprobieren, wenn wir eine finden. Ob Hungry Jack's nun original australisch ist oder nicht, spielt nur eine untergeordnete Rolle, wichtig ist, dass der Burgerking-Verschnitt in Deutschland nicht existiert und wir die Qualität des Essens vergleichen wollten. Also bestellten wir Burger, aßen sie auf einer Bank vor der Oper und waren ernüchtert. Es war zwar kein allzu schlechtes Essen, aber es war auch nicht herausragend gut.
Die Sache mit der Bank war allerdings keine allzu gute Idee. Kaum hatte ich den ersten Bissen getan, fiel mich eine gemeingefährliche Möwe von hinten an. Sie flog eine Handbreit neben meinem Gesicht her, biss in meinen Burger und zerrte eine Tomatenscheibe auf den Boden. Ich war empört! Glücklicherweise hatte sie nicht zu viel ergattert.
Um ein bisschen von der Wildnis Australiens betrachten zu können, ohne die Großstadt zu verlassen, besuchten wir das Sea Life Aquarium in Darling Harbour. Damit hatten wir zwei Attraktionen zugleich abgedeckt.
Das Sea Life Aquarium ist ein in sich abgeschlossener Bau mit einer Vielzahl von Wasserbewohnern, dessen Hauptausstellungsstücke zwei Seekühe waren. Um zu diesen zu gelangen, musste man allerdings fast das ganze Gebäude durchqueren. Es gab Abkürzungen, gewiss, doch sie waren dem Personal vorbehalten. Außerdem zahlte man den Eintritt ja, um möglichst viele unterschiedliche Arten zu sehen. So zogen wir los.
Am Anfang begrüßte uns ein mit Wasser gefülltes Becken, in dem einige unbedeutende Fische schwammen. Laut Beschilderung hätten dort aber Schnabeltiere drin sein sollen. Sea Life war technologisch schon einen Schritt weiter und informierte die Besucher durch Fernseher und Touchscreens über die Einwohner verschiedener Becken. Wir guckten und warteten, es geschah aber nichts. Schließlich verlegten wir es auf später, weil wir uns so ein Schauspiel natürlich nicht entgehen lassen wollten. Dennoch gab es noch so viel mehr zu sehen und wir waren erst am Eingang.
Es gab viele Becken mit richtig lustigen Tieren. Schildkröten, Seesterne, Rochen, diverse Fische (selbstverständlich), Riesenkrabben, Tiefseefische und viel mehr. Leider war die Beschilderung zwar technisch top, inhaltlich manchmal aber nur rudimentär, so dass vielerorts einige Becken in einem Bildschirm zusammengefasst waren und man als Besucher nicht sicher sein konnte, was einen erwartet, welcher Fisch also in welchem Becken schwamm.
Manchmal hingegen war es richtig gut gemacht. Ich hoffe, es ist noch im Auf- oder Umbau begriffen.

Um den Besuchern die Unterwasserwelt noch spektakulärer darzustellen und besser zu vermitteln, gab es zwei Becken, die man von unten sehen konnte. Wir gingen durch einen gläsernen Tunnel, während um uns herum die Meerestiere ihren bunten Tanz vollführten. Im ersten Becken fanden wir die Seekühe vor, die gerade gemütlich „grasten“. Man hatte allerdings das Seegras durch Salat ersetzt, was diesen riesigen Herbivore nicht das geringste Auszumachen schien. Sie fielen über das Grünzeug her und mampften es systematisch ab, wobei sie mehrere Minuten am Stück unter Wasser blieben, während sich kauten und grasten. Es war ein sehr lustiger und beeindruckender Anblick.

In dem zweiten Becken dieser Art befanden sich hauptsächlich Haie und Rochen. Sie schwammen viel schneller als die Seekühe, schienen richtig aufgedreht im Vergleich zu den gemütlichen Säugern. Einige Haie hatten es sich auf dem Glas gemütlich gemacht und lagen einfach nur faul rum. Es war lustig, sie einmal von unten zu bestaunen.

Dann gab es noch die Möglichkeit einige Kreaturen der See anzufassen, wenn man sanft mit ihnen umging. Ja, sie lebten noch. Ich war überrascht, wie fest ein Seestern ist. Er war gar nicht weich oder glibberig, die Haut war ein bisschen pelzig. Die Schale von unbefruchteten Haieiern fühlte sich wie eine Plastikflasche an. Es war richtig komisch.
Obwohl wir uns dem Ausgang näherten, konnten wir uns mit diesem Besuch noch nicht zufrieden geben. Die Schnabeltiere waren nicht einmal aus ihrem Bau gekrochen, doch ich wollte sie so gerne sehen. Wir waren mehrere Male zurückgegangen, um zu prüfen, ob sie wach waren – jedes Mal ohne Erfolg. Also sprach Franziska einen Mitarbeiter, Aaron, darauf an. Prompt führte er uns durch Abkürzungen zurück zum richtigen Becken, stellte fest, was wir schon wussten, nämlich dass die Tierchen nicht da waren, und bat uns noch einmal herzukommen, um explizit diese Tierchen zu sehen. Er erklärte uns, dass man sie am besten bei Dämmerung anträfe, also sollten wir später am Tag oder gegen 9:30 Uhr morgens da sein. Dann vermerkte er auf unseren Eintrittskarten, dass wir für die Schnabeltiere noch einmal rein durften, ohne zusätzlich zu zahlen. Das nenne ich Service.
Tags darauf standen wir um 9:45 Uhr, 15 Minuten nachdem das Sea Life Aquarium geöffnet hatte, vor dem Becken und bestaunten diese absonderlichen Wesen. Die Viecher waren so putzig! Zwei der drei Damen hatten sich heraus gewagt und platschten und tollten nun munter im Wasser umher. Sie drehten sich um alle drei Achsen, schwammen hierhin, dorthin, gruben bei der Futtersuche mit ihrem Schnabel das ganze Becken um und vollführten Kunststücke.

Wir lernten sehr viel über diese absonderlichen Wesen. Beispielsweise dass sie völlig blind sind, wenn sie tauchen. Sie machen die Augen zu und lassen sich von ihrem Schnabel leiten, da sie in der Lage sind kleinste elektrische Impulse aufzufangen, die von den Muskelbewegungen ihrer Beutetiere gemacht werden. Außerdem haben Männchen einen Sporn an den Hinterpfoten, der Gift enthält. Wie drückte Aaron es so schön aus? „It's still Australia; it's still trying to kill you.“ („Es ist immer noch Australien; es versucht dich immer noch umzubringen.“) Wir verbrachten tatsächlich eine ganze Stunde vor dem Becken, nur um immer wieder diese komischen Gestalten dabei zu beobachten, wie sie im Wasser nach Futter suchten. Zu gerne hätten wir gesehen, wie eines der Schnabeltiere sich an Land fortbewegt. Im Wasser waren sie flink und wendig, das sind Pinguine aber auch. Wir beobachteten sogar, wie eines der Tierchen sich mit der rechten Hinterpfote hinterm linken Ohr kratzte. So gelenkig ist nicht jedermann. Leider kamen die Damen nicht ein einziges Mal raus, was auch nicht notwendig war, weil der Eingang zu ihrem Bau unter Wasser lag. Schließlich verabschiedeten wir uns und gingen wieder – sichtlich zufrieden – unserer Wege. Es gab noch viel zu sehen. Außerdem hatte man uns erlaubt, das ganze Aquarium noch einmal zu sehen, obwohl wir nur wegen der Schnabeltiere gekommen waren.
Darling Harbour ist, wie der Name schon sagt, ein Hafen, oder besser gesagt ein Hafenviertel und es ist prächtig. Breite Promenaden flankierten das linke und rechte Ufer der Bucht; auf der einen Seite fanden wir diverse Restaurants, Cafés und Lokale, während gegenüber Arkaden und einzelne Geschäfte um Kunden buhlten. Darüber hinaus wurde ein Ende von einem Unterhaltungskomplex gekrönt, der das Sea Life Aquarium, das Wildlife Centre sowie Madame Tusseau's Sydney enthielt. Es war ein Viertel, das gerade ausgebaut wurde, weshalb Baustellen direkt vor der Haustür anzutreffen waren. Dennoch war es sehr schön anzusehen. Wir ließen uns von den Massen mal hierhin, mal dorthin treiben, spazierten an verschiedenen Geschäften vorbei, gingen ins Hard Rock Café, weil Franziska ein T-Shirt brauchte, und bestaunten das Ganze von oben, als wir auf die Brücke stiegen und unseren Blick über das glitzernde Meer schweifen ließen. Es war ein gelungener Ausflug mit schönen Aussichten in einer angenehmen Nachbarschaft.

Will man in der Innenstadt von Sydney von Nord nach Süd oder umgekehrt und ist des Laufens müde, kann man gerne die Linie 555 nehmen, die kostenlos von der Stadt angeboten wird. Weil wir es konnten, stiegen wir ein und fuhren die George Street rauf, um zum Hafen zu gelangen. Trotz zahlreicher Autos ging es sehr fix. Es war ja nicht mehr Hauptverkehrszeit.
Wir spazierten einmal lässig durch das Queen Victoria Building, einen Protzbau, in dem sich zahlreiche Markennamen unter einen Dach versammeln, um ihre Waren zu präsentieren und interessierten Kunden anzubieten. Es war definitiv über unserer Preisklasse, was schon durch die Architektur des Gebäudes vermittelt wurde. Opulent. Riesig. Teure Fußböden, noch teurere Inneneinrichtung. Und vor dem Haupteingang thronte die Königin persönlich. Wir wagten es nicht einmal, in einem der Cafés Platz zu nehmen und ein heißes Getränk zu bestellen, aus Sorge es könnte uns in den Ruin treiben. Vielleicht eines Tages, aber bestimmt nicht als Backpacker.

Eine weitere Empfehlung einer Broschüre war der Fischmarkt in Sydney, also gingen wir auch dort hin. Wie es sich für einen ordentlichen Fischmarkt gehört, befand sich dieser am Wasser. Dennoch war er nicht offen, sondern in mehreren großen Hallen verteilt, so dass man einige Zeit damit beschäftigt war umherzuwandern. Innen fand man alle möglichen Arten von Tieren, alles was das Meer hergibt. Von normalen Fischsorten, die jedermann kennt, über Königskrabbenbeine und Hummer zu Exoten, die man vielleicht einmal im Biologiebuch oder in einer Dokumentation gesehen hat. Es war wirklich alles dabei. Besonders lustig fand ich die Seeigel.

Natürlich gab es auch Restaurants und Imbisse in diesen Hallen, doch wir waren nicht hungrig, so dass wir sie ignorierten. Es schien alles sehr sauber und gepflegt, die Ware war definitiv frisch und bei den Menschenmassen waren die Verkäufer sehr geschäftig.
Auch in Sydney ergab sich die Gelegenheit für mich eine Trainingseinheit in meiner bevorzugten Sportart wahrzunehmen, also verabredete ich mich mit den Lehrern und stiefelte eines Abends los. Es war die erste und einzige Gelegenheit eine Spazierfahrt mit der Metro Sydneys zu machen, was meine Aufregung ziemlich steigerte. Immerhin kann bei solchen Unterfangen immer etwas schief gehen, wenn man beispielsweise in die falsche Bahn einsteigt, was ganz gut möglich ist, wenn man keinen Metroplan zur Hand hat. Es ging allerdings alles gut.
Die Wagons in Sydney waren riesig. Nicht nur dass sie zwei Stockwerke aufwiesen, nein, sie waren so breit, dass gemütlich fünf Leute nebeneinander sitzen konnten und trotzdem noch ein Gang für vorbeispazierende Gäste frei war. Die beste Erfindung darin war aber die Möglichkeit die Sitzlehnen zu wenden, so dass man sich immer in Fahrtrichtung setzen konnte – oder eben nicht. Mit einem Ruck schob man einfach eine ganze Reihe Sitzlehnen nach links oder rechts, voila, schon hatte man einen Zehnersitz für große Gruppen.
Wie bei so großen Städten üblich musste man zum Umsteigen auf ein anderes Gleis, das in diesem Fall ein Stockwerk über mir lag. Ich nahm die Rolltreppe, sah mich verwirrt um, las mir aufmerksam die Anzeigen auf einem Monitor durch und stieg in einen Zug, von dem ich hoffte, dass er mich dahin bringen würde, wohin ich wollte. Es klappte tatsächlich einwandfrei. Nach ungefähr zwanzig Minuten war ich an meinem Zielbahnhof angekommen. Wenig später fand ich auch den Trainingsraum. Es war sehr gut, dass man mir den Weg in einer vorhergehenden E-Mail näher beschrieben hatte, weil ich wohl sonst umgekehrt wäre, spätestens als ich an der Kirche stand.
Drinnen wurde ich erst einmal allen vorgestellt, auch der Trainerin Gillian, und freundlich empfangen. Das Training war sehr angenehm, wenn auch recht einfach. Zum Aufwärmen die Sanshin no Kata, gefolgt von einigen Übungen, die darauf basierten; dann gab es Bo, Schwert und die eine oder andere Densho. Auch wenn ich Gillian sehr mag und ihre Fähigkeiten respektiere, ist sie nicht mein Typ Lehrer, was nur daran liegt, dass ich mit ihrer Art zu erklären gewisse Verständnisschwierigkeiten habe. Trotzdem war es gut, mal wieder in Bewegung zu kommen.
Auch dieses Mal ergab sich für mich die Gelegenheit nach Hause mitgenommen zu werden, so dass ich zur späten Stunde nicht noch mit der Bahn durch die Stadt tingeln musste. Meine freundliche Mitfahrgelegenheit setzte mich direkt vor der Hosteltür ab, wobei wir es nicht versäumten, ein bisschen Small Talk zu betreiben. Alles in allem war es also ein hervorragender Abend.
Um auch die restlichen Kreationen dieses Kontinents zu bestaunen, begaben wir uns in einen Zoo. Der Wildlife Park war unser erklärtes Ziel, da es trotz regnerischen Wetters trockenen Fußes begangen werden konnte. Das ist der Vorteil von abgeschlossenen Räumlichkeiten.
Begrüßt wurden wir von einer Ansammlung von Reptilien. Da waren Schlangen, die sich eng eingerollt hatten, neben Geckos, gefolgt von Eidechsen.
Im nächsten, abgeschirmten Raum fanden wir Schmetterlingen. Diese bunten Flattermänner gingen so weit, sich gemütlich und unverblümt auf Menschen niederzulassen. Mit ihnen im „Gehege“ gab es noch einige kleine Vögel und Frösche. Für meinen Geschmack waren die tropischen Temperaturen nicht sonderlich ansprechen, aber die Tierchen schienen sich ganz wohl zu fühlen.
Endlich bekamen wir auch einige typisch australische Tiere zu sehen, von denen man in unseren Breitengraden schon einmal gehört hatte. Da gab es ein Beutelteufelweibchen (auch Tasmanischer Teufel genannt), das aufgeregt durch ihr Gehege wuselte und zu jedem Besucher mit einer verspielten Neugier anlief. Wahrscheinlich erwartete sie gefüttert zu werden, was die Besucher natürlich nicht machen durften. Von der Wärterin erfuhren wir etwas über die Namensgebung sowie das Verhalten des Tierchens. Es war allgemein sehr interessant den Wärtern zuzuhören, was sie über ihre Tiere zu erzählen hatten.

Im nächsten Gehege hatten wir das Privileg einen Koala „in action“ zu sehen. Er saß gemütlich in einer Astgabel und futterte gerade. Für ein Tier, das normalerweise 18 und mehr Stunden am Tag schläft, war das schon eine ziemliche Leistung.
Wir kamen an einem Gehege vorbei, in dem Wombat, Quokka und Gelbfuß-Felskänguru zusammen ihre Zeit verbachten. Im Vordergrund stand aber der Wombat, der klar und deutlich machte, dass dies hier sein Territorium war. Das 20 kg Exemplar war aber noch ein Teenager und wollte noch ordentlich wachsen, was in diesem Fall hieß, sein Gewicht verdoppeln. Lustige Tatsache über Wombats: Wenn sie sich freuen, jemanden zu sehen, beißen sie ihn. Es ist nur ein spielerisches Knabbern, aber bei den Zähnen und dem Gebiss, kann einem unbewaffneten Menschen schon einmal etwas abfallen.

Natürlich fanden sich auch gewöhnliche Kängurus im Wildlife Park. Die waren aber aufgrund des regnerischen Wetters faul und saßen nur in einer Ecke.

Ihre Faulheit wurde nur von der von Rex übertroffen. Rex war ein Krokodil. Er war riesig und so träge wie ein Ast in einer Brise. Bei einem Reptil wunderte mich das nicht allzu sehr, auch wenn er dadurch nicht gerade zur spannendsten Attraktion wurde. Im Vergleich zu ihm waren die Koalas richtige Energiebündel.

Was mir am Wildlife Park besonders gefiel, war die Tatsache, dass es eine persönliche Vorstellung einiger Tiere gab, bei der man sie auch anfassen durfte – natürlich unter strenger Aufsicht der Pfleger. Da wurde uns ein Schnabeligel präsentiert – den wir dann doch nicht anfassen sollten. Gefolgt von einer Bartagame. Zum Schluss streichelten wir eine Schlange. Ich hätte nie gedacht, dass die Haut dieses Wesens sich so weich und geschmeidig anfühlen würde, sondern eher ein ruppiges, schuppiges Gefühl erwartet. Das überraschte mich außerordentlich.
Es gab noch weit mehr Tiere in dem Wildlife Park, doch will ich möglichen Besuchern nicht alles vorwegnehmen. Außerdem ist es viel besser, sich die Exemplare mal persönlich anzusehen. Der Besuch gefiel mir sehr, besser als das Sea Life Aquarium.
Zum Abschluss möchte ich noch einige Worte zum Thema Postkarten in Australien verlieren: Auch wenn die Karte an sich sehr günstig zu bekommen ist, spinnt die australische Post. Mit 2,75 $ pro Briefmarke müsste diese schon aus Gold sein, um ihren Preis zu rechtfertigen. Ich fand es überhaupt nicht schön, dass man nirgends drauf hingewiesen wird, wie teuer das ausfallen wird. Für jemanden, der gerne Postkarten schreibt, ist das eine böse Überraschung.
Das Shuttle kam früher als geplant, lud alle Leute ein, fuhr noch zu einer anderen Unterkunft, um Gäste einzuladen, und es ging weiter zum Internationalen Flughafen von Christchurch. Dort kamen wir auch zeitig an, verabschiedeten uns von Patrick (nur, um ihn einige Minuten später an der Sicherheitskontrolle wiederzusehen) und checkten ein. Alles lief problemlos, so dass wir kurze Zeit später durch den (winzigen) Duty Free Shop schlenderten und uns über die horenden Preise wunderten.
Endlich war unser Flug bereit zum Boarding und wir nahmen unsere Plätze an Bord einer Boing 777-300 von Emirates Airlines ein. Start und Anfang des Fluges waren recht turbulent, doch das legte sich mit der Zeit. Ich vertrieb mir die Reise mit dem Film „Kingsman“, der allerdings nur mäßig unterhaltsam war. Dessen ungeachtet möchte ich an dieser Stelle keine ausführliche Kritik üben.
Bei diesem Flug fiel uns eine Stewardess auf, die sich durch schlechte Laune sowie patziges Benehmen in den Mittelpunkt drängte. Wir waren ein wenig überrascht, schließlich war dies ein Flug von Emirates. Glücklicherweise hatten wir nur wenig mit ihr zu tun.
Um den Service dieser noblen Fluggesellschaft zu testen, bestellte ich mir ein lactosefreies Menü. Es war gut; insbesondere der Nachtisch schmeckte mir.
Gerade als mein Film sein Ende gefunden hatte, setzten wir zur Landung an – zwanzig Minuten früher als geplant. Zuvor hatten wir einige Dokumente bekommen, die wir vor der Einreise ausfüllen mussten. Da auch darauf gefragt wurde, ob wir Dreck an den Schuhen hatten, blieb uns nichts anders übrig, als zu bejahen. Natürlich machte uns dies einige Sorgen, weil wir schon befürchteten, dass uns etwas abhanden kommen könnte – Schuhe beispielsweise. Doch die Einreise war ebenso einfach wie nach Neuseeland. Man besah sich unsere Schuhe, fragte, ob die im Koffer sauber waren, und winkte uns durch. Ich frage mich langsam, ob man als Deutscher einen Freibrief für diverse Länder besitzt, ohne es zu wissen. Sie wollten nicht einmal das Visum sehen. Dabei war es so eine Tortur, es zu bekommen. Das war nur ein Scherz.
Tatsächlich muss man selbst ein Touristenvisum für Australien beantragen. Praktischerweise geht das nur noch online und, wenn man Einwohner Deutschlands ist, geht es auch verdammt schnell. Eine Stunde nach Beantragung hatte ich schon die Zusage: Ich durfte innerhalb des nächsten Jahres bis zu drei Monate in Australien verbringen, um Fotos zu knipsen. Und es hatte mich nichts gekostet.
Ursprünglich hatten wir geplant auch in Sydney eine Gastfamilie zu finden und so unsere Kosten niedrig zu halten. Nachdem wir erfahren hatten, dass es mit einem Touristenvisum völlig legal ist, war es schon fast selbstverständlich. Da sowohl Einreise- als auch Abreisetermin feststanden, nahmen wir schon früh Kontakt zu potenziellen Gastgebern auf. Wir fanden auch eine interessierte Familie und wähnten uns sicher, bis wir einige Tage vor der geplanten Ankunft nach der Adresse fragten und zur Antwort bekamen, dass die Familie gerade jemand anderen hatten. Schnell suchten wir uns eine Herberge für die Dauer unseres Aufenthalts und kamen so in den Genuss von Eva's Backpackers – inklusive einem kostenlosen Shuttleservice vom Flughafen zur Unterkunft. Wir mussten nur ein bestimmtes Formular einem bestimmten Herren zeigen und schon brachte er uns zum richtigen Bussteig.
Es war der erste Australier, mit dem wir Kontakt hatten, und ich war königlich amüsiert. Er erinnerte mich an Hammy aus „Ab durch die Hecke“: aufgedreht, schnell, redselig. Mit riesigen Schritten stapfte er zielgerichtet voran, wobei er ohne Unterlass plapperte. Innerhalb weniger Minuten erfuhren wir alles über sein Alter, seinen Familienstand, seine bisherigen Reisen, Verwandten und noch mehr. Zudem bestätigte er jedes Klischee, das ich über sprachliche Eigenarten des australischen Dialektes kenne. Schon von Beginn an, ja im ersten Satz, ging er zu „mate“ über. So viel Spaß es uns auch machte ihn zu beobachten und mit ihm zu plauschen, sein Zeitverständnis war von einem anderen Stern. Statt der angekündigten fünfzehn Minuten warteten wir über eine halbe Stunde, bis der Shuttlebus ankam.
Als dieser Kleintransporter mit Gepäckanhänger dann endlich vorfuhr, verlagerte sich unsere Sorge vom Begrüßungskommitee zum Fahrer. Wir befürchteten ernsthaft, dass dieser Mann uns hinter dem Steuer mit einem Herzinfarkt zusammenbrechen könnte, und ich fragte mich für einen Lidschlag, ob er beim ersten Weltkrieg in Gallipoli gewesen war. Als wir dann endlich losfuhren, spielte unser Fahrer klassische Musik, was der ganzen Szene einen abstrakten Anstrich gab. Glücklicherweise war das Fahrzeug entschieden jünger als sein Fahrer.
Endlich in Eva's Backpackers angekommen checkten wir provisorisch ein, bezogen unsere Betten und gaben uns der Nachtruhe hin. Immerhin beträgt die Zeitverschiebung Neuseeland-Australien zwei Stunden, also war es schon ein sehr langer Tag gewesen. Außerdem hatte ich lange nicht mehr ein so sicheres Hostel gesehen. Es gab Türcodes und Sicherheitsschlüssel, womit Fremden der Zugang sichtlich erschwert wurde. Eine Bekanntschaft machten wir an diesem Abend noch. Es war eine Deutsche. Der zweite Gast, mit dem wir Kontakt hatten, war Sam, ein Engländer, der von Korea nach Sydney geflogen war. Er gab uns zahlreiche Tipps und Hinweise für unseren bevorstehenden Aufenthalt in dem ostasiatischen Land.
Wir hatten eine lange Liste mit Sehenswürdigkeiten, die uns teils durch öffentliche Werbemaßnahmen der Stadt, teils durch Mundpropaganda zu Ohren gekommen waren. Allerdings war unser Aufenthalt begrenzt, weshalb wir jeden Tag möglichst zum Bersten ausfüllten.
Wieder erhielten wir kostenlose Stadtkarten, Reiseführer, Broschüren und Rabattgutscheine. All das half uns bei der weiteren Planung sowie Durchführung unserer Reise. Schon der erste Spaziergang überzeugte. Sydney war schön. In der Stadt fand sich alles, was ein metropolitisches Herz begehrte, wobei es nicht an Auflockerungen durch Bäume, Grünflächen und Parklandschaften mangelte. Aber auch ein gewisser Charme kam sehr deutlich zum Vorschein. Breite Gehwege sorgten dafür, dass die kärglich tröpfelnden Menschenströme des Winters gemütlich Platz fanden. Im Sommer ist es wahrscheinlich entschieden voller. Die Beschilderung half jedem sich zurecht zu finden. Es war alles sehr sauber und gepflegt. Alte Gebäude im Kolonialstil, gesäumt von Palmen, standen neben modernen Bauten aus Glas, gingen teils sogar gekonnt ineinander über. Natürlich fanden sich dazwischen einige klägliche Beleidigungen der 1970er Jahre; das Problem hat wahrscheinlich jede Stadt, die mit Zement umzugehen weiß. Die Skyline, mit unzähligen Wolkenkratzern, die von Banken und bekannten Firmen beheimatet wurden, verdiente ihren Namen zurecht. Auch wenn die Gebäude alle in die Höhe ragten, hatten sie wesentliche Unterscheidungsmerkmale, so dass dem Auge viel Abwechslung geboten wurde.

Es versteht sich von selbst, dass wir die Oper aufsuchten, um dieses einzigartig Gebäude mit seiner faszinierenden Architektur zu bewundern. Allerdings folgten wir dabei einem vorgegebenen Pfad, der uns an diversen Sehenswürdigkeiten im Zentrum der Stadt vorbeiführte. Krönender Abschluss war die Oper. Dieses Bauwerk übte auf mich eine ungemeine Faszination aus. Entgegen meiner Erwartungen war es aber nicht schneeweiß, sondern mit verschiedenen kleinen Fliesen in Weiß und Beige (vorwiegend letzteres) bedeckt. Ich fand es nicht nur sehr schön, sondern obendrein beeindruckend. Außerdem war es viel größer als erwartet. Eine wohlgepflegte Promenade führte um die Oper herum, wodurch man sie aus allen möglichen Winkeln betrachten konnte. Auch von der Harbour Bridge war eine ungetrübte Aussicht auf diese riesige Muschelansammlung möglich. Zu unserem Bedauern erfuhren wir, dass wir leider einen Tag zu spät für das Lichtspiel „Vivid Sydney“ angereist waren, bei dem die Oper abends von außen mit verschiedenfarbigen Scheinwerfern bestrahlt wurde und in ganz neuem Glanz erstrahlte. Das nennt man dann Pech. Sie ist auch so sehr schön.



Bei der Gelegenheit ließen wir es uns natürlich nicht nehmen einfach mal einen Blick ins Innere des Gebäudes zu werfen. Die Eingangshalle war ebenfalls stilistisch einwandfrei, wodurch wir befanden, dass uns ein rundum gelungenes Konzept präsentiert wurde. Äußerst zufriedenstellend. Für ein Konzert reichte meine Reisekasse dieses Mal allerdings nicht, so dass ich nichts über die Akustik oder den Aufbau des Konzertsaals sagen kann.
Das zweite Wahrzeichen Sydneys, die Harbour Bridge, war nicht so weit von der Oper entfernt, als dass man einen Spaziergang dorthin scheuen sollte. Tatsächlich konnte man sehr gute Fotos mit beiden Motiven gleichzeitig schießen. Also brachen wir zur Brücke auf und sahen auf diese Weise noch einige interessante Teile von der Stadt. Um von der Oper zur Harbour Bridge zu gelangen, konnte man durch den alten Stadtteil Sydney, genannt The Rocks, gehen. Genau dies machten wir auch, aber dazu später mehr.

Als wir endlich eine Möglichkeit fanden, als Fußgänger auf die Brücke zu gelangen, kraxelten wir die unzähligen Stufen hoch, nur um festzustellen, dass noch mehr Treppen auf uns warteten. Endlich waren wir auf dem Fußgängerpfad, der einem riesigen Käfig glich. Wir gingen fast bis zum anderen Ende der Brücke, schossen immer wieder einige Fotos und gingen dann zurück. Ich fand die Aussicht hervorragend und die Tatsache so hoch über dem Boden zu sein spannend.
Zurück ging es wieder durch The Rocks, einen Stadtteil, der sich durch niedrige Bauten stark von der Skyline des Hafenviertels abhob. Die Häuser waren urig, stellenweise noch Originale aus Siedlerzeiten, es gab viele Cafés, Bars, Gaststätten und dergleichen. Wir beschlossen ohne Stadtkarte nur mit einer groben Richtung ausgestattet durch die Straßen zu irren, um die Umgebung auf uns wirken zu lassen, und fanden bei der Gelegenheit ein Haus, das gehegt und gepflegt wurde, um die Lebensbedingungen von vor 150 Jahren darzustellen. Es war ein einfacher Tante Emma-Laden, den man kostenlos betreten durfte. Auf den Regalen standen Kolonialwaren, Lebensmittel (natürlich nicht echt) und Dosen; Kasse und Waage waren noch aus alten Tagen. Es war wirklich schön gemacht. Nicht weit davon war ein – kostenpflichtiges – Museum, das wir allerdings aussparten.
Bei einer weiteren Runde durch The Rocks fanden wir – wieder einmal zufällig – ein kostenloses Museum unter dem Titel Discovery Museum, das die Geschichte des Viertels erzählte. Wir lernten einiges über die Besiedlung, Entwicklung und Umgestaltung der Nachbarschaft, aber auch über den Kampf der Einheimischen, die dafür sorgten, dass The Rocks so erhalten blieb, wie die Touristen es heute vorfinden. Erstaunlich war, dass wir hier auch etwas über die Geschichte der Maori fanden. Vom technischen Standpunkt aus betrachtet waren die Vitrinen ein Highlight: Ein Bildschirm hinter dem Glas lieferte Informationen zu Ausstellungsstücken. Sensoren oben und unten an der Vitrine maßen die Bewegungen der Besucher, so dass man den Bildschirm immer noch wie einen Touchscreen bedienen konnte, obwohl man ihn nicht berührte, sondern nur das leere Vitrinenglas.
Wir spazierten durch den Hyde Park und durch den Royal Botanic Garden. Das allein dauerte schon einige Stunden, da diese Parklandschaften einen enormen Teil der Innenstadt einnahmen. Beide waren sehr gut angelegt, ordentlich und auf jeden Fall sehenswert.
Man erkannte deutliche Unterscheide zwischen Park und Garten, die über die Größe hinausgingen. Im Park fanden sich oft geometrische Formen, was sowohl im Aufbau der Wege als auch in der Bepflanzung sichtbar wurde. Hier gab es Blumenbeete, dort eine Allee, Laternen am Wegesrand, dazwischen Rasen. Zwischendurch gab es noch einige Steinbauten – Pavillons, Brunnen, Statuen. (Ja, die Australier erkannten den Nutzen von Stein als Bauelement und verbauen ihn nun in ihren Gebäuden.)
Der Garten hingegen zeigte wenig Symmetrie, hatte dafür aber eine reiche Beschilderung, was die Pflanzenwelt betraf. Auch hier wurde das didaktische Ambiente durch zufällig eingeworfene Steinelemente – dieses Mal Skulpturen verschiedener Künstler – unterbrochen. Besonders schön fand ich, dass dieses reiche Angebot an Grünflächen tatsächlich von den Einwohnern genutzt wurde. Unterwegs begegneten wir sehr vielen Leuten, die sich sportlich betätigten, wobei joggen definitiv an erster Stelle stand.
Der botanische Garten lag ebenfalls auf einer Landspitze, die eine Spitze einer Bucht bildet. Vor langer Zeit, Anfang des 19. Jahrhundert, fand Mrs. Macquarie diesen Aussichtspunkt bereits hinreißend, so dass sie gerne ihre Freizeit dort verbrachte, um auf den Ozean und die in den Hafen einlaufenden Schiffe zu blicken. Heute kann man sowohl die Harbour Bridge als auch die Oper von dort aus sehen. Es war wirklich ein herrlicher Platz für ein Picknick.

Der Rundgang, auf dem wir uns immer noch befanden, führte uns an der St. Mary's Cathedral vorbei, die dank ihrer Sandsteinfassade in warmen gold-braunen Tönen erstrahlte, auch wenn der Himmel mal bewölkt war. Innen sah man einen klassischen Stil, der sich an alte Architektur anlehnte.

Der Route folgend, kamen wir auch zum Government House, das zwar umzäunt war, generell aber für Besichtigungen offenstand. Das Gelände konnte man auch ohne Führung betreten. Es wirkte doch sehr britisch und erinnerte in seiner Architektur an den Repräsentationszwang vergangener Jahrhunderte.

Wir begingen den Fauxpas zu weit aufs Gelände vorzudringen, weil der Wind ein „Betreten verboten“-Schild umgeweht hatte. Sogleich sprang uns eine verlegene Angestellte entgegen und bat uns diesen Teil des Geländes zu verlassen. Wir zogen uns schnell zurück, bevor man schwere Geschütze auffuhr.
Die Art Gallery of New South Wales betrachteten wir nur von außen, da unser eng bemessener Zeitplan eine Auskundschaftung der kostenlosen Ausstellung nicht zuließ. Da das Gebäude schon riesig war, machten wir uns nichts vor, was die benötigte Zeit anging. Für gewöhnlich tendieren große Gebäude zu vielen Ausstellungsstücken.
Das Australian Museum hingegen stand schon von Anfang an als Ausflugsziel fest, so dass wir es an einem der ersten Tage abhandelten, um es auf gar keinen Fall zu verpassen. Wie so viele kulturelle Einrichtungen Sydneys fand auch das Australian Museum seinen Sitz in einem enormen Sandsteinbau. Pompös erhoben sich die ockerfarbenen Mauern in den Himmel. Von Innen war es nicht weniger gewaltig.

Nachdem wir also den Eintritt gezahlt hatten (auch hier gab es genügend Rabattmöglichkeiten), schnappten wir uns eine Karte des Gebäudes und marschierten die Ausstellungsräume der Reihe nach ab. Schön und verlockend war die Aussage einer Mitarbeiterin, die uns erklärte, dass wir alles anfassen durften, wenn wir es problemlos erreichten – es sei denn ein Schild verbot es explizit. Dadurch wussten wir sogleich, wo wir standen und was zu tun war. Man konnte das Museum also mit allen Sinnen erleben.
Leider war ein besonders wichtiger Teil, die Ausstellung zu den Aborigines, derzeit geschlossen, so dass wir nur einen Bruchteil dieser Geschichte erfahren konnten. Nichtsdestoweniger war es ein Anfang. Es gab einige interessante Informationen zu den veränderten Lebensbedingungen der indigenen Bevölkerung Australiens, nachdem sie auf die Europäer gestoßen waren.
Dieses Museum beschränkte sich allerdings nicht nur auf Geschichte. Ein Großteil der Ausstellungen war den naturwissenschaftlichen Gebieten gewidmet. In diesem Teil rückte der Aspekt mit dem Anfassen der Ausstellungsstücke in den Vordergrund: Man durfte die verschiedenen ausgestopften Tiere streicheln, um zu wissen, wie sie sich anfühlten. Sie liefen auch nicht weg, noch wehrten sie sich, wobei man beim Schnabeligel trotzdem aufpassen musste. Das Opossum hingegen war so flauschig, dass ich es gerne mitgenommen hätte. Wir durften die Knochen verschiedener Tiere in die Hand nehmen, um das Gewicht zu vergleichen. Vögel haben nun einmal eine andere Knochenstruktur als Elefanten.
Dann gab es noch eine Ausstellung zu prähistorischen Tieren Australiens. Dinosaurier sind schon allseits bekannt, aber wer hat schon einmal von der Demon Duck of Doom gehört?
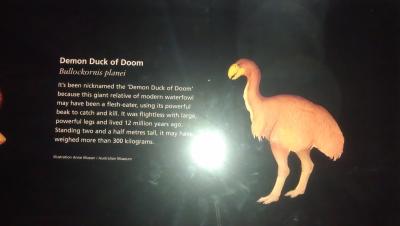
Früher gab es wohl auch noch riesige, teils fleischfressende Wombats und über zwei Meter große Kängurus. Nur weil diese Giganten ausgestorben sind, heißt es nicht, dass mit der Fauna Australiens zu spaßen ist.
Am Eingang zu einem der Ausstellungssäle war eine Statistik aufgeführt, die zeigen sollte, wie wenige Menschen jährlich durch australische Tiere umkommen – im Vergleich zu anderen Erdteilen. Ich vergaß noch an demselben Tag, was die Zahlen genau aussagten, denn ich wurde durch andere Fakten abgelenkt. Beispielsweise durch den Blaugeringelten Kraken, der zwar schön anzusehen ist, wenn er blau aufleuchtet, in dem Moment aber auch besonders gefährlich ist, weil er sich gerade bedroht fühlt und sein Gift vorbereitet. Dieses Gift ist halb so wild, schrieb man auf der Infotafel. Ich fand es allerdings beunruhigend, dass dieses starke Nervengift innerhalb kurzer Zeit zu Atemstillstand führt, es kein Gegengift gibt und die Behandlung darin besteht, den Patienten so lange künstlich zu beatmen, bis die Symptome abgeklungen sind, was gut und gerne 24 Stunden dauern kann. Erst nach einer Woche ist das Gift vollständig abgebaut. Aber man kann es überleben, wenn jemand da ist, der rechtzeitig den Krankenwagen ruft und einen bis zum Eintreffen Erste Hilfe leistet.
Es war ein seltsamer Abschluss des ansonsten doch eher ruhigen Spaziergangs durch das Museum.
An einem sonnigen Tag (derer gab es viele während unseres Aufenthaltes in Sydney) beschlossen wir den Ratschlag vieler Einheimischer zu befolgen, indem wir einen Ausflug nach Manly machten. Der einzig vertretbare Weg, auf dem man diese Halbinsel betreten darf, ist per Fähre, auch wenn man mit dem Auto oder Bus problemlos dahin kommt. So zumindest verkauften es uns die Einheimischen und, ehrlich gesagt, war es ein sehr schöner Ausflug dorthin. Also empfehle ich ihn hiermit weiter. Die Überfahrt dauert nur zwanzig bis dreißig Minuten, ist nicht teuer und gewährt einem einmalige Aussichten auf Oper und Harbour Bridge zugleich.
Natürlich sollte man bei der Gelegenheit sowohl Hin- als auch Rückfahrt mit der Fähre buchen.
Überraschenderweise begrüßte uns ein Aldi-Süd am Ausgang des Kais. Amüsiert stürmten wir dieses Geschäft und stellten enttäuscht fest, dass nicht überall Aldi drin ist, wo Aldi drauf steht. Der Großteil der Produkte war nicht einmal ansatzweise aus Deutschland oder mit deutschen Waren vergleichbar. Man hatte sich voll und ganz auf den australischen Markt eingestellt. Nur der Aufbau des Ladens erinnerte an das Aldi-Konzept, aber da hörte es auch schon auf. Geknickt verließen wir diesen Pseudo-Aldi, um uns Manly zuzuwenden.
Mittlerweile Profis in diesem Spiel stürmten wir als erstes die Touristeninformation, um uns Karte und Tipps für den Tag zu holen.
Erst dann waren wir für den Aufbruch bereit. Es stellte sich heraus, dass wir Manly an einem Punkt betreten hatten, der es uns sehr einfach machte von Küste zu Küste zu spazieren. Zwischen Kai und Sandstrand befand sich eine breite Fußgängerzone mit verschiedenen Geschäften. Alles war schön gepflegt. Die Vorführungen einiger Straßenkünstler waren hingegen sehr anstrengend, selbst wenn man nur flüchtig an ihnen vorbeiging, da akustische Verstärkung in Form von Lautsprechern durchaus gebräuchlich war. Wenn zwei angehende Sänger innerhalb von fünf Metern aufeinandertreffen, ist die Kakophonie einfach grausam.
Wie dem auch sei. Wir spazierten zum Strand, tauchten die Füße ins Meer, spazierten die Strandpromenade entlang, genossen den Sonnenschein, machten Fotos, hatten Spaß und stellten fest, dass es Zeit für ein Mittagessen war. Die Information hatte uns ein Restaurant empfohlen, in dem man sehr gute Fish'n'Chips bekam, also kehrten wir dort – nach einigem Suchen – ein. Das Essen war wirklich hervorragend.

Eine Dame in der Information hatte uns gesagt, dass es einen hervorragenden Aussichtspunkt gibt, von dem aus man auf Sydney schauen kann. Der Hin- und Rückweg dorthin sollte ungefähr 90 Minuten in Anspruch nehmen. Wir haderten ein bisschen mit uns, weil das Essen wirklich mächtig war und nicht viel Bewegung zuließ, entschieden uns dann allerdings dafür. Schnell stellten wir fest, dass die Einschätzung der Mitarbeiterin drastisch nach oben korrigiert werden musste, denn wir brauchten schon die angegebenen 90 Minuten für den Aufstieg. Letzten Endes zogen wir es durch, aber in Anbetracht des späten Aufbruchs und des Missverständnisses, war es nur halb so spaßig, wie es sonst hätte sein können. Darüber hinaus waren die Karten nicht akkurat genug, so dass wir den Großteil der Strecke neben der Straße herliefen, anstatt einen schönen, von Pflanzen gesäumten Wanderweg zu gehen. Die Aussicht hingegen war phantastisch. Wenn man richtig informiert ist und genügend Zeit mitbringt, kann es ein wunderbarer Ausflug werden.

Bevor wir den Rückweg antraten, erkundigten wir uns bei der Information auf dem Gipfel, wie wir am besten wieder in die Stadt kommen. Auf diese Weise kamen wir in den Genuss den eigens für Touristen angelegten Pfad zu sehen, der aus Metallgittern gemacht war. Es war nicht mit Neuseeland zu vergleichen, aber sie gaben sich Mühe.
Endlich wieder in Manly angekommen, suchten wir die Fähre auf, nicht allerdings ohne mir vorher einen wohlverdienten Nachtisch zu organisieren. Es gab Frozen Joghurt. Als wir in den Hafen Sydneys einfuhren, ging gerade die Sonne unter, so dass wir einen atemberaubenden Blick auf Oper und Harbour Bridge genießen durften. Das war es allemal wert.

Der Reiseführer Sydneys empfiehlt einen Besuch von China Town. Da es solche markanten Ortsteile in meiner Heimatstadt nicht gibt, freute ich mich auf dieses Unterfangen. So zogen wir eines Freitagsnachmittags los, um uns dieses Phänomen anzusehen. Schon auf dem Weg dorthin wurde deutlich, dass wir uns einem anderen Bezirk näherten, denn immer mehr asiatische Schüler strömten aus den Bussen in die Straßen. Auf unserer Karte war China Town nicht eingezeichnet, aber wir hatten eine grobe Beschreibung, wo es sein sollte, also hielten wir uns dran. Wir kamen in eine Straße, die sich deutlich von den anderen Sydneys unterschied: viele asiatische Restaurants, chinesische Schriftzeichen, andere Werbung. Ja, das sah schon nach China Town aus. Allerdings war es anders, als wir es uns vorgestellt hatten. Es war einfach nur eine stark asiatisch geprägte Straße. Zu diesem Zeitpunkt wussten wir auch noch nicht, dass dies nicht das „Zentrum“ China Towns war, sondern mehr als „Außenbezirk“ galt. Die Straße parallel dazu war schon mehr das, was man aus Filmen kennt: Große, von Löwenstatuen gesäumte Tore markierten den Eingang. Das zudem Freitagnachmittag war, herrschte reges Treiben, das durch den wöchentlichen Straßenmarkt ausgelöst wurde. Stände boten ihre verschiedenen Waren, Lebensmitteln oder Gebrauchsgegenständen, feil. Menschen drängten sich zwischen den Buden umher. Dahinter fanden sich reguläre Geschäfte und Restaurants, die auf hauptsächlich chinesische Kundschaft ausgelegt waren, wie beispielsweise ein Teeladen oder Massagesalon. Es war ein kunterbuntes Durcheinander, das einen mal hierhin, mal dorthin schob, und eine ganz andere Seite dieser Stadt zeigte.
An einem Ende von China Town findet man Market City, einen Einkaufskomplex von solchen Ausmaßen, dass mir beim Gedanken daran schwindelig wird. Es besteht aus drei Etagen (vier, wenn man Paddy's Market mitzählt), bietet tausendundeine Möglichkeit zum Geldausgeben, beherbergt Bekleidungsgeschäfte, Restaurants verschiedener Nationalitäten und Geschmacksrichtungen sowie Entertainmentbereiche mit verschiedenen Spielen, Automaten und was weiß ich noch. Man könnte täglich über einen Zeitraum von einem Monat drei Mahlzeiten pro Tag in Market City einnehmen und hätte immer noch nicht jeden Laden ausprobiert, auch wenn man jede Mahlzeit in einem anderen Restaurant, Café oder Lokal bestellen würde. Es ist unglaublich, was für eine Auswahl es dort gab. Wir probierten japanische Pizza am Spieß. Sie war ganz gut, aber die Fischflocken, in denen sie gerollt war, passten nicht so ganz in meine kulinarische Welt. Nächstes Mal ohne.
Die Mall ist sehr schön aufgebaut, hell, freundlich, mit genügend Sitzplätzen, um geschundenen Füßen eine kurze Rast zu gönnen, ohne gleich etwas zu Essen bestellen zu müssen. Umgekehrt gibt es auch einen Bereich für Kinder, um die Kleinen zu unterhalten, falls diese noch zu viel Energie haben, die Eltern aber schon fertig mit sich und der Welt sind. Bis heute zweifle ich dran, dass ich jede Ecke dieses Gebäudes sah, denn es ist sehr weitläufig und verwinkelt. Während wir die Rolltreppen rauf und runter fuhren, fiel uns wieder Hillarys Aussage ein: „Und dann stellten wir fest, dass Christchurch doch nicht so groß ist.“ In diesem Moment hatte ich den Eindruck, dass sogar diese Arkade größer als Christchurch war. Auf jeden Fall sollte man es mal mit eigenen Augen sehen.
Zum Abschluss wagten wir uns in Paddy's Market hinunter. Das war... anders... ein Erlebnis von ungewohnten Eindrücken. Paddy's Market ist ein riesiger überdachter Basar mit angrenzendem Frischgemüsemarkt. Anders kann ich es nicht in Worte fassen.
Wir befanden uns in einer riesigen Lagerhalle, in der kleine Marktstände in ihren vorgezeichneten Parzellen dicht an dicht standen. Jeder Stand war zum Bersten mit Waren gefüllt. Einige nützlich, andere dekorativ. Manchmal hatten die Leute hinter der Theke gerade genug Platz, sich einmal im Kreis zu drehen; ansonsten liefen sie Gefahr von ihren Beständen erschlagen zu werden. Wenn mal eine Parzelle groß genug war, um einen Durchgang für Kunden zu bieten, passten diese nur hindurch, wenn sie den Bauch sowie Kopf einzogen und Arme dicht am Körper hielten. Die Stände sowie Reihen zwischen den Ständen waren sorgsam durchnummeriert, so dass man ein komplexes Straßennetz mit distinktiven Bezeichnungen hatte, um sich zurecht zu finden. Ansonsten hätten wir wohl nie einen bestimmten Laden wiedergefunden.
Die Abteilung mit den frischen Lebensmitteln, also mit Obst und Gemüse, war noch ganz anders. Es war ein überdachter Markt. Man hatte Tische, die sich unter dem reichen Angebot fast schon bogen. Überall standen gefüllte Kisten herum, Preisschilder aus Pappe prangerten unordentlich an den Lebensmitteln, Leute wuselten überall umher, ein Gabelstapler fuhr vorbei. Es war überwältigend.
Einer noch nicht so alten Tradition folgend beschlossen wir ein Lunch bei Hungry Jack's einzunehmen. Die Tradition beläuft sich darauf, dass wir in jedem Land die einheimische Burgerkette ausprobieren, wenn wir eine finden. Ob Hungry Jack's nun original australisch ist oder nicht, spielt nur eine untergeordnete Rolle, wichtig ist, dass der Burgerking-Verschnitt in Deutschland nicht existiert und wir die Qualität des Essens vergleichen wollten. Also bestellten wir Burger, aßen sie auf einer Bank vor der Oper und waren ernüchtert. Es war zwar kein allzu schlechtes Essen, aber es war auch nicht herausragend gut.
Die Sache mit der Bank war allerdings keine allzu gute Idee. Kaum hatte ich den ersten Bissen getan, fiel mich eine gemeingefährliche Möwe von hinten an. Sie flog eine Handbreit neben meinem Gesicht her, biss in meinen Burger und zerrte eine Tomatenscheibe auf den Boden. Ich war empört! Glücklicherweise hatte sie nicht zu viel ergattert.
Um ein bisschen von der Wildnis Australiens betrachten zu können, ohne die Großstadt zu verlassen, besuchten wir das Sea Life Aquarium in Darling Harbour. Damit hatten wir zwei Attraktionen zugleich abgedeckt.
Das Sea Life Aquarium ist ein in sich abgeschlossener Bau mit einer Vielzahl von Wasserbewohnern, dessen Hauptausstellungsstücke zwei Seekühe waren. Um zu diesen zu gelangen, musste man allerdings fast das ganze Gebäude durchqueren. Es gab Abkürzungen, gewiss, doch sie waren dem Personal vorbehalten. Außerdem zahlte man den Eintritt ja, um möglichst viele unterschiedliche Arten zu sehen. So zogen wir los.
Am Anfang begrüßte uns ein mit Wasser gefülltes Becken, in dem einige unbedeutende Fische schwammen. Laut Beschilderung hätten dort aber Schnabeltiere drin sein sollen. Sea Life war technologisch schon einen Schritt weiter und informierte die Besucher durch Fernseher und Touchscreens über die Einwohner verschiedener Becken. Wir guckten und warteten, es geschah aber nichts. Schließlich verlegten wir es auf später, weil wir uns so ein Schauspiel natürlich nicht entgehen lassen wollten. Dennoch gab es noch so viel mehr zu sehen und wir waren erst am Eingang.
Es gab viele Becken mit richtig lustigen Tieren. Schildkröten, Seesterne, Rochen, diverse Fische (selbstverständlich), Riesenkrabben, Tiefseefische und viel mehr. Leider war die Beschilderung zwar technisch top, inhaltlich manchmal aber nur rudimentär, so dass vielerorts einige Becken in einem Bildschirm zusammengefasst waren und man als Besucher nicht sicher sein konnte, was einen erwartet, welcher Fisch also in welchem Becken schwamm.
Manchmal hingegen war es richtig gut gemacht. Ich hoffe, es ist noch im Auf- oder Umbau begriffen.

Um den Besuchern die Unterwasserwelt noch spektakulärer darzustellen und besser zu vermitteln, gab es zwei Becken, die man von unten sehen konnte. Wir gingen durch einen gläsernen Tunnel, während um uns herum die Meerestiere ihren bunten Tanz vollführten. Im ersten Becken fanden wir die Seekühe vor, die gerade gemütlich „grasten“. Man hatte allerdings das Seegras durch Salat ersetzt, was diesen riesigen Herbivore nicht das geringste Auszumachen schien. Sie fielen über das Grünzeug her und mampften es systematisch ab, wobei sie mehrere Minuten am Stück unter Wasser blieben, während sich kauten und grasten. Es war ein sehr lustiger und beeindruckender Anblick.

In dem zweiten Becken dieser Art befanden sich hauptsächlich Haie und Rochen. Sie schwammen viel schneller als die Seekühe, schienen richtig aufgedreht im Vergleich zu den gemütlichen Säugern. Einige Haie hatten es sich auf dem Glas gemütlich gemacht und lagen einfach nur faul rum. Es war lustig, sie einmal von unten zu bestaunen.

Dann gab es noch die Möglichkeit einige Kreaturen der See anzufassen, wenn man sanft mit ihnen umging. Ja, sie lebten noch. Ich war überrascht, wie fest ein Seestern ist. Er war gar nicht weich oder glibberig, die Haut war ein bisschen pelzig. Die Schale von unbefruchteten Haieiern fühlte sich wie eine Plastikflasche an. Es war richtig komisch.
Obwohl wir uns dem Ausgang näherten, konnten wir uns mit diesem Besuch noch nicht zufrieden geben. Die Schnabeltiere waren nicht einmal aus ihrem Bau gekrochen, doch ich wollte sie so gerne sehen. Wir waren mehrere Male zurückgegangen, um zu prüfen, ob sie wach waren – jedes Mal ohne Erfolg. Also sprach Franziska einen Mitarbeiter, Aaron, darauf an. Prompt führte er uns durch Abkürzungen zurück zum richtigen Becken, stellte fest, was wir schon wussten, nämlich dass die Tierchen nicht da waren, und bat uns noch einmal herzukommen, um explizit diese Tierchen zu sehen. Er erklärte uns, dass man sie am besten bei Dämmerung anträfe, also sollten wir später am Tag oder gegen 9:30 Uhr morgens da sein. Dann vermerkte er auf unseren Eintrittskarten, dass wir für die Schnabeltiere noch einmal rein durften, ohne zusätzlich zu zahlen. Das nenne ich Service.
Tags darauf standen wir um 9:45 Uhr, 15 Minuten nachdem das Sea Life Aquarium geöffnet hatte, vor dem Becken und bestaunten diese absonderlichen Wesen. Die Viecher waren so putzig! Zwei der drei Damen hatten sich heraus gewagt und platschten und tollten nun munter im Wasser umher. Sie drehten sich um alle drei Achsen, schwammen hierhin, dorthin, gruben bei der Futtersuche mit ihrem Schnabel das ganze Becken um und vollführten Kunststücke.

Wir lernten sehr viel über diese absonderlichen Wesen. Beispielsweise dass sie völlig blind sind, wenn sie tauchen. Sie machen die Augen zu und lassen sich von ihrem Schnabel leiten, da sie in der Lage sind kleinste elektrische Impulse aufzufangen, die von den Muskelbewegungen ihrer Beutetiere gemacht werden. Außerdem haben Männchen einen Sporn an den Hinterpfoten, der Gift enthält. Wie drückte Aaron es so schön aus? „It's still Australia; it's still trying to kill you.“ („Es ist immer noch Australien; es versucht dich immer noch umzubringen.“) Wir verbrachten tatsächlich eine ganze Stunde vor dem Becken, nur um immer wieder diese komischen Gestalten dabei zu beobachten, wie sie im Wasser nach Futter suchten. Zu gerne hätten wir gesehen, wie eines der Schnabeltiere sich an Land fortbewegt. Im Wasser waren sie flink und wendig, das sind Pinguine aber auch. Wir beobachteten sogar, wie eines der Tierchen sich mit der rechten Hinterpfote hinterm linken Ohr kratzte. So gelenkig ist nicht jedermann. Leider kamen die Damen nicht ein einziges Mal raus, was auch nicht notwendig war, weil der Eingang zu ihrem Bau unter Wasser lag. Schließlich verabschiedeten wir uns und gingen wieder – sichtlich zufrieden – unserer Wege. Es gab noch viel zu sehen. Außerdem hatte man uns erlaubt, das ganze Aquarium noch einmal zu sehen, obwohl wir nur wegen der Schnabeltiere gekommen waren.
Darling Harbour ist, wie der Name schon sagt, ein Hafen, oder besser gesagt ein Hafenviertel und es ist prächtig. Breite Promenaden flankierten das linke und rechte Ufer der Bucht; auf der einen Seite fanden wir diverse Restaurants, Cafés und Lokale, während gegenüber Arkaden und einzelne Geschäfte um Kunden buhlten. Darüber hinaus wurde ein Ende von einem Unterhaltungskomplex gekrönt, der das Sea Life Aquarium, das Wildlife Centre sowie Madame Tusseau's Sydney enthielt. Es war ein Viertel, das gerade ausgebaut wurde, weshalb Baustellen direkt vor der Haustür anzutreffen waren. Dennoch war es sehr schön anzusehen. Wir ließen uns von den Massen mal hierhin, mal dorthin treiben, spazierten an verschiedenen Geschäften vorbei, gingen ins Hard Rock Café, weil Franziska ein T-Shirt brauchte, und bestaunten das Ganze von oben, als wir auf die Brücke stiegen und unseren Blick über das glitzernde Meer schweifen ließen. Es war ein gelungener Ausflug mit schönen Aussichten in einer angenehmen Nachbarschaft.

Will man in der Innenstadt von Sydney von Nord nach Süd oder umgekehrt und ist des Laufens müde, kann man gerne die Linie 555 nehmen, die kostenlos von der Stadt angeboten wird. Weil wir es konnten, stiegen wir ein und fuhren die George Street rauf, um zum Hafen zu gelangen. Trotz zahlreicher Autos ging es sehr fix. Es war ja nicht mehr Hauptverkehrszeit.
Wir spazierten einmal lässig durch das Queen Victoria Building, einen Protzbau, in dem sich zahlreiche Markennamen unter einen Dach versammeln, um ihre Waren zu präsentieren und interessierten Kunden anzubieten. Es war definitiv über unserer Preisklasse, was schon durch die Architektur des Gebäudes vermittelt wurde. Opulent. Riesig. Teure Fußböden, noch teurere Inneneinrichtung. Und vor dem Haupteingang thronte die Königin persönlich. Wir wagten es nicht einmal, in einem der Cafés Platz zu nehmen und ein heißes Getränk zu bestellen, aus Sorge es könnte uns in den Ruin treiben. Vielleicht eines Tages, aber bestimmt nicht als Backpacker.

Eine weitere Empfehlung einer Broschüre war der Fischmarkt in Sydney, also gingen wir auch dort hin. Wie es sich für einen ordentlichen Fischmarkt gehört, befand sich dieser am Wasser. Dennoch war er nicht offen, sondern in mehreren großen Hallen verteilt, so dass man einige Zeit damit beschäftigt war umherzuwandern. Innen fand man alle möglichen Arten von Tieren, alles was das Meer hergibt. Von normalen Fischsorten, die jedermann kennt, über Königskrabbenbeine und Hummer zu Exoten, die man vielleicht einmal im Biologiebuch oder in einer Dokumentation gesehen hat. Es war wirklich alles dabei. Besonders lustig fand ich die Seeigel.

Natürlich gab es auch Restaurants und Imbisse in diesen Hallen, doch wir waren nicht hungrig, so dass wir sie ignorierten. Es schien alles sehr sauber und gepflegt, die Ware war definitiv frisch und bei den Menschenmassen waren die Verkäufer sehr geschäftig.
Auch in Sydney ergab sich die Gelegenheit für mich eine Trainingseinheit in meiner bevorzugten Sportart wahrzunehmen, also verabredete ich mich mit den Lehrern und stiefelte eines Abends los. Es war die erste und einzige Gelegenheit eine Spazierfahrt mit der Metro Sydneys zu machen, was meine Aufregung ziemlich steigerte. Immerhin kann bei solchen Unterfangen immer etwas schief gehen, wenn man beispielsweise in die falsche Bahn einsteigt, was ganz gut möglich ist, wenn man keinen Metroplan zur Hand hat. Es ging allerdings alles gut.
Die Wagons in Sydney waren riesig. Nicht nur dass sie zwei Stockwerke aufwiesen, nein, sie waren so breit, dass gemütlich fünf Leute nebeneinander sitzen konnten und trotzdem noch ein Gang für vorbeispazierende Gäste frei war. Die beste Erfindung darin war aber die Möglichkeit die Sitzlehnen zu wenden, so dass man sich immer in Fahrtrichtung setzen konnte – oder eben nicht. Mit einem Ruck schob man einfach eine ganze Reihe Sitzlehnen nach links oder rechts, voila, schon hatte man einen Zehnersitz für große Gruppen.
Wie bei so großen Städten üblich musste man zum Umsteigen auf ein anderes Gleis, das in diesem Fall ein Stockwerk über mir lag. Ich nahm die Rolltreppe, sah mich verwirrt um, las mir aufmerksam die Anzeigen auf einem Monitor durch und stieg in einen Zug, von dem ich hoffte, dass er mich dahin bringen würde, wohin ich wollte. Es klappte tatsächlich einwandfrei. Nach ungefähr zwanzig Minuten war ich an meinem Zielbahnhof angekommen. Wenig später fand ich auch den Trainingsraum. Es war sehr gut, dass man mir den Weg in einer vorhergehenden E-Mail näher beschrieben hatte, weil ich wohl sonst umgekehrt wäre, spätestens als ich an der Kirche stand.
Drinnen wurde ich erst einmal allen vorgestellt, auch der Trainerin Gillian, und freundlich empfangen. Das Training war sehr angenehm, wenn auch recht einfach. Zum Aufwärmen die Sanshin no Kata, gefolgt von einigen Übungen, die darauf basierten; dann gab es Bo, Schwert und die eine oder andere Densho. Auch wenn ich Gillian sehr mag und ihre Fähigkeiten respektiere, ist sie nicht mein Typ Lehrer, was nur daran liegt, dass ich mit ihrer Art zu erklären gewisse Verständnisschwierigkeiten habe. Trotzdem war es gut, mal wieder in Bewegung zu kommen.
Auch dieses Mal ergab sich für mich die Gelegenheit nach Hause mitgenommen zu werden, so dass ich zur späten Stunde nicht noch mit der Bahn durch die Stadt tingeln musste. Meine freundliche Mitfahrgelegenheit setzte mich direkt vor der Hosteltür ab, wobei wir es nicht versäumten, ein bisschen Small Talk zu betreiben. Alles in allem war es also ein hervorragender Abend.
Um auch die restlichen Kreationen dieses Kontinents zu bestaunen, begaben wir uns in einen Zoo. Der Wildlife Park war unser erklärtes Ziel, da es trotz regnerischen Wetters trockenen Fußes begangen werden konnte. Das ist der Vorteil von abgeschlossenen Räumlichkeiten.
Begrüßt wurden wir von einer Ansammlung von Reptilien. Da waren Schlangen, die sich eng eingerollt hatten, neben Geckos, gefolgt von Eidechsen.
Im nächsten, abgeschirmten Raum fanden wir Schmetterlingen. Diese bunten Flattermänner gingen so weit, sich gemütlich und unverblümt auf Menschen niederzulassen. Mit ihnen im „Gehege“ gab es noch einige kleine Vögel und Frösche. Für meinen Geschmack waren die tropischen Temperaturen nicht sonderlich ansprechen, aber die Tierchen schienen sich ganz wohl zu fühlen.
Endlich bekamen wir auch einige typisch australische Tiere zu sehen, von denen man in unseren Breitengraden schon einmal gehört hatte. Da gab es ein Beutelteufelweibchen (auch Tasmanischer Teufel genannt), das aufgeregt durch ihr Gehege wuselte und zu jedem Besucher mit einer verspielten Neugier anlief. Wahrscheinlich erwartete sie gefüttert zu werden, was die Besucher natürlich nicht machen durften. Von der Wärterin erfuhren wir etwas über die Namensgebung sowie das Verhalten des Tierchens. Es war allgemein sehr interessant den Wärtern zuzuhören, was sie über ihre Tiere zu erzählen hatten.

Im nächsten Gehege hatten wir das Privileg einen Koala „in action“ zu sehen. Er saß gemütlich in einer Astgabel und futterte gerade. Für ein Tier, das normalerweise 18 und mehr Stunden am Tag schläft, war das schon eine ziemliche Leistung.
Wir kamen an einem Gehege vorbei, in dem Wombat, Quokka und Gelbfuß-Felskänguru zusammen ihre Zeit verbachten. Im Vordergrund stand aber der Wombat, der klar und deutlich machte, dass dies hier sein Territorium war. Das 20 kg Exemplar war aber noch ein Teenager und wollte noch ordentlich wachsen, was in diesem Fall hieß, sein Gewicht verdoppeln. Lustige Tatsache über Wombats: Wenn sie sich freuen, jemanden zu sehen, beißen sie ihn. Es ist nur ein spielerisches Knabbern, aber bei den Zähnen und dem Gebiss, kann einem unbewaffneten Menschen schon einmal etwas abfallen.

Natürlich fanden sich auch gewöhnliche Kängurus im Wildlife Park. Die waren aber aufgrund des regnerischen Wetters faul und saßen nur in einer Ecke.

Ihre Faulheit wurde nur von der von Rex übertroffen. Rex war ein Krokodil. Er war riesig und so träge wie ein Ast in einer Brise. Bei einem Reptil wunderte mich das nicht allzu sehr, auch wenn er dadurch nicht gerade zur spannendsten Attraktion wurde. Im Vergleich zu ihm waren die Koalas richtige Energiebündel.

Was mir am Wildlife Park besonders gefiel, war die Tatsache, dass es eine persönliche Vorstellung einiger Tiere gab, bei der man sie auch anfassen durfte – natürlich unter strenger Aufsicht der Pfleger. Da wurde uns ein Schnabeligel präsentiert – den wir dann doch nicht anfassen sollten. Gefolgt von einer Bartagame. Zum Schluss streichelten wir eine Schlange. Ich hätte nie gedacht, dass die Haut dieses Wesens sich so weich und geschmeidig anfühlen würde, sondern eher ein ruppiges, schuppiges Gefühl erwartet. Das überraschte mich außerordentlich.
Es gab noch weit mehr Tiere in dem Wildlife Park, doch will ich möglichen Besuchern nicht alles vorwegnehmen. Außerdem ist es viel besser, sich die Exemplare mal persönlich anzusehen. Der Besuch gefiel mir sehr, besser als das Sea Life Aquarium.
Zum Abschluss möchte ich noch einige Worte zum Thema Postkarten in Australien verlieren: Auch wenn die Karte an sich sehr günstig zu bekommen ist, spinnt die australische Post. Mit 2,75 $ pro Briefmarke müsste diese schon aus Gold sein, um ihren Preis zu rechtfertigen. Ich fand es überhaupt nicht schön, dass man nirgends drauf hingewiesen wird, wie teuer das ausfallen wird. Für jemanden, der gerne Postkarten schreibt, ist das eine böse Überraschung.
... link (0 Kommentare) ... comment
Montag, 17. August 2015
Fazit Neuseeland
atimos, 10:46h
Wenn ich im Nachhinein über die Reise nach und den Aufenthalt in Neuseeland nachdenke, gibt es einige Punkte, die mir besonders stark in Erinnerung bleiben.
Öffentliche Verkehrsmittel vs. Eigenes Auto
Die öffentlichen Verkehrsmittel, vor allem die verschiedenen Reisebusse, schaffen es ganz gut, einen von A nach B zu bringen. Man kommt auf jeden Fall weiter. Allerdings ist einem dadurch auch die Möglichkeit verbaut, die etwas abgelegeneren Teile dieses Landes zu sehen, und gerade diese machen den Reiz aus. Wenn man nicht gerade mehrtägige Wanderrouten hinter sich bringen will, während man mehrere Monate im Land der Kiwis verweilt, sollte man ernsthaft die Anschaffung eines Autos erwägen. Es gibt gebrauchte Modelle zu einem relativ günstigen Preis, und wenn man mit jemandem teilt oder nur die Fahrtkosten für diverse Busverbindungen zusammenrechnet, lohnt es sich. Mit einem Auto ist man wesentlich flexibler. Einige Hosts mussten wir von Anfang an ausschließen, weil sie so weit von jeglicher Zivilisation wohnten, dass sie uns nicht abholen konnten.
Will man allerdings nur einige ausgewählte Touristenattraktionen sehen und kommt für nur wenige Wochen vorbei, ist ein Bus ganz in Ordnung. Allerdings kann man sich dann auch Gedanken über einen Mietwagen machen. Wenn man rechtzeitig bucht und seine Route sorgsam plant, kann es immer noch günstiger als ein Busticket werden.
Stadt vs. Land
Die Städte Neuseelands sind größtenteils langweilig. Die meisten sind konstruiert, wodurch sie teils steril wirken. Das ständig wiederkehrende Gittermuster der Straßen bietet wenig Abwechslung, macht es andererseits aber auch schwierig sich zu verlaufen. Ehrlich gesagt habe ich aber schon Videospiele mit mehr Liebe zur Stadtgestaltung gesehen. Selbstverständlich gibt es einige Ausnahmen und Sehenswürdigkeiten in Städten: Wellington, Napier, Nelson, sind alles gute Beispiele. Allerdings sollte man sich im Allgemeinen nicht allzu viele davon erwarten. Bei einem so jungen Land kann es nun einmal keine antiken Bauten geben.
Fernab dieser Agglomerationen findet man das, was Neuseeland auszeichnet und wofür es berühmt ist: eine einmalige Landschaft. Ob Berge, Fjorde, Seen, Wälder oder Strände, all das gibt es am anderen Ende der Welt zuhauf. Man kann verschiedene Klimaextreme an einem Tag erleben, je nachdem wo man sich gerade befindet oder wie weit man fährt. Das sollte der primäre Grund sein nach Neuseeland zu fahren.
Ulraub vs. Leben
Ob man in Neuseeland einige Jahre – oder den Rest – seines Lebens verbringen will, ist natürlich eine subjektive Frage.
Das Land hat seine eigenen Probleme, denen es sich früher oder später stellen muss, wie jedes andere auch. Als Urlauber bekommt man davon natürlich nichts mit, es sei denn man beschäftigt sich eingehender mit Politik, Kultur, Geschichte, Wirtschaft und Soziologie des Landes. Will man aber nur ausspanne, kann man das gut und einfach machen. Man kann viele Abenteuer erleben und sich auf vielerlei Weise erproben, aber man kann sich auch sehr gut treiben und die Aussichten auf sich wirken lassen. Es ist für jeden das Richtige dabei. Neuseeland ist auf Touristen, insbesondere Backpacker, angewiesen und wird weiterhin alles Mögliche machen, um das Land mit all seinen Facetten für Leute aus fernen Ländern attraktiv zu gestalten.
Dort zu leben ist allerdings ein ganz anderes Paar Schuhe. Für mich lautet die Antwort definitiv „Nein“. Die Städte bieten relativ wenig Abwechslung, die Qualität der Lebensmittel lässt zu wünschen übrig, mal davon abgesehen, dass sie äußerst teuer sind, die Leute sind zwar freundlich, aber das gehört einfach zum guten Ton. Wenn ein Neuseeländer fragt, wie es einem geht, erwartet er ein höfiches „Gut, und dir?“, aber mit Sicherheit nicht die gesamte Lebensgeschichte. Wendy sagte uns sogar, dass sie nicht wüsste, wie sie reagieren soll, wenn jemand sagen würde, dass es ihm schlecht geht. So schnell wie die Leute sich gefunden haben, gehen sie auch wieder getrennte Wege, wodurch jede Beziehung ein bisschen oberflächlich wirkt.
Entscheidet man sich für ein Leben auf dem Land, ist man tatsächlich von allem abgeschnitten. Man muss autark werden – oder diesem Ziel so nah wie möglich kommen. Mobilfunk funktioniert nicht, das Internet ist noch langsamer als in Städten, wenn es überhaupt vorhanden ist, oder es hat nur ein begrenztes Datenvolumen, weil es über Satellit läuft, sich mit Leuten zu treffen erfordert gute organisatorische Fähigkeiten und dergleichen. Dann bleibt natürlich die Frage, wie man sich zu den politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Problemen des Landes positioniert.
Umgekehrt muss man in ein Flugzeug steigen, wenn man als Einwohner Neuseelands irgendwo anders Urlaub machen möchte. Das haben Inselstaaten nun einmal so an sich.
Am besten fasste es aber eine flüchtige Bekanntschaft zusammen, ein Engländer, den wir in Christchurch trafen: „It is far away and far behind.“ („Es liegt weit weg und weit zurück.“)
Ich empfehle Jedem, der sich für die Wunder unserer Natur interessiert, einen etwas längeren Urlaub in Neuseeland zu verbringen, die Städte zu meiden und unter anderen Sternen zu schlafen. Kulturell interessierten Reisenden sind allerdings viele Grenzen gesetzt, da das Angebot in dieser Sparte nur begrenzt ist. Abenteuer wiederum gibt es an jeder Ecke, man sollte allerdings das nötige Kleingeld mitbringen.
Öffentliche Verkehrsmittel vs. Eigenes Auto
Die öffentlichen Verkehrsmittel, vor allem die verschiedenen Reisebusse, schaffen es ganz gut, einen von A nach B zu bringen. Man kommt auf jeden Fall weiter. Allerdings ist einem dadurch auch die Möglichkeit verbaut, die etwas abgelegeneren Teile dieses Landes zu sehen, und gerade diese machen den Reiz aus. Wenn man nicht gerade mehrtägige Wanderrouten hinter sich bringen will, während man mehrere Monate im Land der Kiwis verweilt, sollte man ernsthaft die Anschaffung eines Autos erwägen. Es gibt gebrauchte Modelle zu einem relativ günstigen Preis, und wenn man mit jemandem teilt oder nur die Fahrtkosten für diverse Busverbindungen zusammenrechnet, lohnt es sich. Mit einem Auto ist man wesentlich flexibler. Einige Hosts mussten wir von Anfang an ausschließen, weil sie so weit von jeglicher Zivilisation wohnten, dass sie uns nicht abholen konnten.
Will man allerdings nur einige ausgewählte Touristenattraktionen sehen und kommt für nur wenige Wochen vorbei, ist ein Bus ganz in Ordnung. Allerdings kann man sich dann auch Gedanken über einen Mietwagen machen. Wenn man rechtzeitig bucht und seine Route sorgsam plant, kann es immer noch günstiger als ein Busticket werden.
Stadt vs. Land
Die Städte Neuseelands sind größtenteils langweilig. Die meisten sind konstruiert, wodurch sie teils steril wirken. Das ständig wiederkehrende Gittermuster der Straßen bietet wenig Abwechslung, macht es andererseits aber auch schwierig sich zu verlaufen. Ehrlich gesagt habe ich aber schon Videospiele mit mehr Liebe zur Stadtgestaltung gesehen. Selbstverständlich gibt es einige Ausnahmen und Sehenswürdigkeiten in Städten: Wellington, Napier, Nelson, sind alles gute Beispiele. Allerdings sollte man sich im Allgemeinen nicht allzu viele davon erwarten. Bei einem so jungen Land kann es nun einmal keine antiken Bauten geben.
Fernab dieser Agglomerationen findet man das, was Neuseeland auszeichnet und wofür es berühmt ist: eine einmalige Landschaft. Ob Berge, Fjorde, Seen, Wälder oder Strände, all das gibt es am anderen Ende der Welt zuhauf. Man kann verschiedene Klimaextreme an einem Tag erleben, je nachdem wo man sich gerade befindet oder wie weit man fährt. Das sollte der primäre Grund sein nach Neuseeland zu fahren.
Ulraub vs. Leben
Ob man in Neuseeland einige Jahre – oder den Rest – seines Lebens verbringen will, ist natürlich eine subjektive Frage.
Das Land hat seine eigenen Probleme, denen es sich früher oder später stellen muss, wie jedes andere auch. Als Urlauber bekommt man davon natürlich nichts mit, es sei denn man beschäftigt sich eingehender mit Politik, Kultur, Geschichte, Wirtschaft und Soziologie des Landes. Will man aber nur ausspanne, kann man das gut und einfach machen. Man kann viele Abenteuer erleben und sich auf vielerlei Weise erproben, aber man kann sich auch sehr gut treiben und die Aussichten auf sich wirken lassen. Es ist für jeden das Richtige dabei. Neuseeland ist auf Touristen, insbesondere Backpacker, angewiesen und wird weiterhin alles Mögliche machen, um das Land mit all seinen Facetten für Leute aus fernen Ländern attraktiv zu gestalten.
Dort zu leben ist allerdings ein ganz anderes Paar Schuhe. Für mich lautet die Antwort definitiv „Nein“. Die Städte bieten relativ wenig Abwechslung, die Qualität der Lebensmittel lässt zu wünschen übrig, mal davon abgesehen, dass sie äußerst teuer sind, die Leute sind zwar freundlich, aber das gehört einfach zum guten Ton. Wenn ein Neuseeländer fragt, wie es einem geht, erwartet er ein höfiches „Gut, und dir?“, aber mit Sicherheit nicht die gesamte Lebensgeschichte. Wendy sagte uns sogar, dass sie nicht wüsste, wie sie reagieren soll, wenn jemand sagen würde, dass es ihm schlecht geht. So schnell wie die Leute sich gefunden haben, gehen sie auch wieder getrennte Wege, wodurch jede Beziehung ein bisschen oberflächlich wirkt.
Entscheidet man sich für ein Leben auf dem Land, ist man tatsächlich von allem abgeschnitten. Man muss autark werden – oder diesem Ziel so nah wie möglich kommen. Mobilfunk funktioniert nicht, das Internet ist noch langsamer als in Städten, wenn es überhaupt vorhanden ist, oder es hat nur ein begrenztes Datenvolumen, weil es über Satellit läuft, sich mit Leuten zu treffen erfordert gute organisatorische Fähigkeiten und dergleichen. Dann bleibt natürlich die Frage, wie man sich zu den politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Problemen des Landes positioniert.
Umgekehrt muss man in ein Flugzeug steigen, wenn man als Einwohner Neuseelands irgendwo anders Urlaub machen möchte. Das haben Inselstaaten nun einmal so an sich.
Am besten fasste es aber eine flüchtige Bekanntschaft zusammen, ein Engländer, den wir in Christchurch trafen: „It is far away and far behind.“ („Es liegt weit weg und weit zurück.“)
Ich empfehle Jedem, der sich für die Wunder unserer Natur interessiert, einen etwas längeren Urlaub in Neuseeland zu verbringen, die Städte zu meiden und unter anderen Sternen zu schlafen. Kulturell interessierten Reisenden sind allerdings viele Grenzen gesetzt, da das Angebot in dieser Sparte nur begrenzt ist. Abenteuer wiederum gibt es an jeder Ecke, man sollte allerdings das nötige Kleingeld mitbringen.
... link (0 Kommentare) ... comment
Sonntag, 16. August 2015
Christchurch – Juni 2015
atimos, 01:57h
Unsere letzte Nacht in Neuseeland verbrachten wir im Gefängnis. Franziska war felsenfest davon überzeugt, dass es die beste Unterkunft war, die wir seit Einreise in dieses Land gehabt hatten. Ich weiß nicht, wie viel das über die Qualität der Hostels in Neuseeland oder über uns aussagt, aber es war wirklich toll dort.

Fangen wir am Anfang an.
Hilary und Collin waren so freundlich uns nach Christchurch zu bringen, da sie eh beide noch andere Geschäfte in der Stadt zu erledigen hatten. Es war also alles andere als eine Bürde für sie. Sie setzten uns vor unserer Herberge ab und damit trennten sich unsere Wege.
Kaum dass wir unser Gepäck abgeladen hatten, zogen wir auch schon los die Stadt unsicher zu machen. Zielstrebig und mit einer Stadtkarte bewaffnet, stapften wir die Straßen dieser „Großstadt“ entlang. Vorbei ging es an mehrspurigen Straßen, Ampeln, viel genutzten Parklandschaften, Flüsschen und Bächen, der i-Site, bis wir ankamen, wo wir sein wollten. So viel Verkehr, so viele Menschen, waren wir ja gar nicht mehr gewohnt. Es war fast schon turbulent in dieser Metropole. Ja, der „Zivilisationsschock“ traf uns immer wieder aufs neue in diesem Inselstaat.
Unser erstes Ziel war das Canterbury Museum, das man sich kostenlos ansehen durfte.

Ja, es war besser als Te Papa. Wir erfuhren einiges über die Geschichte der Maori, über die Besiedlung der Region, über das Leben in Christchurch und wie es sich im Laufe der Jahre verändert hatte, aber auch über die Folgen des großen Erdbebens vor einigen Jahren.
Endlich gab es Informationen über die Eingliederung der Maori in die europäische Gesellschaft, über die ersten Maori-Soldaten im Ersten Weltkrieg beispielsweise. Es wurde weniger Show um ein exotisches Volk gemacht, sondern man wurde mit nützlichen Tatsachen konfrontiert. Außerdem räumte das Museum mit einigen Mythen auf, die gerne noch in Umlauf waren, wie beispielsweise vom pazifistischen Urvolk, das vor den Maori in Neuseeland beheimatet gewesen sein soll und von ihnen ausgerottet wurde. Mittlerweile sind sich die Wissenschaftler sicher, dass es so ein Volk nie gab. Dennoch hält sich die Idee davon bis heute in Neuseeland.
Davon abgesehen gab es eine Ausstellung zum Thema Antarktis und Expeditionen zum Südpol. Es wurden Ausrüstungsgegenstände und Kleidungsstücke verschiedener Epochen und Teams vorgestellt sowie die Bedeutung der Reise zum Südpol für die Neuseeländer.
Natürlich kam man nicht um einen Raum mit verschiedenen Vögeln – einheimischen wie weit entfernt lebenden – herum. Es gab dort unter anderem Kiwis, Keas, Kakapos und australische Elstern zu sehen. Man konnte sogar den Gesang einiger ausgewählter Exemplare hören – auf Tonband versteht sich.
Ein Projekt beschäftigte sich damit, ein ganzes Haus, das aufgrund starker Strukturschäden unbewohnbar gemacht wurde, zu recyceln. Vom Dach bis zum Fußboden hatte man das Haus sorgsam auseinandergenommen, um die Einzelteile zu etwas Anderem zu machen. Tief in jedem Neuseeländer schlummert ein Bastler, der nur auf so eine Gelegenheit wartet. Kein Wunder, dass sie mit dem Konzept von IKEA nichts anfangen können. Ich gebe gerne zu, dass einige der entstandenen Gegenstände sehr schön und brauchbar waren. Anderen Sachen würde ich aber trotz Umwandlung noch immer das Siegel „Müll“ aufkleben. Die Idee hinter dem Projekt war den Leuten zu zeigen, wie sie Abfall vermeiden können, indem sie über die Weiterverwendung von allen möglichen Gebrauchsgegenständen nachdenken, auch wenn diese ihren eigentlichen Zweck nicht mehr erfüllen. Es ist die neuseeländische Art, ihr „grünes“ Image aufrecht zu erhalten. Manchmal habe ich den Eindruck, dass sie den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen.
Ein anderer Ausstellungsraum zeigte das Haus eines Ehepaares – beide mittlerweile verstorben –, das schon zu Lebzeiten für Aufsehen in Canterbury gesorgt hatte. Der Ehemann sammelte Paua-Muscheln am Strand, polierte diese und ließ sie überall liegen. Seine Frau, die als gute Ehefrau das Haus sauber halten wollte, stand also vor dem Problem, diese schön glänzenden Muscheln irgendwie aus dem Weg zu räumen, ohne sich ihrer zu entledigen. Sie kam auf die Idee, die vereinzelt herangeschleppten Muscheln an die Wand zu nageln, um auf dem Boden und den Möbeln Platz zu haben. Das ganze Gesammle artete so weit aus, dass letzten Endes alle vier Wände des Wohnzimmers mit diesen Muscheln bedeckt waren – und das Ehepaar dadurch einen gewissen lokalen Berühmtheitsgrad erreichte. Dieses Wohnzimmer stand nun im Museum zur Besichtigung bereit.

Man konnte sich auch einen kurzen Film über das Ehepaar und ihre Sammelleidenschaft ansehen, was wir uns selbstverständlich nicht entgehen ließen.
Es gab eine große Fotoausstellung zum Thema Spinnen. Die Bilder zeigten die Achtbeier aus ganz anderen Winkeln. Es gab viele Nahaufnahmen, weil die Biester nun einmal recht klein sind. Oder der Fotograf hob nur einzelne Körperteile, wie beispielsweise die Augen, hervor, um den Besuchern ein anderes Verständnis für diese Kreaturen zu ermöglichen.
Besonders gut hat uns beiden eine Straße gefallen, die das Leben Anfang des letzten Jahrhunderts möglichst genau nachstellen sollte. Es gab Geschäfte verschiedener Art, Figuren, die ihre Lebensgeschichte erzählten, ein Hochrad, auf dem man posieren konnte, und vieles mehr.

Zwar hat es diese Straße so niemals in Christchurch gegeben, aber sie war eine Ansammlung verschiedener Ecken, die mal auf diese oder ähnliche Weise in der Stadt verteilt waren. Es war sehr überzeugend.
Das sollte hier nur einem kurzen Überblick dienen. Es ist ein schönes Museum, das man sich gerne ansehen kann, wenn man schon in Christchurch ist.
Erschrocken stellten wir fest, dass das Museum schon um 17 Uhr schloss. Es ergab sich, dass wir fast bis zum Ende der Öffnungszeit im Gebäude verweilten, weil es einfach so viel zu sehen, zu lesen und zu erfahren gab. Dann wollten wir uns auf den Weg machen, um noch einige Kleinigkeiten an Souvenirs zu ergattern. Wir waren allerdings noch weit mehr erschrocken, als uns bewusst wurde, dass die Geschäfte bereits um 17:30 Uhr schlossen. Glücklicherweise war es Winter, es war also schon dunkel, so dass wir ein bisschen mehr Verständnis für die Bevölkerung aufbrachten, die hier anscheinend mit den Hühnern schlafen ging. So eilten wir von einem Geschäft ins andere, konnten aber partout nichts finden, das Franziska in irgendeiner Weise angesprochen hätte. Verständlich, denn mir gefiel auch nichts in den Läden. Danach wollten wir uns noch ein Abendessen gönnen, was allerdings auch mit Komplikationen verbunden war. Es kam das Problem auf, dass die Geschäfte zwar um 17:30 schlossen, die Restaurants aber erst um 18 Uhr öffneten. Wer macht bitte so einen Blödsinn?
Also tigerten wir eine halbe Stunde durch die wie ausgestorben wirkenden Straßen dieser „Großstadt“. Überall um uns herum war es still – außer auf den Baustellen, auf denen immer noch reger Betrieb herrschte. Die meisten Leute saßen irgendwo auf den Hauptverbindungsstraßen in ihren Autos, um möglichst zügig nach Hause zu kommen. Es war sehr langweilig, und da wir beide hungrig waren, knurrten wir mit unseren Magen um die Wette. Hilarys Aussage bezüglich der Größe von Christchurch kam uns in diesem Moment äußerst absurd vor.
Endlich war es so weit. Kaum hatte der Japaner, den wir für unser Mahl ausgewählt hatten, das Schild auf „offen“ gedreht, stürmten wir hinein. Meine Wenigkeit bestellte sich Tempura und ward enttäuscht. Die Portion war winzig und ohne Reis. Den hätte man separat dazu bestellen müssen, was ich schlicht unverschämt fand. Außerdem war es geschmacklich kein vortreffliches Erlebnis. Für den Preis hätte ich mehr erwartet. Da ich noch nicht ganz satt war, holte ich mir einen mächtigen Nachtisch – in einem anderen Restaurant – bestehend aus einem schokoladigen Schokokuchen mit Schokolade. Dieser war einfach nur köstlich.
Bei der Gelegenheit, also während unseres Abendessens, sahen wir auch die Straßenbahn in Christchurch, die durch die Halle fuhr, in der das Restaurant war. Es gab zwar überall Warnschilder, aber keine Absperrungen oder Ampeln mit Fußgängerüberwegen, so dass man tatsächlich eigenverantwortlich die Straße überqueren musste. Nachdem wir mehrere Baustellenschilder gesehen hatten, die uns lautstark darüber in Kenntnis setzten, dass wir die größte Gefahr waren, war das schon eine Überraschung, ja, ein Widerspruch in der neuseeländischen Mentalität.
Oh, noch einige Worte zu unserer Herberge. Wie bereits erwähnt, war sie top. Die Böden in den Zimmern waren mal nicht mit Teppichboden, sondern mit Holzdielen ausgelegt; das Personal war richtig freundlich und hilfsbereit; die Betten gemütlich und jedes hatte sein eigenes Nachtlicht; die Räumlichkeiten sauber und stylisch. Auch wenn es keine Heizungen in den Zimmern gab, sorgte die Herberge mit reichlich Extradecken und Wärmflaschen vor. Außerdem hielt sich die Wärme irgendwie in den Zimmern. Vielleicht gab es ein verstecktes Heizsystem. Die Toiletten waren gewöhnungsbedürftig, da sie nicht nur klein waren, sondern auch auf einer Stufe standen, so dass man aus der Kabine polterte, wenn man selbige verließ. Besonders lustig war aber die Tatsache, dass das Hostel Jailhouse Accommodation hieß und in einem ehemaligen Gefängnis untergebracht war. Entsprechend waren die Wände auch ausnahmsweise mal aus solidem Stein gebaut. Allein für diese einmalige Location gab es von uns die volle Punktzahl.

Sogar im Hostel gab es einige Sehenswürdigkeiten: Die Zelle 20 war nicht renoviert worden, so dass man an den Wänden noch immer die Malereien und Zeichnungen der letzten Insassen bestaunen konnte. Eine andere Zelle, Nr. 1, zeigte einige Gebrauchsgegenstände des Gefängnisses, wie sie zu verschiedenen Zeiten der Nutzung üblich waren. Vom oberen Balkon hatte man eine phantastische Sicht auf die innere Struktur des ganzen Gebäudes. (Siehe Foto oben.) Im Eingangsbereich hing eine Tafel, die drei Dinge aufzählte, die man während des Aufenthalts „im Gefängnis“ unbedingt machen musste. Wir schafften alle drei, was auch nicht schwierig war: 1. Verkleiden und Fahndungsfoto machen; 2. Sehen, wo die Sträflinge wohnten – Originalzelle 20 besuchen; 3. In den Wachturm gehen, das ganze Gefängnis überlicken.

Besonders lustig fand ich, dass ein ehemaliges Gefängnis einen bio fair trade Kaffee verkaufte, der Jail Breaker hieß.
Frühstück gab es um die Ecke und für einen Tag lohnten sich große Einkäufe nicht, so dass wir es uns im Café gemütlich machten. Es gab Bagles mit sehr schmackhaftem Belag und hervorragenden Tee. So kann ein Tag doch beginnen.
Unser Flug ging erst spät am Nachmittag, so dass wir vormittags noch ein bisschen Zeit hatten, die Stadt unsicher zu machen. Wir gingen wieder auf Souvenirjagd, diesmal aber mit genaueren Instruktionen von den Herbergsmitarbeitern. Auf diese Art fanden wir RE:Start, eine Ansammlung von Geschäften in Schiffscontainern, die die vom Erdbeben zerstörte Arkade ersetzen sollte. Ob das eine vorübergehende Lösung war oder dieses Arrangement dauerhaft beibehalten werden sollte, weiß ich nicht. Jedenfalls gab es dort alle Arten von Geschäften, ob es nun um Kleidung, Souvenirs, Lebensmittel oder Papierwaren ging, alles war zu finden. Wir irrten durch die verschiedenen Geschäfte, bis Franziska endlich ihre Souvenirs gefunden hatte. Es war gar nicht so einfach. Dann beschlossen wir noch einen Happen zu essen, entschieden uns erst für einige Maultaschen, die mich allerdings nicht so überzeugten. Es war nicht nur zu wenig, sondern auch vom Geschmack her nicht das Größte. Also holten wir uns noch ein zweites, kleines Mahl. Ich hätte nie gedacht, dass ich die beste Pizza seit Monaten in Christchurch essen würde. Sie war so knusprig, und gut belegt, und lecker (ja gut, es fehlte Salz aber da war das einzige Manko), und überwältigend. Das teilten wir auch gerne den jungen Pizzabäckern mit, die sich über das Lob sichtlich freuten.
In einem der Geschäfte hatten wir einige Tipps zu Sehenswürdigkeiten in der Nähe bekommen, also zogen wir los. Da gab es die neue Kathedrale, die nach dem Erdbeben aus Pappkartons aufgebaut worden war. Sie hatte bunte Fenster und war mittlerweile so etwas wie eine Ikone Christchurchs.

Die alte, steinerne Kathedrale war beim Beben stark beschädigt worden, aber die Kommune diskutierte bis heute, ob man das Haus renovieren oder abreißen sollte. Für Besucher war diese Kirche nicht zugänglich und von außen sah man sehr wenig, weil alles mit Zäunen zugestellt war.
Da war unsere Zeit auch schon abgelaufen, weshalb wir uns auf den Weg zurück zur Herberge machten, um unseren Flug nach Sydney zu erwischen.
Morgen gibt es eine außergewöhnliche Aktualisierung.

Fangen wir am Anfang an.
Hilary und Collin waren so freundlich uns nach Christchurch zu bringen, da sie eh beide noch andere Geschäfte in der Stadt zu erledigen hatten. Es war also alles andere als eine Bürde für sie. Sie setzten uns vor unserer Herberge ab und damit trennten sich unsere Wege.
Kaum dass wir unser Gepäck abgeladen hatten, zogen wir auch schon los die Stadt unsicher zu machen. Zielstrebig und mit einer Stadtkarte bewaffnet, stapften wir die Straßen dieser „Großstadt“ entlang. Vorbei ging es an mehrspurigen Straßen, Ampeln, viel genutzten Parklandschaften, Flüsschen und Bächen, der i-Site, bis wir ankamen, wo wir sein wollten. So viel Verkehr, so viele Menschen, waren wir ja gar nicht mehr gewohnt. Es war fast schon turbulent in dieser Metropole. Ja, der „Zivilisationsschock“ traf uns immer wieder aufs neue in diesem Inselstaat.
Unser erstes Ziel war das Canterbury Museum, das man sich kostenlos ansehen durfte.

Ja, es war besser als Te Papa. Wir erfuhren einiges über die Geschichte der Maori, über die Besiedlung der Region, über das Leben in Christchurch und wie es sich im Laufe der Jahre verändert hatte, aber auch über die Folgen des großen Erdbebens vor einigen Jahren.
Endlich gab es Informationen über die Eingliederung der Maori in die europäische Gesellschaft, über die ersten Maori-Soldaten im Ersten Weltkrieg beispielsweise. Es wurde weniger Show um ein exotisches Volk gemacht, sondern man wurde mit nützlichen Tatsachen konfrontiert. Außerdem räumte das Museum mit einigen Mythen auf, die gerne noch in Umlauf waren, wie beispielsweise vom pazifistischen Urvolk, das vor den Maori in Neuseeland beheimatet gewesen sein soll und von ihnen ausgerottet wurde. Mittlerweile sind sich die Wissenschaftler sicher, dass es so ein Volk nie gab. Dennoch hält sich die Idee davon bis heute in Neuseeland.
Davon abgesehen gab es eine Ausstellung zum Thema Antarktis und Expeditionen zum Südpol. Es wurden Ausrüstungsgegenstände und Kleidungsstücke verschiedener Epochen und Teams vorgestellt sowie die Bedeutung der Reise zum Südpol für die Neuseeländer.
Natürlich kam man nicht um einen Raum mit verschiedenen Vögeln – einheimischen wie weit entfernt lebenden – herum. Es gab dort unter anderem Kiwis, Keas, Kakapos und australische Elstern zu sehen. Man konnte sogar den Gesang einiger ausgewählter Exemplare hören – auf Tonband versteht sich.
Ein Projekt beschäftigte sich damit, ein ganzes Haus, das aufgrund starker Strukturschäden unbewohnbar gemacht wurde, zu recyceln. Vom Dach bis zum Fußboden hatte man das Haus sorgsam auseinandergenommen, um die Einzelteile zu etwas Anderem zu machen. Tief in jedem Neuseeländer schlummert ein Bastler, der nur auf so eine Gelegenheit wartet. Kein Wunder, dass sie mit dem Konzept von IKEA nichts anfangen können. Ich gebe gerne zu, dass einige der entstandenen Gegenstände sehr schön und brauchbar waren. Anderen Sachen würde ich aber trotz Umwandlung noch immer das Siegel „Müll“ aufkleben. Die Idee hinter dem Projekt war den Leuten zu zeigen, wie sie Abfall vermeiden können, indem sie über die Weiterverwendung von allen möglichen Gebrauchsgegenständen nachdenken, auch wenn diese ihren eigentlichen Zweck nicht mehr erfüllen. Es ist die neuseeländische Art, ihr „grünes“ Image aufrecht zu erhalten. Manchmal habe ich den Eindruck, dass sie den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen.
Ein anderer Ausstellungsraum zeigte das Haus eines Ehepaares – beide mittlerweile verstorben –, das schon zu Lebzeiten für Aufsehen in Canterbury gesorgt hatte. Der Ehemann sammelte Paua-Muscheln am Strand, polierte diese und ließ sie überall liegen. Seine Frau, die als gute Ehefrau das Haus sauber halten wollte, stand also vor dem Problem, diese schön glänzenden Muscheln irgendwie aus dem Weg zu räumen, ohne sich ihrer zu entledigen. Sie kam auf die Idee, die vereinzelt herangeschleppten Muscheln an die Wand zu nageln, um auf dem Boden und den Möbeln Platz zu haben. Das ganze Gesammle artete so weit aus, dass letzten Endes alle vier Wände des Wohnzimmers mit diesen Muscheln bedeckt waren – und das Ehepaar dadurch einen gewissen lokalen Berühmtheitsgrad erreichte. Dieses Wohnzimmer stand nun im Museum zur Besichtigung bereit.

Man konnte sich auch einen kurzen Film über das Ehepaar und ihre Sammelleidenschaft ansehen, was wir uns selbstverständlich nicht entgehen ließen.
Es gab eine große Fotoausstellung zum Thema Spinnen. Die Bilder zeigten die Achtbeier aus ganz anderen Winkeln. Es gab viele Nahaufnahmen, weil die Biester nun einmal recht klein sind. Oder der Fotograf hob nur einzelne Körperteile, wie beispielsweise die Augen, hervor, um den Besuchern ein anderes Verständnis für diese Kreaturen zu ermöglichen.
Besonders gut hat uns beiden eine Straße gefallen, die das Leben Anfang des letzten Jahrhunderts möglichst genau nachstellen sollte. Es gab Geschäfte verschiedener Art, Figuren, die ihre Lebensgeschichte erzählten, ein Hochrad, auf dem man posieren konnte, und vieles mehr.

Zwar hat es diese Straße so niemals in Christchurch gegeben, aber sie war eine Ansammlung verschiedener Ecken, die mal auf diese oder ähnliche Weise in der Stadt verteilt waren. Es war sehr überzeugend.
Das sollte hier nur einem kurzen Überblick dienen. Es ist ein schönes Museum, das man sich gerne ansehen kann, wenn man schon in Christchurch ist.
Erschrocken stellten wir fest, dass das Museum schon um 17 Uhr schloss. Es ergab sich, dass wir fast bis zum Ende der Öffnungszeit im Gebäude verweilten, weil es einfach so viel zu sehen, zu lesen und zu erfahren gab. Dann wollten wir uns auf den Weg machen, um noch einige Kleinigkeiten an Souvenirs zu ergattern. Wir waren allerdings noch weit mehr erschrocken, als uns bewusst wurde, dass die Geschäfte bereits um 17:30 Uhr schlossen. Glücklicherweise war es Winter, es war also schon dunkel, so dass wir ein bisschen mehr Verständnis für die Bevölkerung aufbrachten, die hier anscheinend mit den Hühnern schlafen ging. So eilten wir von einem Geschäft ins andere, konnten aber partout nichts finden, das Franziska in irgendeiner Weise angesprochen hätte. Verständlich, denn mir gefiel auch nichts in den Läden. Danach wollten wir uns noch ein Abendessen gönnen, was allerdings auch mit Komplikationen verbunden war. Es kam das Problem auf, dass die Geschäfte zwar um 17:30 schlossen, die Restaurants aber erst um 18 Uhr öffneten. Wer macht bitte so einen Blödsinn?
Also tigerten wir eine halbe Stunde durch die wie ausgestorben wirkenden Straßen dieser „Großstadt“. Überall um uns herum war es still – außer auf den Baustellen, auf denen immer noch reger Betrieb herrschte. Die meisten Leute saßen irgendwo auf den Hauptverbindungsstraßen in ihren Autos, um möglichst zügig nach Hause zu kommen. Es war sehr langweilig, und da wir beide hungrig waren, knurrten wir mit unseren Magen um die Wette. Hilarys Aussage bezüglich der Größe von Christchurch kam uns in diesem Moment äußerst absurd vor.
Endlich war es so weit. Kaum hatte der Japaner, den wir für unser Mahl ausgewählt hatten, das Schild auf „offen“ gedreht, stürmten wir hinein. Meine Wenigkeit bestellte sich Tempura und ward enttäuscht. Die Portion war winzig und ohne Reis. Den hätte man separat dazu bestellen müssen, was ich schlicht unverschämt fand. Außerdem war es geschmacklich kein vortreffliches Erlebnis. Für den Preis hätte ich mehr erwartet. Da ich noch nicht ganz satt war, holte ich mir einen mächtigen Nachtisch – in einem anderen Restaurant – bestehend aus einem schokoladigen Schokokuchen mit Schokolade. Dieser war einfach nur köstlich.
Bei der Gelegenheit, also während unseres Abendessens, sahen wir auch die Straßenbahn in Christchurch, die durch die Halle fuhr, in der das Restaurant war. Es gab zwar überall Warnschilder, aber keine Absperrungen oder Ampeln mit Fußgängerüberwegen, so dass man tatsächlich eigenverantwortlich die Straße überqueren musste. Nachdem wir mehrere Baustellenschilder gesehen hatten, die uns lautstark darüber in Kenntnis setzten, dass wir die größte Gefahr waren, war das schon eine Überraschung, ja, ein Widerspruch in der neuseeländischen Mentalität.
Oh, noch einige Worte zu unserer Herberge. Wie bereits erwähnt, war sie top. Die Böden in den Zimmern waren mal nicht mit Teppichboden, sondern mit Holzdielen ausgelegt; das Personal war richtig freundlich und hilfsbereit; die Betten gemütlich und jedes hatte sein eigenes Nachtlicht; die Räumlichkeiten sauber und stylisch. Auch wenn es keine Heizungen in den Zimmern gab, sorgte die Herberge mit reichlich Extradecken und Wärmflaschen vor. Außerdem hielt sich die Wärme irgendwie in den Zimmern. Vielleicht gab es ein verstecktes Heizsystem. Die Toiletten waren gewöhnungsbedürftig, da sie nicht nur klein waren, sondern auch auf einer Stufe standen, so dass man aus der Kabine polterte, wenn man selbige verließ. Besonders lustig war aber die Tatsache, dass das Hostel Jailhouse Accommodation hieß und in einem ehemaligen Gefängnis untergebracht war. Entsprechend waren die Wände auch ausnahmsweise mal aus solidem Stein gebaut. Allein für diese einmalige Location gab es von uns die volle Punktzahl.

Sogar im Hostel gab es einige Sehenswürdigkeiten: Die Zelle 20 war nicht renoviert worden, so dass man an den Wänden noch immer die Malereien und Zeichnungen der letzten Insassen bestaunen konnte. Eine andere Zelle, Nr. 1, zeigte einige Gebrauchsgegenstände des Gefängnisses, wie sie zu verschiedenen Zeiten der Nutzung üblich waren. Vom oberen Balkon hatte man eine phantastische Sicht auf die innere Struktur des ganzen Gebäudes. (Siehe Foto oben.) Im Eingangsbereich hing eine Tafel, die drei Dinge aufzählte, die man während des Aufenthalts „im Gefängnis“ unbedingt machen musste. Wir schafften alle drei, was auch nicht schwierig war: 1. Verkleiden und Fahndungsfoto machen; 2. Sehen, wo die Sträflinge wohnten – Originalzelle 20 besuchen; 3. In den Wachturm gehen, das ganze Gefängnis überlicken.

Besonders lustig fand ich, dass ein ehemaliges Gefängnis einen bio fair trade Kaffee verkaufte, der Jail Breaker hieß.
Frühstück gab es um die Ecke und für einen Tag lohnten sich große Einkäufe nicht, so dass wir es uns im Café gemütlich machten. Es gab Bagles mit sehr schmackhaftem Belag und hervorragenden Tee. So kann ein Tag doch beginnen.
Unser Flug ging erst spät am Nachmittag, so dass wir vormittags noch ein bisschen Zeit hatten, die Stadt unsicher zu machen. Wir gingen wieder auf Souvenirjagd, diesmal aber mit genaueren Instruktionen von den Herbergsmitarbeitern. Auf diese Art fanden wir RE:Start, eine Ansammlung von Geschäften in Schiffscontainern, die die vom Erdbeben zerstörte Arkade ersetzen sollte. Ob das eine vorübergehende Lösung war oder dieses Arrangement dauerhaft beibehalten werden sollte, weiß ich nicht. Jedenfalls gab es dort alle Arten von Geschäften, ob es nun um Kleidung, Souvenirs, Lebensmittel oder Papierwaren ging, alles war zu finden. Wir irrten durch die verschiedenen Geschäfte, bis Franziska endlich ihre Souvenirs gefunden hatte. Es war gar nicht so einfach. Dann beschlossen wir noch einen Happen zu essen, entschieden uns erst für einige Maultaschen, die mich allerdings nicht so überzeugten. Es war nicht nur zu wenig, sondern auch vom Geschmack her nicht das Größte. Also holten wir uns noch ein zweites, kleines Mahl. Ich hätte nie gedacht, dass ich die beste Pizza seit Monaten in Christchurch essen würde. Sie war so knusprig, und gut belegt, und lecker (ja gut, es fehlte Salz aber da war das einzige Manko), und überwältigend. Das teilten wir auch gerne den jungen Pizzabäckern mit, die sich über das Lob sichtlich freuten.
In einem der Geschäfte hatten wir einige Tipps zu Sehenswürdigkeiten in der Nähe bekommen, also zogen wir los. Da gab es die neue Kathedrale, die nach dem Erdbeben aus Pappkartons aufgebaut worden war. Sie hatte bunte Fenster und war mittlerweile so etwas wie eine Ikone Christchurchs.

Die alte, steinerne Kathedrale war beim Beben stark beschädigt worden, aber die Kommune diskutierte bis heute, ob man das Haus renovieren oder abreißen sollte. Für Besucher war diese Kirche nicht zugänglich und von außen sah man sehr wenig, weil alles mit Zäunen zugestellt war.
Da war unsere Zeit auch schon abgelaufen, weshalb wir uns auf den Weg zurück zur Herberge machten, um unseren Flug nach Sydney zu erwischen.
Morgen gibt es eine außergewöhnliche Aktualisierung.
... link (0 Kommentare) ... comment
Sonntag, 9. August 2015
Darfield – Mai - Juni 2015
atimos, 02:33h
Der Titel für dieses kleine Abenteuer lautet:
Broom behind the House
Eine Erklärung dazu folgt im Laufe des Berichtes
Dieses Mal nahmen wir eine andere Route, die Summit Road, die über die Berggipfel der Banks Halbinsel führte und dank des Wetters eine hervorragende Aussicht auf die Bucht lieferte. Es war ein schwieriger Aufstieg für unser kleines Gefährt, aber endlich schafften wir es oben anzukommen, und so genossen wir das prachtvolle Bild, das sich um uns herum erstreckte. Links und rechts lagen die Berge gewellt unter uns, links und rechts erstreckte sich ein Teil des Pazifiks, irgendwo unter uns befanden sich die Highlands Neuseelands – oder der Teil, den wir selbst so genannt hatten. Es war atemberaubend. Die Strecke zog und zog sich, doch sie war jeden Meter wert, denn wir hielten sehr oft, um diese einmalige Landschaft zu fotographieren. Es war kaum zu glauben, was um uns herum lag. Da wir es überhaupt nicht eilig hatten, nahmen wir uns die Zeit für eine Pause hier und einen stillen Moment dort.

Die Ankunft in Christchurch war offensichtlich. Der Verkehr nahm zu, die Häuser standen dichter beieinander, es gab wesentlich mehr Passanten, Geschäfte, Straßen und was sonst noch zu so einer Stadt gehört. Es gab Ampeln – wir hatten schon lange keine mehr gesehen. Nach einigem hin und her fanden wir die Geschäftsstelle von ACE, gaben unser Auto mit einer Träne im Augenwinkel ab, hörten von der Inspektion, dass alles perfekt war, und machten uns wieder auf den Weg anderswohin. Von unserem nächsten Gastgeber hatten wir erfahren, dass es einen Bus gibt, der von Christchurch nach Darfield fährt, wo wir abgeholt werden könnten. Zu diesem Zweck begaben wir uns zur Central Station, an der dieser Bus laut Internet abfahren sollte. Unterwegs begriffen wir, warum Christchurch immer noch als große Baustelle bezeichnet wird: Die Spuren des großen Erdbebens von vor drei Jahren waren immer noch nicht restlos beseitigt. Tatsächlich standen viele Gebäude noch, waren aber verlassen und verbarrikadiert, weil sie stark einsturzgefährdet waren. Daneben fand man Baustellen, auf denen Häuser entweder neu errichtet wurden oder gerade im Begriff waren abgerissen zu werden.
Auch die Central Station war ganz neu, so neu, dass man sie erst vier Tage zuvor eröffnet hatte. Alles in allem war die neue Central Station wie ein Flughafen aufgebaut: Es gab Gateways für Busse, eine riesige, mit Glas verkleidete Halle für wartende Fahrgäste und im noch nicht fertigen Teil sollte Ende des Jahres eine Mall mit verschiedenen Geschäften eröffnet werden. Wir fragten uns ernsthaft, wozu die Stadt solch einen riesigen Busbahnhof brauchte. Der Neubau führte zu gewissen Schwierigkeiten, was die Verkehrslage betraf, da zudem viele Buslinien eine neue Route fuhren und das Personal nicht genau wusste, welche Linie wo abfuhr. Man hatte zusätzliches Personal eingestellt, das die Übergangsphase so reibungslos wie möglich gestalten sollte, aber dennoch konnte uns die Dame am Schalter nicht helfen, wo wir nun unseren Bus nach Darfield finden würden. Stattdessen schickte sie uns zur nächsten i-Site, die neben dem Museum war. Wir waren verwirrt, da wir bereits an der i-Site vorbeigefahren waren, zeigten ihr den Plan, den wir aus dem Internet hatten, fügten uns aber dann ihrem Ratschlag und stiegen in den nächsten Bus zurück.
In der i-Site angekommen, fragte man uns verwirrt, warum wir da waren, da der Bus doch offensichtlich von der Central Station abführe. Das Gemeine an neuseeländischem Personal ist, dass man keine Gelegenheit bekommt, sich über die Leute aufzuregen. Sie bleiben freundlich, hilfsbereit und verständnisvoll. Die Dame in der i-Site sorgte sogar dafür, dass die Dame in der Central Station dafür zurechtgewiesen wurde, dass sie uns unnötigerweise quer durch die Stadt schickte. Außerdem rief sie für uns beim Busunternehmen an, um zu erfragen, wo genau der Bus nach Darfield abfuhr. Mit diesen Daten gewappnet, marschierten wir zurück zur Central Station. Es war ein angenehmer Spaziergang von gerade einmal 15 Minuten – mit Gepäck auf dem Rücken. Das machte uns mittlerweile recht wenig aus.
Wir saßen also wieder in der Central Station, teilten einem Helfer in orangefarbener Warnweste mit, wo der Bus abfuhr und unterhielten uns mit diesem freundlichen Engländer für einige Zeit. Dann brachen wir nach Darfield auf.
Die Fahrt dauerte ungefähr eine Stunde, was hauptsächlich am Feierabendverkehr lag. Als wir endlich ankamen, begrüßte uns Hilary sehr herzlich und nahm uns in ihrem Toyota mit. Darfield war nämlich nicht unsere Endhaltestelle; die Gastfamilie lebte auf einer Farm eine halbe Stunde von jeglicher Zivilisation entfernt – mal wieder. In einer vorhergehenden Mail hatte Hilary uns schon gewarnt, dass es keinen Handyempfang geben würde, aber sie hatten Internet, wenn man nicht zu viel davon und kein zu schnelles erwartete. Zumindest für die grundlegende Kommunikation würde es ausreichen.
Da wir im Dunkeln ankamen, konnten wir uns kein Bild vom Äußeren des Hauses machen. Von Innen sah es wie ein Labyrinth aus. Als wir rein kamen, standen wir in einer Ecke des korridorartigen Flures, der links und rechts abbog. Wir sollten rechts runter gehen, dann rechts abbiegen, sofort links, bis zum Ende des Gangs, wo unser geräumiges Zimmer mit angrenzendem Bad für uns bereit stand. Als Heizung diente ein kleines Heißluftgebläse, das mich an kommunistische Zeiten erinnerte. Damit uns aber auf keinen Fall kalt wurde, fanden sich in den Betten Heizdecken. Es war zumindest etwas, auch wenn es mich immer wieder überrascht, dass Neuseeländer keine Heizungen fest in ihren Häusern montiert haben.
Um in die Küche zu gelangen, mussten wir durch den Gang, am Ende davon rechts und sofort links, geradeaus den Gang runter bis zum Ende, dann rechts und geradeaus durch die Schiebetür. Das war die Strecke, die wir täglich zurücklegten – die anderen Flügel des Hauses betraten wir eher selten bis nie. Allgemein war das Gebäude wir ein Z mit einigen Abzweigungen geformt, so dass man sich gut und gerne darin verlaufen konnte, ohne irgendwelche bösen Absichten zu verfolgen. Es war jedoch nicht so schlimm, da man im Zweifelsfall immer einen der zwölf Ausgänge nehmen konnte, um das Haus zu umrunden und dann wieder durch den Haupteingang einzutreten.
Bei einer sich bietenden Gelegenheit spazierten wir in den Flügel des Hauses, in dem das eigentliche Esszimmer an das eigentliche Wohnzimmer grenzte. Das Wort opulent beschreibt diese beiden Räume im viktorianischen Kolonialstil äußerst passend. Farbenpracht, Dekoration, hohe Decken, Staub. Wir verstanden, warum die Familie lieber die große Wohnküche nutzte. Sie war einfach wohnlicher.
Am Abend unserer Ankunft lernten wir auch Collin kennen, Hilarys Mann.
Nach einem leckeren Abendessen erklärten wir den Tag erst einmal für abgeschlossen und fielen ins Bett. Es war lange überfällig.
Am nächsten Morgen gab es neue Bekanntschaften zu schließen, denn die kleine Flossie, Enkeltochter von Hilary und Collin, ihre Nanny Amy sowie der Hund von Hilarys und Collins Tochter, Rola, waren gerade zu Besuch. Abends kam noch der Sohn der Familie, Andrew, hinzu. Nachdem alles geklärt war, konnten wir uns auch schon an die Arbeit machen – es gab schließlich genug zu tun.
Zum Haus gehörte auch ein Pool, dessen Umrandung durch das Erdbeben ein bisschen Schaden genommen hatte und ausgebessert worden war. Allerdings gab es noch Kleinigkeiten, die abgeändert werden mussten: Zement sollte von Steinen geschleift werden, auf die er nicht gehörte. An diesem Tag wurde mir die einmalige Möglichkeit geboten, den Bildhauer in mir zu entdecken. Ich klopfte auf Stein, ich schleifte, klopfte weiter, suchte und fand, dass ich nicht dazu geschaffen bin. An manchen Stellen fiel es mir schwer zu unterscheiden, wo der Zement aufhörte und der Stein anfing. So gerne ich mich handwerklich betätige, daraus wird nichts. Da uns nach einiger Zeit so langsam alle Gliedmaßen abfroren – immerhin hatten wir Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt –, gingen wir zeitig wieder rein und suchten uns eine andere Tätigkeit drinnen. Da gab es allerdings wenig zu tun, außer man beschäftigte sich mit Flossie, die selbstverständlich immer gerne im Mittelpunkt des Geschehens stand.
Amy fand eine Liste, die Hilary geschrieben hatte, doch auch sie wurde nicht schlau daraus, was wir nun wie machen sollten. Außerdem bezogen sich die meisten Arbeiten auf Tätigkeiten unter freiem Himmel, was aus gesundheitlichen Gründen erst einmal hinten angestellt wurde.
Am nächsten Morgen erfuhren wir dann auch, was es mit dem Punkt „broom behind the house“ auf sich hatte. Auf den ersten Blick ist an dieser Aufgabe nicht viel dran, was aber nur daran liegt, dass wir zu diesem Zeitpunkt nicht wussten, dass das englische Wort broom doppelt belegt ist. Wir gingen von der allgemein bekannten Bedeutung aus: broom = Besen, to broom = kehren, die ganze Aussage = hinter dem Haus kehren. Leider meinte Hilary etwas ganz anderes damit. Broom kann nämlich auch mit Ginster übersetzt werden.
Unsere Gastmutter bat uns darum, den Ginstersträuchern in einem kleinen Areal hinter dem Haus den Garaus zu machen. Auch den Begriff „kleines Areal“ möchte ich hier in Anführungsstriche setzen, weil es relativ gesehen werden muss. Im Vergleich zu den riesigen Landmassen, die diese Familie besitzt, und auch im Verhältnis zu der Fläche, auf der sie Wohnen, war der Bereich klein. Allerdings brauchte man schon mehrere Minuten, um von der Haustür zu Fuß zur Straße zu kommen, obwohl die Ausfahrt gut geebnet war.
Wir bekamen Astschere, Rosenschere und Pflanzengift in die Hand gedrückt, um uns damit an bösartigen Ginstern und Pinien zu schaffen zu machen. Da sowohl Pinien als auch Ginstern hier nicht heimisch sind und keine natürlichen Feinde kennen, durften wir sie wie Unkraut behandeln. So begann ein Tag, an dem wir den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sahen und das Unkraut einfach nur noch grün war. Anfangs waren noch wenige Ginsterbüsche zu sehen und wir kümmerten uns mehr um die Pinien, doch je näher wir der Straße kamen, umso höher und dichter wurde das Buschwerk aus Unkraut. Hinzu kam, dass das Gelände alles andere als eben war; es war mit Holz, toten Bäumen und Ästen, übersät. An manchen Stellen war es eine schiere Herausforderung einfach nur gerade stehen zu bleiben, geschweige denn einige Schritte zu tun, ohne sich die Beine zu brechen. Wir schafften nicht alles an einem Tag. Aber auf diese Weise blieb genug für den nächsten. Außerdem war der Pool noch nicht ganz fertig, so dass wir das noch zu Ende bringen konnten. Wir halfen Hilary auch dabei, ein nahe gelegenes Haus auf Vordermann zu bringen, weil demnächst dort Arbeiter einziehen sollten. Auf dem Land gab es wohl eine erhöhte Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum, aber nur ein geringes Angebot. Vor allem saisonale Arbeitskräfte suchten fertig möblierte Häuser und Wohnungen.
Dies war eine weitere Gelegenheit, bei der Neuseeländer uns mit ihrem Umweltschutzgedanken überraschten. Hilary war stolz darauf, dass es seit 2004 verpflichtend war, doppeltverglaste Fenster in Neubauten einzusetzen. Wir schmunzelten.
Unser Aufenthalt in Darfield bekam den Titel „broom behind the house“, was nicht nur auf das Missverständnis mit broom zurückzuführen ist, sondern auch auf Hilarys und Collins Selbstverständnis von „hinter dem Haus“. Die Neuseeländer mögen es eben ein bisschen größer.
Wir erinnerten uns an diesen Spruch, als unsere Gastmutter uns bat, einige Steine zu sortieren. Bei vorhergehenden Bauarbeiten waren Steine entfernt und aus dem Weg geräumt worden, aber sie würde sie gerne wiederverwenden. Da sie unordentlich auf einem Stapel gekippt worden waren, waren einige zerbrochen, andere heil. Sie bat uns, die ganzen von den fast heilen und den kaputten zu trennen, um sie dann auf Paletten zu stapeln. Wir verstanden „Steine“; Hilary meinte „Steinplatten“.

Collin schätzte jede der Platten auf 25-30 kg. Nach diesem Tag brauchte keine von uns ein Sportprogramm. Und obwohl wir weniger als die vereinbarten vier Stunden an diesem Tag arbeiteten, beschwerte sich niemand, dass wir keinen Finger mehr rührten.
Eine weitere unserer Aufgaben bestand darin, die Küchenschränke von Hilary auszuräumen und zu säubern. Ich habe Verständnis für Leute, die viele Lebensmittel auf einmal kaufen, um nicht täglich in den Supermarkt gehen zu müssen, vor allem wenn sie so weit weg von der nächsten Einkaufsmöglichkeit wohnen. Was wir in den Schränken fanden, war allerdings schon eine Übertreibung. Der Höhepunkt war ein Schokoweihnachtsbäumchen, das im Juli 2004 abgelaufen war. Von diesen kulinarischen Abfallprodukten fanden sich einige, mit dem einzigen Unterschied, dass das Verfallsdatum zwischen 2005 und 2014 liegen konnte. Viele Produkte waren noch nicht einmal angebrochen, und ich frage mich bis heute, wie viele Kilogramm Erdnüsse ein Haushalt braucht. Andere Packungen hingegen waren bereits geöffnet, daneben lag das gleiche Produkt, ebenfalls geöffnet. Franziska machte den Fehler, die Schubladen auch von außen abzuwischen, was dazu führte, dass man ganz deutlich den Unterschied zwischen gereinigt und nicht gereinigt sah. So konnte die Küche auf keinen Fall bleiben, wenn ein Teil einem in strahlendem Weiß entgegen prangerte, während ein anderer eher durch trübes Grau bestach. Dennoch wollte Hilary nicht, dass wir den Rest säuberten. Andere Aufgaben fand sie wichtiger.
An unserem freien Tag nahm unsere Gastmutter uns nach Ashburton mit, ein Städtchen, das ungefähr eine Stunde Fahrt vom Haus der Familie entfernt liegt. Hilary hatte einige Sachen zu erledigen, ließ uns aber die Zeit alleine, damit wir die Stadt unsicher machten. Anstatt ihrem Vorschlag zu folgen und einen Blick in die Kunstgalerie zu werfen, wandten wir unsere Aufmerksamkeit dem Park zu. Aber es galt erst einige Prioritäten abzustecken: Lunch.
Da wir keine Ahnung von den uns umgebenden Cafés hatten und Hilary uns auch keine konkrete Auskunft geben konnte, fragten wir ganz dreist in der i-Site nach einer Empfehlung. Eine Mitarbeiterin schlug ein Café um die Ecke vor, also kehrten wir in den Sumerset Grocer ein. Nach einem schmackhaften Lunch und dem besten Tee seit Monaten ging es weiter zur ANZ-Filiale, um einige Fragen zu klären. Nachdem diese scheinbar beantwortet waren, zogen wir in den Park. Die Sonne schien, es war gerade warm genug für einen Spaziergang und wir wussten genau, wohin wir gehen wollten.
Im Park angekommen fanden wir einen Fitness-Pfad, dem wir spontan folgten, weil er uns auch in die entlegenen Ecken der Grünanlage führte. Außerdem war es lustig, die eine oder andere Übung auch mal auszuprobieren. Die notwendigen Geräte standen gut gepflegt bereit. Ich war überrascht, wie groß der Park war.

Es gab Spielplätze, Sportfelder für verschiedene Sportarten, Teiche, Wiesen, Rosengarten, viele Bäume und was noch dazu gehört. Nach mehr als einer Stunde ziellosen Umherwanderns wandten wir uns wieder dem Zentrum der Stadt zu, um noch einige letzte Eindrücke von neuseeländischen Geschäften in uns aufzunehmen. Außerdem suchte ich noch immer verzweifelt nach einem karierten Heft der Größe DIN A5 (oder so ähnlich). Diese scheinen am anderen Ende der Welt überhaupt nicht geläufig zu sein.
Nachdem alles erledigt war, brachen wir zum Supermarkt auf, an dem wir mit Hilary verabredet waren. Sie hatte allerdings noch einige Einkäufe zu erledigen, und mit „einige“ meine ich „jede Menge“. In Anbetracht der riesigen Vorräte dieser Familie frage ich mich immer noch, was sie noch nicht hatten. Anscheinend fand sich immer noch etwas, das unbedingt mitgenommen werden musste. Kein Wunder, dass so viele Lebensmittel im Haushalt G. schon kurz vor der Volljährigkeit und somit vor dem Einzug in die neuseeländischen Geschichtsbücher standen. Aber anscheinend war es nicht genug auf zwei Eiszeiten vorbereitet zu sein, nein, die dritte könnte auch noch kommen.
Ein weiteres Projekt bestand im Unkrautjähten. Da wir uns darin mittlerweile als Profis betrachteten, ging es recht zügig, zu zügig, wie wir einsahen. Um Hilary nicht auf unangenehme Gedanken zu bringen oder die Erwartungen an uns sowie künftige Helfergenerationen künstlich in die Höhe zu schrauben, atmeten wir tief durch und machten uns wieder an die Arbeit. Diesmal gemächlicher.
Zurück zu dem Thema ANZ: Wir hatten noch jeweils ein hübsches Sümmchen von unserer Arbeit in Franz Josef auf unseren neuseeländischen Konten, allerdings keine Zeit mehr dies in Neuseeland auszugeben. Also wollten wir es auf unsere deutschen Konten überweisen, was von den ANZ-Mitarbeitern immer wieder als besonders einfach dargestellt wurde. Wir hatten fünfmal in fünf verschiedenen ANZ-Filialen gefragt, ob wir nicht eine TAN bräuchten. Ebenso erklärten wir jedes Mal, was wir damit meinten, wie wir es aus Deutschland gewohnt waren. Jedes Mal bekamen wir zur Antwort, dass es ganz einfach in Neuseeland wäre und wir uns keine Sorgen machen müssten. Als wir nun wieder bei Hilary im Wohnzimmer saßen und unsere Überweisung tätigen wollten, kamen wir zur Sicherheitsabfrage, die uns sagte, dass uns eine TAN per SMS zugeschickt werden würde. Ich wiederhole: Wir waren an einem Ort ohne Handyempfang. Diese SMS ist nie bei uns angekommen. Aus diesem Grund möchte ich jedem strengstens davon abraten, ein Konto bei der ANZ aufzumachen. Man bekommt nur häppchenweise Informationen, die sich stellenweise widersprechen, und manchmal bleibt das Wichtigste aus. Das ist kein guter Service.
Hilary bat uns darum, einige alte Tische abzuschleifen und neu zu lackieren, weil sie sie gerne wiederverwenden würde, der Lack aber schon an mehreren Stellen abgesplittert war. Wir sahen keine Möglichkeit, ihre freundliche Bitte als etwas anderes als als Aufforderung zu betrachten, also machten wir uns an die Arbeit. Tim, seit zehn Wochen als Maler und Handwerker für die Familie tätig, hatte eine effiziente Alternative zum Bandschleifer: einen Schaber. Erstaunlicherweise ging es damit schneller als mit einem elektrischen Gerät. Meine Erwartungen an den Bandschleifer sanken aber auch ganz schön tief, als ich las, dass er nur 135 W hatte. Was brauchen wir? Mehr Power! Es blieb dabei, dass unsere Muskeln eine bessere Leistung brachten. Es war auch besser so, weil wir sonst die Tiefkühltruhe hätten ausstöpseln müssen – Mangel an Steckdosen und so.
Es kam der Tag, an dem Hilary einige Gäste empfing und uns aus diesem Grund aus ihrem Haus verbannte. Doch nicht weit entfernt stand eine Winterherberge, die sie oft an Arbeiter in der Nähe oder an zahlende Gäste vermietete. In der Nähe lag eines von Neuseelands Skigebieten. Wir durften also unsere Siebensachen packen und dorthin aufbrechen. Ein neues Abenteuer begann und es überrascht mich bis heute, dass es nicht unser letztes war.
Größtes Manko dieser Behausung – nach neuseeländischen Maßstäben: Es gab keinen Teppichboden. (Für mich ist es einfach erstaunlich, wie weit Neuseeländer ihre Liebe zu diesem Bodenbelag tragen:

In Hilarys Haus lag sogar im Badezimmer ein dicker, flauschiger Teppichboden.)
Diesem Problem begegnete unsere Gastfamilie, indem sie einige Teppiche vor den Kamin legte. Immerhin wollte man so viel Wärme wie möglich innerhalb des Wohnraums behalten, anstatt ihr die symbolischen Türen weit zu öffnen. Der Erfolg dieser Maßnahmen steht noch aus.
Unserer Ansicht nach war das mangelnde Heizsystem allerdings ein viel größeres Problem. Zwar gab es in der Wohnküche einen Kamin, den wir auch brav lange vor Hereinbrechen der Nacht entzündeten und dessen Feuer wir konstant schürten, aber das Ventilationssystem, das die Wärme auf alle Räume verteilen sollte, funktionierte nicht so ganz. Die elektrischen Heizungen in den Zimmern waren mit tickender Zeitschaltuhr versehen, so dass die Räume nicht wirklich warm wurden. Das konnte man allerdings bei den gegebenen Witterungsbedingungen, Minusgraden und Neuschnee, nicht ernsthaft erwarten. Wir entschieden uns spontan dazu, einige Matratzen aus den Schlafräumen in den beheizten Wohnraum zu holen, diese auf dem Boden vor dem Kamin auszubreiten und uns dort zur Nachtruhe zu begeben. Natürlich waren wir uns der Gefahren bewusst, die damit einhergingen, aber als Alternative stand eine schlaflose Nacht wegen abfrierender Gliedmaßen in Aussicht. Auf diese Weise hatte ich zudem meinen Spaß mit dem Feuer zu spielen… ähm, es am Laufen zu halten, damit wir nicht erfroren. Die Faszination des Feuers.

Spannend fand ich auch, dass es keinen Flur gab, der die Räume miteinander verband, sondern dass man über die Veranda von Zimmer zu Zimmer kam, also auch vom Wohnzimmer ins Bad. So kann man auch aus alltäglichen Handlungen, wie beispielsweise einer Dusche, eine Extremsportart machen. Spaßeshalber malte ich mir aus, wie sich einige Skifahrer nach einem langen, kalten Tag dazu aufrafften, ordentlich zu duschen, um dann mit nassen Haaren durch die Kälte in ihre Zimmer zu stolpern.
Immerhin gab es einen Fernseher, der uns lange genug unterhalten konnte, bis es Zeit fürs Bettchen war. Franziska fand Maori Television, einen Sender der Fernsehen von und für Maori anbot. Es war eine seltsame Mischung aus Vertrautem und Fremdem. Besonders erstaunlich war, dass auch die Werbung anders als auf nicht-Maorisendern war. Ich kam nicht umhin, von einer Zwei-Klassen-Gesellschaft zu denken, auch wenn das Programm mehr Unterhaltung als deutsches Fernsehen bot. An diesem Punkt möchte ich jedem Leser die Sendung „Find Me a Maori Bride“ wärmstens ans Herz legen.
Unser Aufenthalt in dieser doch so ramponierten Hütte gab mir allerdings die einzigartige Möglichkeit mit einem nicht für deutsche Straßenverhältnisse zugelassenen Quad durch die Gegend zu düsen. Unsere Gastfamilie besaß so ein Vehikel, das sich durch eine relativ große Ladefläche auszeichnete. Collin zeigte mir, wie man das Fahrzeug bediente, so dass wir den langen Weg von fünfzehn Gehminuten nicht täglich zu Fuß zurücklegen mussten. Wir hatten uns schon daran gewöhnt, dass die Leute uns komisch anguckten, wenn wir ihnen von unserer mangelnden Motorisierung erzählten. Dieses Quad gab mir so manche Mühe, da es einerseits viele Eigenschaften eines Motorrads teilte, dann andererseits doch anders funktionierte. Es gab weder Rückspiegel, noch Blinker, geschweige denn Kupplung, aber dafür mehrere Gänge. Tatsächlich besteht in Neuseeland Helmpflicht für derartige Fahrzeuge, auf dem Land nimmt die Bevölkerung das allerdings, trotz zahlreicher Unfälle mit Todesfolge, nicht so ernst. In Ermangelung von Kopfschutz jedweder Art blieb also auch uns nichts anderes übrig, als auf unsere Fahrkünste zu vertrauen und unseren gesunden Menschenverstand zu benutzen.
Ich nahm mir einige Zeit, mir Gedanken zu diesem Gefährt zu machen, und kam zu dem Schluss, dass ich es nicht mochte. Dafür gab es mehrere Gründe: Schalten war eine Glückssache; der Mangel an Rückspiegeln gefiel mir nicht besonders; aber das unangenehme Gefühl, dass ich in jeder Kurve und bei jeder Steigung – insbesondere in Kurven bei Steigung – fast die Kontrolle über das Vehikel verlor und zu kippen drohte, gab den Ausschlag für meine Aversion ihm gegenüber. Dennoch fuhren wir auf und ab, benutzten es als Lastentransportmittel und drehten auch mal eine Runde zum Vergnügen, weil der Tank gerade voll war. Lustig war, dass wir am ersten Morgen so oder so zu Fuß von der Hütte zum Haupthaus laufen mussten, weil das Gerät bei den nächtlichen Temperaturen eingefroren war. Es war nicht nur kalt, sondern es war mit einer dicken Frostschicht bedeckt. Erst nachdem es einige Stunden in der Sonne gestanden hatte, sprang es auch wieder an.
Obwohl Franziska die ein oder andere Fahrt mit dem Quad wagte, hatte sie ein anderes Fahrzeug zu ihrem neuen Lieblingsspielzeug auserkoren: den Toyota Prado unserer Gastfamilie. Ich würde ja gerne mehr zu diesem Ungetüm schreiben, etwas zum Fahrverhalten, Straßenlage, Handling, etc., aber mir sind die Finger gebunden, da meine Reisebegleitung mich kein einziges Mal ans Steuer ließ, wenn sich die Gelegenheit bot, damit zu fahren. Anfangs war sie noch scheu vor diesem SUV, der größer als ich war, aber schon nach den ersten Metern stand fest, dass ich dieses Fahrzeug nie vom Fahrersitz aus sehen würde. Was ich allerdings auf meiner Beifahrerposition wahrnahm, war, dass man die Geschwindigkeit überhaupt nicht merkte. Selbst über unebene und unbefestigte Straßen glitt dieses Monstrum wie über frisch geschliffenes Eis. Auch die Geräuschkulisse hielt sich in Grenzen. Man hörte weder den Motor rauschen noch die Außengeräusche.
Es ergab sich die Gelegenheit ein Rugby-Spiel live im Fernsehen zu sehen, was wir uns ungern entgehen lassen wollten, da wir es mit eingefleischten Fans gucken konnten, die uns bestimmt gerne die Regeln und das Geschehen auf dem Feld erklären würden. So fuhren wir eines Abends zur Tochter des Hauses, Georgie, die mit ihrem Mann und einigen seiner Freunde schon gespannt auf das Spiel wartete. Das Ziel des Spiels war schnell erklärt und verständlich, die generelle Marschrichtung war klar, die zu unterstützende Mannschaft war selbstverständlich, aber die Regeln begriffen wir trotzdem nicht so ganz. Ob es an uns oder der Erklärung lag, möchte ich nicht beurteilen. Jedenfalls wissen wir bis heute nicht, ob man beim Rugby foulen kann oder nicht. Nachdem wir aber das Spiel gesehen hatten, machten wir uns noch mehr Sorgen um unseren ehemaligen Host Ceasar.
Schneller als erwartet, aber langsamer als gehofft, kam der Tag, an dem wir zurück ins Haupthaus ziehen durften – für eine Nacht. Da wir die letzten zwei Tage und Nächte vor einem Holzkamin zugebracht hatten, waren unsere olfaktorischen Ausdünstungen eher denen eines geräucherten Aals ähnlich als denen normaler Menschen. Wir kamen nicht umhin, all unsere Kleidungsstücke sowie Bettbezüge in die Wäsche zu werfen, um wenigstens einigermaßen präsentabel zu erscheinen, auch wenn eine Dusche mehr als notwendig war, um eine Rückkehr in die zivilisierte Gesellschaft abzuschließen. Hilarys Gäste waren noch nicht abgereist und wir mussten uns wohl oder übel mit ihnen unterhalten. Damit möchte ich nicht zum Ausdruck bringen, dass sie unhöflich waren, aber sie waren schon ein illustrer Club von Eingeschworenen, der mich zudem von anderen Angelegenheiten abhielt. Es war wichtig unsere weiteren Schritte zu planen, da der nächste Flug nur wenige Tage entfernt war und wir noch nicht ganz vorbereitet waren. So blieb uns aber nichts anders übrig, als möglichst aus dem Weg zu gehen, so zu tun, als hätten wir Arbeit, und uns doch mit Fremden zu unterhalten, wenn wir ihnen über den Weg liefen. Immerhin würden wir später keine Zeit habe, weil es an diesem letzten Abend auf uns fiel, das Essen zu bereiten. In diesem Moment vermisste ich meine eigene Wohnung, in der ich tun und lassen konnte, wonach mir der Sinn gerade stand. Endlich waren die Gäste weg, wir zogen zurück ins Zimmer und machten uns an die Vorbereitungen.
Einige Gespräche mit Hilary und Collin waren auch einfach nur knuffig. Als wir uns über Reisen unterhielten und die beiden von ihrem ersten Ausflug nach Südafrika erzählten, stellte Hilary heraus, dass sie anfangs nicht sonderlich davon begeistert war, dass es einen Zwischenstopp in Sydney gab. Dennoch nutzte das Ehepaar die Chance, sich die Stadt mal ein bisschen genauer anzusehen, so dass sie insgesamt vier Tag blieben. Letzten Endes war Hilary recht froh, dass sie diese unfreiwillige Landung nutzten, denn sie stellte fest: „Christchurch ist gar nicht so groß.“ Wir beide mussten uns ein lautes Lachen unterdrücken und zogen es vor, uns an unseren Getränken ordentlich zu verschlucken. Nachdem wir wieder normal atmen konnten, nickten wir andächtig und verständnisvoll. Für jeglichen verbalen Kommentar fehlten mir die Worte.
Broom behind the House
Eine Erklärung dazu folgt im Laufe des Berichtes
Dieses Mal nahmen wir eine andere Route, die Summit Road, die über die Berggipfel der Banks Halbinsel führte und dank des Wetters eine hervorragende Aussicht auf die Bucht lieferte. Es war ein schwieriger Aufstieg für unser kleines Gefährt, aber endlich schafften wir es oben anzukommen, und so genossen wir das prachtvolle Bild, das sich um uns herum erstreckte. Links und rechts lagen die Berge gewellt unter uns, links und rechts erstreckte sich ein Teil des Pazifiks, irgendwo unter uns befanden sich die Highlands Neuseelands – oder der Teil, den wir selbst so genannt hatten. Es war atemberaubend. Die Strecke zog und zog sich, doch sie war jeden Meter wert, denn wir hielten sehr oft, um diese einmalige Landschaft zu fotographieren. Es war kaum zu glauben, was um uns herum lag. Da wir es überhaupt nicht eilig hatten, nahmen wir uns die Zeit für eine Pause hier und einen stillen Moment dort.

Die Ankunft in Christchurch war offensichtlich. Der Verkehr nahm zu, die Häuser standen dichter beieinander, es gab wesentlich mehr Passanten, Geschäfte, Straßen und was sonst noch zu so einer Stadt gehört. Es gab Ampeln – wir hatten schon lange keine mehr gesehen. Nach einigem hin und her fanden wir die Geschäftsstelle von ACE, gaben unser Auto mit einer Träne im Augenwinkel ab, hörten von der Inspektion, dass alles perfekt war, und machten uns wieder auf den Weg anderswohin. Von unserem nächsten Gastgeber hatten wir erfahren, dass es einen Bus gibt, der von Christchurch nach Darfield fährt, wo wir abgeholt werden könnten. Zu diesem Zweck begaben wir uns zur Central Station, an der dieser Bus laut Internet abfahren sollte. Unterwegs begriffen wir, warum Christchurch immer noch als große Baustelle bezeichnet wird: Die Spuren des großen Erdbebens von vor drei Jahren waren immer noch nicht restlos beseitigt. Tatsächlich standen viele Gebäude noch, waren aber verlassen und verbarrikadiert, weil sie stark einsturzgefährdet waren. Daneben fand man Baustellen, auf denen Häuser entweder neu errichtet wurden oder gerade im Begriff waren abgerissen zu werden.
Auch die Central Station war ganz neu, so neu, dass man sie erst vier Tage zuvor eröffnet hatte. Alles in allem war die neue Central Station wie ein Flughafen aufgebaut: Es gab Gateways für Busse, eine riesige, mit Glas verkleidete Halle für wartende Fahrgäste und im noch nicht fertigen Teil sollte Ende des Jahres eine Mall mit verschiedenen Geschäften eröffnet werden. Wir fragten uns ernsthaft, wozu die Stadt solch einen riesigen Busbahnhof brauchte. Der Neubau führte zu gewissen Schwierigkeiten, was die Verkehrslage betraf, da zudem viele Buslinien eine neue Route fuhren und das Personal nicht genau wusste, welche Linie wo abfuhr. Man hatte zusätzliches Personal eingestellt, das die Übergangsphase so reibungslos wie möglich gestalten sollte, aber dennoch konnte uns die Dame am Schalter nicht helfen, wo wir nun unseren Bus nach Darfield finden würden. Stattdessen schickte sie uns zur nächsten i-Site, die neben dem Museum war. Wir waren verwirrt, da wir bereits an der i-Site vorbeigefahren waren, zeigten ihr den Plan, den wir aus dem Internet hatten, fügten uns aber dann ihrem Ratschlag und stiegen in den nächsten Bus zurück.
In der i-Site angekommen, fragte man uns verwirrt, warum wir da waren, da der Bus doch offensichtlich von der Central Station abführe. Das Gemeine an neuseeländischem Personal ist, dass man keine Gelegenheit bekommt, sich über die Leute aufzuregen. Sie bleiben freundlich, hilfsbereit und verständnisvoll. Die Dame in der i-Site sorgte sogar dafür, dass die Dame in der Central Station dafür zurechtgewiesen wurde, dass sie uns unnötigerweise quer durch die Stadt schickte. Außerdem rief sie für uns beim Busunternehmen an, um zu erfragen, wo genau der Bus nach Darfield abfuhr. Mit diesen Daten gewappnet, marschierten wir zurück zur Central Station. Es war ein angenehmer Spaziergang von gerade einmal 15 Minuten – mit Gepäck auf dem Rücken. Das machte uns mittlerweile recht wenig aus.
Wir saßen also wieder in der Central Station, teilten einem Helfer in orangefarbener Warnweste mit, wo der Bus abfuhr und unterhielten uns mit diesem freundlichen Engländer für einige Zeit. Dann brachen wir nach Darfield auf.
Die Fahrt dauerte ungefähr eine Stunde, was hauptsächlich am Feierabendverkehr lag. Als wir endlich ankamen, begrüßte uns Hilary sehr herzlich und nahm uns in ihrem Toyota mit. Darfield war nämlich nicht unsere Endhaltestelle; die Gastfamilie lebte auf einer Farm eine halbe Stunde von jeglicher Zivilisation entfernt – mal wieder. In einer vorhergehenden Mail hatte Hilary uns schon gewarnt, dass es keinen Handyempfang geben würde, aber sie hatten Internet, wenn man nicht zu viel davon und kein zu schnelles erwartete. Zumindest für die grundlegende Kommunikation würde es ausreichen.
Da wir im Dunkeln ankamen, konnten wir uns kein Bild vom Äußeren des Hauses machen. Von Innen sah es wie ein Labyrinth aus. Als wir rein kamen, standen wir in einer Ecke des korridorartigen Flures, der links und rechts abbog. Wir sollten rechts runter gehen, dann rechts abbiegen, sofort links, bis zum Ende des Gangs, wo unser geräumiges Zimmer mit angrenzendem Bad für uns bereit stand. Als Heizung diente ein kleines Heißluftgebläse, das mich an kommunistische Zeiten erinnerte. Damit uns aber auf keinen Fall kalt wurde, fanden sich in den Betten Heizdecken. Es war zumindest etwas, auch wenn es mich immer wieder überrascht, dass Neuseeländer keine Heizungen fest in ihren Häusern montiert haben.
Um in die Küche zu gelangen, mussten wir durch den Gang, am Ende davon rechts und sofort links, geradeaus den Gang runter bis zum Ende, dann rechts und geradeaus durch die Schiebetür. Das war die Strecke, die wir täglich zurücklegten – die anderen Flügel des Hauses betraten wir eher selten bis nie. Allgemein war das Gebäude wir ein Z mit einigen Abzweigungen geformt, so dass man sich gut und gerne darin verlaufen konnte, ohne irgendwelche bösen Absichten zu verfolgen. Es war jedoch nicht so schlimm, da man im Zweifelsfall immer einen der zwölf Ausgänge nehmen konnte, um das Haus zu umrunden und dann wieder durch den Haupteingang einzutreten.
Bei einer sich bietenden Gelegenheit spazierten wir in den Flügel des Hauses, in dem das eigentliche Esszimmer an das eigentliche Wohnzimmer grenzte. Das Wort opulent beschreibt diese beiden Räume im viktorianischen Kolonialstil äußerst passend. Farbenpracht, Dekoration, hohe Decken, Staub. Wir verstanden, warum die Familie lieber die große Wohnküche nutzte. Sie war einfach wohnlicher.
Am Abend unserer Ankunft lernten wir auch Collin kennen, Hilarys Mann.
Nach einem leckeren Abendessen erklärten wir den Tag erst einmal für abgeschlossen und fielen ins Bett. Es war lange überfällig.
Am nächsten Morgen gab es neue Bekanntschaften zu schließen, denn die kleine Flossie, Enkeltochter von Hilary und Collin, ihre Nanny Amy sowie der Hund von Hilarys und Collins Tochter, Rola, waren gerade zu Besuch. Abends kam noch der Sohn der Familie, Andrew, hinzu. Nachdem alles geklärt war, konnten wir uns auch schon an die Arbeit machen – es gab schließlich genug zu tun.
Zum Haus gehörte auch ein Pool, dessen Umrandung durch das Erdbeben ein bisschen Schaden genommen hatte und ausgebessert worden war. Allerdings gab es noch Kleinigkeiten, die abgeändert werden mussten: Zement sollte von Steinen geschleift werden, auf die er nicht gehörte. An diesem Tag wurde mir die einmalige Möglichkeit geboten, den Bildhauer in mir zu entdecken. Ich klopfte auf Stein, ich schleifte, klopfte weiter, suchte und fand, dass ich nicht dazu geschaffen bin. An manchen Stellen fiel es mir schwer zu unterscheiden, wo der Zement aufhörte und der Stein anfing. So gerne ich mich handwerklich betätige, daraus wird nichts. Da uns nach einiger Zeit so langsam alle Gliedmaßen abfroren – immerhin hatten wir Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt –, gingen wir zeitig wieder rein und suchten uns eine andere Tätigkeit drinnen. Da gab es allerdings wenig zu tun, außer man beschäftigte sich mit Flossie, die selbstverständlich immer gerne im Mittelpunkt des Geschehens stand.
Amy fand eine Liste, die Hilary geschrieben hatte, doch auch sie wurde nicht schlau daraus, was wir nun wie machen sollten. Außerdem bezogen sich die meisten Arbeiten auf Tätigkeiten unter freiem Himmel, was aus gesundheitlichen Gründen erst einmal hinten angestellt wurde.
Am nächsten Morgen erfuhren wir dann auch, was es mit dem Punkt „broom behind the house“ auf sich hatte. Auf den ersten Blick ist an dieser Aufgabe nicht viel dran, was aber nur daran liegt, dass wir zu diesem Zeitpunkt nicht wussten, dass das englische Wort broom doppelt belegt ist. Wir gingen von der allgemein bekannten Bedeutung aus: broom = Besen, to broom = kehren, die ganze Aussage = hinter dem Haus kehren. Leider meinte Hilary etwas ganz anderes damit. Broom kann nämlich auch mit Ginster übersetzt werden.
Unsere Gastmutter bat uns darum, den Ginstersträuchern in einem kleinen Areal hinter dem Haus den Garaus zu machen. Auch den Begriff „kleines Areal“ möchte ich hier in Anführungsstriche setzen, weil es relativ gesehen werden muss. Im Vergleich zu den riesigen Landmassen, die diese Familie besitzt, und auch im Verhältnis zu der Fläche, auf der sie Wohnen, war der Bereich klein. Allerdings brauchte man schon mehrere Minuten, um von der Haustür zu Fuß zur Straße zu kommen, obwohl die Ausfahrt gut geebnet war.
Wir bekamen Astschere, Rosenschere und Pflanzengift in die Hand gedrückt, um uns damit an bösartigen Ginstern und Pinien zu schaffen zu machen. Da sowohl Pinien als auch Ginstern hier nicht heimisch sind und keine natürlichen Feinde kennen, durften wir sie wie Unkraut behandeln. So begann ein Tag, an dem wir den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sahen und das Unkraut einfach nur noch grün war. Anfangs waren noch wenige Ginsterbüsche zu sehen und wir kümmerten uns mehr um die Pinien, doch je näher wir der Straße kamen, umso höher und dichter wurde das Buschwerk aus Unkraut. Hinzu kam, dass das Gelände alles andere als eben war; es war mit Holz, toten Bäumen und Ästen, übersät. An manchen Stellen war es eine schiere Herausforderung einfach nur gerade stehen zu bleiben, geschweige denn einige Schritte zu tun, ohne sich die Beine zu brechen. Wir schafften nicht alles an einem Tag. Aber auf diese Weise blieb genug für den nächsten. Außerdem war der Pool noch nicht ganz fertig, so dass wir das noch zu Ende bringen konnten. Wir halfen Hilary auch dabei, ein nahe gelegenes Haus auf Vordermann zu bringen, weil demnächst dort Arbeiter einziehen sollten. Auf dem Land gab es wohl eine erhöhte Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum, aber nur ein geringes Angebot. Vor allem saisonale Arbeitskräfte suchten fertig möblierte Häuser und Wohnungen.
Dies war eine weitere Gelegenheit, bei der Neuseeländer uns mit ihrem Umweltschutzgedanken überraschten. Hilary war stolz darauf, dass es seit 2004 verpflichtend war, doppeltverglaste Fenster in Neubauten einzusetzen. Wir schmunzelten.
Unser Aufenthalt in Darfield bekam den Titel „broom behind the house“, was nicht nur auf das Missverständnis mit broom zurückzuführen ist, sondern auch auf Hilarys und Collins Selbstverständnis von „hinter dem Haus“. Die Neuseeländer mögen es eben ein bisschen größer.
Wir erinnerten uns an diesen Spruch, als unsere Gastmutter uns bat, einige Steine zu sortieren. Bei vorhergehenden Bauarbeiten waren Steine entfernt und aus dem Weg geräumt worden, aber sie würde sie gerne wiederverwenden. Da sie unordentlich auf einem Stapel gekippt worden waren, waren einige zerbrochen, andere heil. Sie bat uns, die ganzen von den fast heilen und den kaputten zu trennen, um sie dann auf Paletten zu stapeln. Wir verstanden „Steine“; Hilary meinte „Steinplatten“.

Collin schätzte jede der Platten auf 25-30 kg. Nach diesem Tag brauchte keine von uns ein Sportprogramm. Und obwohl wir weniger als die vereinbarten vier Stunden an diesem Tag arbeiteten, beschwerte sich niemand, dass wir keinen Finger mehr rührten.
Eine weitere unserer Aufgaben bestand darin, die Küchenschränke von Hilary auszuräumen und zu säubern. Ich habe Verständnis für Leute, die viele Lebensmittel auf einmal kaufen, um nicht täglich in den Supermarkt gehen zu müssen, vor allem wenn sie so weit weg von der nächsten Einkaufsmöglichkeit wohnen. Was wir in den Schränken fanden, war allerdings schon eine Übertreibung. Der Höhepunkt war ein Schokoweihnachtsbäumchen, das im Juli 2004 abgelaufen war. Von diesen kulinarischen Abfallprodukten fanden sich einige, mit dem einzigen Unterschied, dass das Verfallsdatum zwischen 2005 und 2014 liegen konnte. Viele Produkte waren noch nicht einmal angebrochen, und ich frage mich bis heute, wie viele Kilogramm Erdnüsse ein Haushalt braucht. Andere Packungen hingegen waren bereits geöffnet, daneben lag das gleiche Produkt, ebenfalls geöffnet. Franziska machte den Fehler, die Schubladen auch von außen abzuwischen, was dazu führte, dass man ganz deutlich den Unterschied zwischen gereinigt und nicht gereinigt sah. So konnte die Küche auf keinen Fall bleiben, wenn ein Teil einem in strahlendem Weiß entgegen prangerte, während ein anderer eher durch trübes Grau bestach. Dennoch wollte Hilary nicht, dass wir den Rest säuberten. Andere Aufgaben fand sie wichtiger.
An unserem freien Tag nahm unsere Gastmutter uns nach Ashburton mit, ein Städtchen, das ungefähr eine Stunde Fahrt vom Haus der Familie entfernt liegt. Hilary hatte einige Sachen zu erledigen, ließ uns aber die Zeit alleine, damit wir die Stadt unsicher machten. Anstatt ihrem Vorschlag zu folgen und einen Blick in die Kunstgalerie zu werfen, wandten wir unsere Aufmerksamkeit dem Park zu. Aber es galt erst einige Prioritäten abzustecken: Lunch.
Da wir keine Ahnung von den uns umgebenden Cafés hatten und Hilary uns auch keine konkrete Auskunft geben konnte, fragten wir ganz dreist in der i-Site nach einer Empfehlung. Eine Mitarbeiterin schlug ein Café um die Ecke vor, also kehrten wir in den Sumerset Grocer ein. Nach einem schmackhaften Lunch und dem besten Tee seit Monaten ging es weiter zur ANZ-Filiale, um einige Fragen zu klären. Nachdem diese scheinbar beantwortet waren, zogen wir in den Park. Die Sonne schien, es war gerade warm genug für einen Spaziergang und wir wussten genau, wohin wir gehen wollten.
Im Park angekommen fanden wir einen Fitness-Pfad, dem wir spontan folgten, weil er uns auch in die entlegenen Ecken der Grünanlage führte. Außerdem war es lustig, die eine oder andere Übung auch mal auszuprobieren. Die notwendigen Geräte standen gut gepflegt bereit. Ich war überrascht, wie groß der Park war.

Es gab Spielplätze, Sportfelder für verschiedene Sportarten, Teiche, Wiesen, Rosengarten, viele Bäume und was noch dazu gehört. Nach mehr als einer Stunde ziellosen Umherwanderns wandten wir uns wieder dem Zentrum der Stadt zu, um noch einige letzte Eindrücke von neuseeländischen Geschäften in uns aufzunehmen. Außerdem suchte ich noch immer verzweifelt nach einem karierten Heft der Größe DIN A5 (oder so ähnlich). Diese scheinen am anderen Ende der Welt überhaupt nicht geläufig zu sein.
Nachdem alles erledigt war, brachen wir zum Supermarkt auf, an dem wir mit Hilary verabredet waren. Sie hatte allerdings noch einige Einkäufe zu erledigen, und mit „einige“ meine ich „jede Menge“. In Anbetracht der riesigen Vorräte dieser Familie frage ich mich immer noch, was sie noch nicht hatten. Anscheinend fand sich immer noch etwas, das unbedingt mitgenommen werden musste. Kein Wunder, dass so viele Lebensmittel im Haushalt G. schon kurz vor der Volljährigkeit und somit vor dem Einzug in die neuseeländischen Geschichtsbücher standen. Aber anscheinend war es nicht genug auf zwei Eiszeiten vorbereitet zu sein, nein, die dritte könnte auch noch kommen.
Ein weiteres Projekt bestand im Unkrautjähten. Da wir uns darin mittlerweile als Profis betrachteten, ging es recht zügig, zu zügig, wie wir einsahen. Um Hilary nicht auf unangenehme Gedanken zu bringen oder die Erwartungen an uns sowie künftige Helfergenerationen künstlich in die Höhe zu schrauben, atmeten wir tief durch und machten uns wieder an die Arbeit. Diesmal gemächlicher.
Zurück zu dem Thema ANZ: Wir hatten noch jeweils ein hübsches Sümmchen von unserer Arbeit in Franz Josef auf unseren neuseeländischen Konten, allerdings keine Zeit mehr dies in Neuseeland auszugeben. Also wollten wir es auf unsere deutschen Konten überweisen, was von den ANZ-Mitarbeitern immer wieder als besonders einfach dargestellt wurde. Wir hatten fünfmal in fünf verschiedenen ANZ-Filialen gefragt, ob wir nicht eine TAN bräuchten. Ebenso erklärten wir jedes Mal, was wir damit meinten, wie wir es aus Deutschland gewohnt waren. Jedes Mal bekamen wir zur Antwort, dass es ganz einfach in Neuseeland wäre und wir uns keine Sorgen machen müssten. Als wir nun wieder bei Hilary im Wohnzimmer saßen und unsere Überweisung tätigen wollten, kamen wir zur Sicherheitsabfrage, die uns sagte, dass uns eine TAN per SMS zugeschickt werden würde. Ich wiederhole: Wir waren an einem Ort ohne Handyempfang. Diese SMS ist nie bei uns angekommen. Aus diesem Grund möchte ich jedem strengstens davon abraten, ein Konto bei der ANZ aufzumachen. Man bekommt nur häppchenweise Informationen, die sich stellenweise widersprechen, und manchmal bleibt das Wichtigste aus. Das ist kein guter Service.
Hilary bat uns darum, einige alte Tische abzuschleifen und neu zu lackieren, weil sie sie gerne wiederverwenden würde, der Lack aber schon an mehreren Stellen abgesplittert war. Wir sahen keine Möglichkeit, ihre freundliche Bitte als etwas anderes als als Aufforderung zu betrachten, also machten wir uns an die Arbeit. Tim, seit zehn Wochen als Maler und Handwerker für die Familie tätig, hatte eine effiziente Alternative zum Bandschleifer: einen Schaber. Erstaunlicherweise ging es damit schneller als mit einem elektrischen Gerät. Meine Erwartungen an den Bandschleifer sanken aber auch ganz schön tief, als ich las, dass er nur 135 W hatte. Was brauchen wir? Mehr Power! Es blieb dabei, dass unsere Muskeln eine bessere Leistung brachten. Es war auch besser so, weil wir sonst die Tiefkühltruhe hätten ausstöpseln müssen – Mangel an Steckdosen und so.
Es kam der Tag, an dem Hilary einige Gäste empfing und uns aus diesem Grund aus ihrem Haus verbannte. Doch nicht weit entfernt stand eine Winterherberge, die sie oft an Arbeiter in der Nähe oder an zahlende Gäste vermietete. In der Nähe lag eines von Neuseelands Skigebieten. Wir durften also unsere Siebensachen packen und dorthin aufbrechen. Ein neues Abenteuer begann und es überrascht mich bis heute, dass es nicht unser letztes war.
Größtes Manko dieser Behausung – nach neuseeländischen Maßstäben: Es gab keinen Teppichboden. (Für mich ist es einfach erstaunlich, wie weit Neuseeländer ihre Liebe zu diesem Bodenbelag tragen:

In Hilarys Haus lag sogar im Badezimmer ein dicker, flauschiger Teppichboden.)
Diesem Problem begegnete unsere Gastfamilie, indem sie einige Teppiche vor den Kamin legte. Immerhin wollte man so viel Wärme wie möglich innerhalb des Wohnraums behalten, anstatt ihr die symbolischen Türen weit zu öffnen. Der Erfolg dieser Maßnahmen steht noch aus.
Unserer Ansicht nach war das mangelnde Heizsystem allerdings ein viel größeres Problem. Zwar gab es in der Wohnküche einen Kamin, den wir auch brav lange vor Hereinbrechen der Nacht entzündeten und dessen Feuer wir konstant schürten, aber das Ventilationssystem, das die Wärme auf alle Räume verteilen sollte, funktionierte nicht so ganz. Die elektrischen Heizungen in den Zimmern waren mit tickender Zeitschaltuhr versehen, so dass die Räume nicht wirklich warm wurden. Das konnte man allerdings bei den gegebenen Witterungsbedingungen, Minusgraden und Neuschnee, nicht ernsthaft erwarten. Wir entschieden uns spontan dazu, einige Matratzen aus den Schlafräumen in den beheizten Wohnraum zu holen, diese auf dem Boden vor dem Kamin auszubreiten und uns dort zur Nachtruhe zu begeben. Natürlich waren wir uns der Gefahren bewusst, die damit einhergingen, aber als Alternative stand eine schlaflose Nacht wegen abfrierender Gliedmaßen in Aussicht. Auf diese Weise hatte ich zudem meinen Spaß mit dem Feuer zu spielen… ähm, es am Laufen zu halten, damit wir nicht erfroren. Die Faszination des Feuers.

Spannend fand ich auch, dass es keinen Flur gab, der die Räume miteinander verband, sondern dass man über die Veranda von Zimmer zu Zimmer kam, also auch vom Wohnzimmer ins Bad. So kann man auch aus alltäglichen Handlungen, wie beispielsweise einer Dusche, eine Extremsportart machen. Spaßeshalber malte ich mir aus, wie sich einige Skifahrer nach einem langen, kalten Tag dazu aufrafften, ordentlich zu duschen, um dann mit nassen Haaren durch die Kälte in ihre Zimmer zu stolpern.
Immerhin gab es einen Fernseher, der uns lange genug unterhalten konnte, bis es Zeit fürs Bettchen war. Franziska fand Maori Television, einen Sender der Fernsehen von und für Maori anbot. Es war eine seltsame Mischung aus Vertrautem und Fremdem. Besonders erstaunlich war, dass auch die Werbung anders als auf nicht-Maorisendern war. Ich kam nicht umhin, von einer Zwei-Klassen-Gesellschaft zu denken, auch wenn das Programm mehr Unterhaltung als deutsches Fernsehen bot. An diesem Punkt möchte ich jedem Leser die Sendung „Find Me a Maori Bride“ wärmstens ans Herz legen.
Unser Aufenthalt in dieser doch so ramponierten Hütte gab mir allerdings die einzigartige Möglichkeit mit einem nicht für deutsche Straßenverhältnisse zugelassenen Quad durch die Gegend zu düsen. Unsere Gastfamilie besaß so ein Vehikel, das sich durch eine relativ große Ladefläche auszeichnete. Collin zeigte mir, wie man das Fahrzeug bediente, so dass wir den langen Weg von fünfzehn Gehminuten nicht täglich zu Fuß zurücklegen mussten. Wir hatten uns schon daran gewöhnt, dass die Leute uns komisch anguckten, wenn wir ihnen von unserer mangelnden Motorisierung erzählten. Dieses Quad gab mir so manche Mühe, da es einerseits viele Eigenschaften eines Motorrads teilte, dann andererseits doch anders funktionierte. Es gab weder Rückspiegel, noch Blinker, geschweige denn Kupplung, aber dafür mehrere Gänge. Tatsächlich besteht in Neuseeland Helmpflicht für derartige Fahrzeuge, auf dem Land nimmt die Bevölkerung das allerdings, trotz zahlreicher Unfälle mit Todesfolge, nicht so ernst. In Ermangelung von Kopfschutz jedweder Art blieb also auch uns nichts anderes übrig, als auf unsere Fahrkünste zu vertrauen und unseren gesunden Menschenverstand zu benutzen.
Ich nahm mir einige Zeit, mir Gedanken zu diesem Gefährt zu machen, und kam zu dem Schluss, dass ich es nicht mochte. Dafür gab es mehrere Gründe: Schalten war eine Glückssache; der Mangel an Rückspiegeln gefiel mir nicht besonders; aber das unangenehme Gefühl, dass ich in jeder Kurve und bei jeder Steigung – insbesondere in Kurven bei Steigung – fast die Kontrolle über das Vehikel verlor und zu kippen drohte, gab den Ausschlag für meine Aversion ihm gegenüber. Dennoch fuhren wir auf und ab, benutzten es als Lastentransportmittel und drehten auch mal eine Runde zum Vergnügen, weil der Tank gerade voll war. Lustig war, dass wir am ersten Morgen so oder so zu Fuß von der Hütte zum Haupthaus laufen mussten, weil das Gerät bei den nächtlichen Temperaturen eingefroren war. Es war nicht nur kalt, sondern es war mit einer dicken Frostschicht bedeckt. Erst nachdem es einige Stunden in der Sonne gestanden hatte, sprang es auch wieder an.
Obwohl Franziska die ein oder andere Fahrt mit dem Quad wagte, hatte sie ein anderes Fahrzeug zu ihrem neuen Lieblingsspielzeug auserkoren: den Toyota Prado unserer Gastfamilie. Ich würde ja gerne mehr zu diesem Ungetüm schreiben, etwas zum Fahrverhalten, Straßenlage, Handling, etc., aber mir sind die Finger gebunden, da meine Reisebegleitung mich kein einziges Mal ans Steuer ließ, wenn sich die Gelegenheit bot, damit zu fahren. Anfangs war sie noch scheu vor diesem SUV, der größer als ich war, aber schon nach den ersten Metern stand fest, dass ich dieses Fahrzeug nie vom Fahrersitz aus sehen würde. Was ich allerdings auf meiner Beifahrerposition wahrnahm, war, dass man die Geschwindigkeit überhaupt nicht merkte. Selbst über unebene und unbefestigte Straßen glitt dieses Monstrum wie über frisch geschliffenes Eis. Auch die Geräuschkulisse hielt sich in Grenzen. Man hörte weder den Motor rauschen noch die Außengeräusche.
Es ergab sich die Gelegenheit ein Rugby-Spiel live im Fernsehen zu sehen, was wir uns ungern entgehen lassen wollten, da wir es mit eingefleischten Fans gucken konnten, die uns bestimmt gerne die Regeln und das Geschehen auf dem Feld erklären würden. So fuhren wir eines Abends zur Tochter des Hauses, Georgie, die mit ihrem Mann und einigen seiner Freunde schon gespannt auf das Spiel wartete. Das Ziel des Spiels war schnell erklärt und verständlich, die generelle Marschrichtung war klar, die zu unterstützende Mannschaft war selbstverständlich, aber die Regeln begriffen wir trotzdem nicht so ganz. Ob es an uns oder der Erklärung lag, möchte ich nicht beurteilen. Jedenfalls wissen wir bis heute nicht, ob man beim Rugby foulen kann oder nicht. Nachdem wir aber das Spiel gesehen hatten, machten wir uns noch mehr Sorgen um unseren ehemaligen Host Ceasar.
Schneller als erwartet, aber langsamer als gehofft, kam der Tag, an dem wir zurück ins Haupthaus ziehen durften – für eine Nacht. Da wir die letzten zwei Tage und Nächte vor einem Holzkamin zugebracht hatten, waren unsere olfaktorischen Ausdünstungen eher denen eines geräucherten Aals ähnlich als denen normaler Menschen. Wir kamen nicht umhin, all unsere Kleidungsstücke sowie Bettbezüge in die Wäsche zu werfen, um wenigstens einigermaßen präsentabel zu erscheinen, auch wenn eine Dusche mehr als notwendig war, um eine Rückkehr in die zivilisierte Gesellschaft abzuschließen. Hilarys Gäste waren noch nicht abgereist und wir mussten uns wohl oder übel mit ihnen unterhalten. Damit möchte ich nicht zum Ausdruck bringen, dass sie unhöflich waren, aber sie waren schon ein illustrer Club von Eingeschworenen, der mich zudem von anderen Angelegenheiten abhielt. Es war wichtig unsere weiteren Schritte zu planen, da der nächste Flug nur wenige Tage entfernt war und wir noch nicht ganz vorbereitet waren. So blieb uns aber nichts anders übrig, als möglichst aus dem Weg zu gehen, so zu tun, als hätten wir Arbeit, und uns doch mit Fremden zu unterhalten, wenn wir ihnen über den Weg liefen. Immerhin würden wir später keine Zeit habe, weil es an diesem letzten Abend auf uns fiel, das Essen zu bereiten. In diesem Moment vermisste ich meine eigene Wohnung, in der ich tun und lassen konnte, wonach mir der Sinn gerade stand. Endlich waren die Gäste weg, wir zogen zurück ins Zimmer und machten uns an die Vorbereitungen.
Einige Gespräche mit Hilary und Collin waren auch einfach nur knuffig. Als wir uns über Reisen unterhielten und die beiden von ihrem ersten Ausflug nach Südafrika erzählten, stellte Hilary heraus, dass sie anfangs nicht sonderlich davon begeistert war, dass es einen Zwischenstopp in Sydney gab. Dennoch nutzte das Ehepaar die Chance, sich die Stadt mal ein bisschen genauer anzusehen, so dass sie insgesamt vier Tag blieben. Letzten Endes war Hilary recht froh, dass sie diese unfreiwillige Landung nutzten, denn sie stellte fest: „Christchurch ist gar nicht so groß.“ Wir beide mussten uns ein lautes Lachen unterdrücken und zogen es vor, uns an unseren Getränken ordentlich zu verschlucken. Nachdem wir wieder normal atmen konnten, nickten wir andächtig und verständnisvoll. Für jeglichen verbalen Kommentar fehlten mir die Worte.
... link (0 Kommentare) ... comment
Sonntag, 2. August 2015
Akaroa – Mai 2015
atimos, 04:38h
Wie wir auszogen eine französische Siedlung zu suchen und die schottischen Highlands fanden.

Nachdem wir nun so viel Zeit in den Bergen zugebracht hatten, beschlossen wir uns wieder dem Meer zuzuwenden. Dank der Inselhaftigkeit dieses Staates stand diesem Vorhaben nicht viel im Weg. Es mussten nur einige Kilometer in irgendeine Richtung zurückgelegt werden und schon waren wir da. Diese Kilometer führten uns relativ zielgerichtet nach Akaroa, einem Örtchen auf der Banks Halbinsel.
Wenn man sich strikt an die Highways hält, ist es nur sehr schwierig sich in diesem kleinen Land zu verfahren. Wir allerdings wollten es vermeiden uns durch Christchurch oder dessen Vororte zu zwängen, weshalb wir vorher schon von dieser gerade gebügelten Straße abbogen und unser Glück auf einigen Nebenstraßen versuchten. Die Informationen auf der kleinen Landkarte mit Straßennetz waren allerdings nur mangelhaft, was zwangsläufig dazu führte, dass wir uns verfuhren. Als wir endlich auf eine Ortschaft stießen, fragten wir auch sofort nach dem Weg, um festzustellen, dass es gar nicht so schlimm um uns bestellt war. Es gab eben nicht allzu viele Straßen.
Auf diese Weise kamen wir durch den Ort Lincoln, der uns in mehrfacher Hinsicht überraschte. Zum einen war die Stadt viel größer als der Fleck auf der Landkarte es vermuten ließ. Wir staunten nicht schlecht, als wir an der Universität vorbeifuhren. Kurzentschlossen kürten wir diesen Ort zu unserer Lunchrast, da sowohl ein gutes Mittagessen als auch eine Rast lange überfällig waren. In der Innenstadt fand sich ein putziger Japaner, bei dem wir gerne einkehrten. Das Lokal war recht simpel gehalten, einige Plastiktische standen nebst Plastikstühlen im Raum, die Theke war mit Leckereien gedeckt und die Mitarbeiter überzeugten durch Freundlichkeit – ganz nach japanischer Art verbeugte der Chef sich sogar. Aus einer Laune heraus, die nur Leute verstehen, die mit „The Devil is a Part-Timer“ vertraut sind, bestellte ich Katsu Don. Es war vorzüglich und so sättigend, dass es zum Abendessen nur Toast gab. Nach unserem kurzen, aber durchaus amüsanten Aufenthalt ging es weiter – back on the road again. Wir kannten jetzt den Weg und folgten den Anweisungen der Einwohner.
Als wir uns Akaroa näherten, stellten wir fest, dass es wieder in ein Gebirge ging. Mittlerweile hatte das Wetter umgeschlagen, so dass wir uns tiefhängenden Wolken und vereinzelten Regenschauern gegenübersahen. Dies ist nur deshalb erwähnenswert, weil das Gesamtbild – Berge, Felsen, Weiden, Schafe, Regen – uns den Eindruck vermittelte in Schottland angekommen zu sein. Es ging weiter über gewundene Straßen, die mit so viel Rollsplitt übersät waren (es hatte einige Tage zuvor geschneit, doch der Schnee war wieder geschmolzen), dass man eher seinetwegen als wegen möglicher Eisbildung ins Schleudern hätte geraten können. An dieser Stelle möchte ich mich beim neuseeländischen Verkehrsministerium bedanken, da seine Schilder mich darüber aufklärten, dass kurvenreiche Straßen bei Frost rutschig sein können. Wer hätte das gedacht?
Auf der anderen Seite des Berges erbot sich uns mal wieder ein einmalig bezaubernder Anblick: Die Bucht der Banks Halbinsel mit ihren kleinen Siedlungen hier und da, eingekesselt von Bergen, wurde von einem Regenbogen gekrönt. Am Horizont sah man ganz deutlich, wie das eine Ende im Meer abtauchte, während das andere auf der Landspitze ruhte. Vielleicht waren wir doch in Irland gelandet. Jetzt galt es nur diesen verdammten Kobold mit seinem Eimer voll Gold zu finden.
Anhand der Namensgebung merkte man schnell, dass die Franzosen dieses Eiland unsicher gemacht hatten. Nicht nur Straßen- und Städtenamen hatten einen französischen Touch, auch die Geschäfte und Unterkünfte klangen fremd in dieser weit entfernten Umgebung. Auch unsere Herberge trug den pittoresk anmutenden Namen „Chez la Mer“ und war von außen rosa. Das waren auch die einzigen Hinweise, die uns dabei halfen sie zu finden. Unserem Hostel möchte ich einen etwas längeren Absatz widmen, nehme aber vorweg, dass ich kein gutes Haar an dieser überteuerten Absteige lassen werde.

Es begann damit, dass das Haus wahrscheinlich älter als das neuseeländische Parlament war und ebenso wahrscheinlich nicht ein einziges Mal vernünftig renoviert wurde. Die verschiedenen Farbschichten waren wohl der einzige Grund, warum diese Sperrholzbrettansammlung noch nicht in sich zusammengefallen war. Die letzten Modernisierungsmaßnahmen fanden womöglich in den 1960ern statt. Um das Törchen zum Vorgarten zu öffnen, setzt man sich der eminenten Gefahr aus, einen Finger im Schloss einzuklemmen.
Da wir – wie immer – ein Mehrbettzimmer gebucht hatten, bekamen wir überhaupt keinen Schlüssel. Man konnte ihn nicht einmal auf Anfrage dazu buchen. Nur Einzelzimmern war solch ein Luxus vorbehalten. Dies implizierte auch, dass die Haustür nicht abgeschlossen war, weshalb jedermann beliebig hinein- und wieder hinausgehen konnte, ohne dass eine Autoritätsperson es überwachen würde. Es gab auch keine Möglichkeit den Eingangsbereich vom Wohnzimmer aus einzusehen, obwohl das Personal dort die meiste Zeit zubrachte. Kein Schlüssel hieß auch, dass unser Raum nie abgeschlossen werden konnte. Man stellte uns allerdings Schließfächer zu Verfügung – die ich problemlos unterm Arm hätte wegtragen können. Ich verstehe nicht, warum sie auch nur versuchen den Anschein zu erwecken, als würden sie sich auch nur im geringsten Maß darum kümmern, was mit meinen Habseligkeiten passiert. Später las ich in einigen Kritiken zu dieser Herberge, dass schon mehrfach Wertgegenstände aus den Zimmern gestohlen worden waren.
Darüber hinaus war unser Raum ein Durchgangszimmer, da ein Schlafsaal für Angestellte direkt daran grenzte. Diese Leute scherten sich auch einen Schmarrn darum, ob die Tür zu unserem Zimmer offen stand oder nicht – für ihre eigenen Räumlichkeiten hatten sie ja einen Schlüssel. An dieser Stelle sei noch erwähnt, dass die Eingangstür zu unserem Zimmer auf den Hof ging, wir der Kälte also schutzlos ausgeliefert waren. Davon abgesehen, konnte jeder, der an dem Raum vorbeiging, sehen, dass unsere Sachen drin lagen.
Das hatte also zur Folge, dass es eiskalt in unserem Quartier war. Nicht, dass die dünnen Wände, von denen nur eine ans Haus grenzte, irgendeine Art von Isolierung hatten, weder gegen Wärmeverlust noch gegen Schall. Selbst das hätte wenig gebracht, da zwischen Tür und Rahmen stellenweise so große Spalten waren, dass meine Hand durch gepasst hätte.
Dies erklärt vermutlich auch die Mausefalle in der Küche. Bei einer solchen Bauart lud man die Nager im Winter doch nahezu ins Haus ein. Es sprach aber auch Bände über den Reinlichkeitszustand dieses Hostels. Wir hörten, wie einige Helfer sich darüber unterhielten, wie eine Maus der Falle entwischt war. Dieses kleine, schlaube Biest hatte es geschafft den Köder in Form von Erdnussbutter aus der Falle zu stehlen, ohne diese auszulösen. Man hätte ihr sogar zu Fuß besser folgen können, da sie ihre patzigen Pfotenabdrücke überall verteilte. Besonders deutlich waren die Spuren auf den Brötchenrohlingen, die offen in der Küche darauf warteten in den Backofen geschoben zu werden. Unsere Lebensmittel würden auf jeden Fall im Auto bleiben.

Zurück zu unseren Übernachtungsbedingungen. Wir hatten ein Badezimmer, das an unseren Raum grenzte. Das Fenster darin war nicht einmal dafür konzipiert jemals geschlossen zu werden. Es war ein Loch in der Wand, in das man schräg einige Glasplatten hineingelegt hatte. An Frischluft mangelte es uns mit Sicherheit nicht. Dessen ungeachtet schälte sich die Farbe über der Dusche bereits ab und darunter krochen pelzige Kolonien schwarzen Schimmels hervor.
Um all diesen rauen Witterungsbedingungen und den sinkenden Temperaturen Einhalt zu gebieten, stand uns ein kleiner, elektrischer Heizkörper zur Verfügung. Selbstverständlich durfte man dieses Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen, weil es dank des veralteten Stromnetzes jederzeit in Flammen aufgehen und das ganze Hostel in Schutt und Asche verwandeln könnte – immer noch eine bauliche Verbesserung, wenn man mich fragt. Damit war die Beheizung des Schlafgemachs doch recht schwierig. Zumal wir recht spät ankamen, dort drinnen schon lange nicht mehr geheizt worden war, wir uns noch etwas ansehen, dann noch kochen wollten, in der Küche und Wohnzimmer blieben, weil dort ein Feuer im Kamin brannte und es entschieden wärmer war und außerdem man nur dort Internetempfang hatte. Dass die Herberge kostenlos weitere Decken und Wärmflaschen zur Verfügung stellte, war wirklich das Mindeste. Trotzdem verlangte ich nach einem weiteren Heizkörper, der mir ohne Murren gebracht wurde.
Darüber hinaus bin ich mir noch nicht einmal sicher, ob sie die Betten nach den letzten Gästen neu bezogen haben. Entweder sie hatten eine nicht voll funktionsfähige Waschmaschine oder sie machten sich nicht die Mühe, wenn die Bezüge noch nicht gebraucht genug aussahen. Jedenfalls beschwerte sich Franziska, dass ihr Bett nicht einwandfrei war.
Ich weiß nicht, was für Ansprüche andere Backpacker haben, aber ich erwarte für mein Geld schon etwas Besseres, insbesondere weil 28 $ pro Nacht zur gehobenen Preiskategorie für Mehrbettzimmer zählen. Die freundliche Helferin, die uns an diesem Tag im Hostel begrüßte, machte uns darauf aufmerksam, dass wir das Zimmer zu einem Schnäppchenpreis ergattert hatten. Ja, es war ein Mehrbettzimmer, wie wir es buchen wollten, aber es waren nur vier Betten mit Ensiute, weil keine anderen Dorms derzeit frei waren. Normalerweise kostet solch ein Quartier 35 $ pro Nacht. Mir fehlten die Worte. Das war mehr als unverschämt. Die anderen Reisenden hingegen fanden diese Bedingungen normal – für neuseeländische Verhältnisse.
Hier muss ich betonen: Das ist es nicht. Es war mit Abstand das schlechteste Hostel, in dem ich in Neuseeland untergekommen bin, und es zählte zu den teuersten. Sogar in Tschechien gibt es bessere Lebensbedingungen! Ich kann nur davon abraten im „Chez la Mer“ ein Zimmer zu buchen. Besser man investiert ein bisschen mehr Geld, wenn man einen Ausflug nach Akaroa machen will, denn ich gehe dreist davon aus, dass die Hotels und Motels bessere Bedingungen anbieten.
Zur Buchung sollte ich auch noch einige Worte verlieren. „Chez la Mer“ ist nicht bei hostelworld.com eingetragen, so dass wir direkt über die Seite der Herberge buchten. Es war allerdings nicht möglich eine Buchung mit wenigen Klicks durchzuführen, nein, man musste seine Daten in ein Formular eingeben und eine Anfrage per Mail schicken. Anstatt einer Antwort, ob ein Zimmer frei war oder nicht, bekamen wir eine Buchungsbestätigung und das Geld wurde von der Kreditkarte abgebucht. Ob wir nun mit Karte oder bar bezahlen wollten, zusammen oder getrennt, fragte man uns gar nicht erst. Ich finde dies unverschämt. Darüber hinaus hatten wir nur eine Anfrage geschickt, keine Buchung. Es hätte genauso gut sein können, dass wir uns in der Zeit schon für ein anderes Zimmer entschieden.
Alles in allem nahm ich den Aufenthalt in „Chez la Mer“ mit Galgenhumor und lächelte bei jeder neu erkannten Katastrophe.
Es überraschte mich zu sehen, dass so viele Deutsche dort längerfristig eingekehrt waren. Tatsächlich waren die meisten Gäste und Helfer deutscher Herkunft. Aber dass ihre Ansprüche so niedrig waren und sie sich diese Lebensbedingungen zumuten ließen, verwirrte mich. Eine Nacht in dieser Absteige war, in meinen Augen, die Grenze des Erträglichen.
Kommen wir nun zu dem Städtchen Akaroa.
Eingekeilt zwischen Meer und Bergen genießt man in Akaroa immerzu beeindruckende Ansichten, wohin man die Augen auch richtet. Verschiedene Boote schwankten ruhig auf den Wellen, eine gepflegte Uferpromenade erlaubte den Besuchern gemütliches Flanieren und die englische Sprache verunstaltete die französische – oder umgekehrt –, wie man an dem Schild „The Brasserie“ unschwer ablesen konnte.

Obwohl das Städtchen schon seinen Winterschlaf angetreten hatte und viele Läden zwecks Urlaub geschlossen waren, genossen wir das doch arg französisch geprägte Ambiente der Haupttouristenroute. Wie es für Neuseeland typisch war, hatte man die Häuser aus Holz gezimmert, und dennoch besaßen die Fassaden einen nicht so typischen Einschlag, der an die Côte d'Azur erinnerte.

Bevor wir unsere obligatorische, kostenlose Straßenkarte holen konnten, mussten wir noch ein bisschen Zeit totschlagen, da die i-Site erst in diesem verschlafenen Örtchen später öffnete. Aber kaum dass wir richtig ausgestattet waren, machten wir einen Plan und zogen los, die Gegend unsicher zu machen.
Zielsicher flanierten wir die Strandpromenade entlang, die durch einen Sturm einige Tage zuvor mit Kieseln und Muscheln übersät war. Kaum ein Mensch war um diese Tages- oder Jahreszeit unterwegs, was uns nur wenig störte.
Zuerst wollten wir den alten Leuchtturm sehen. Da wir dort schneller als erwartet ankamen, gingen wir die Straße weiter zu einem Gedenkstein. Dort lernten wir ein bisschen über die englisch-französischen-maori Beziehungen in Akaroa. Danach wollten wir uns den nahe gelegenen Park ansehen; gesagt, getan, und wir waren viel zu schnell durch. Tatsächlich ist Akaroa eine von Franzosen gegründete Siedlung auf englischsprachigem Boden mit einem maori Namen. Es war alles vertreten und bunt ineinander gerührt.
Trotz all dieser Aktivitäten war der Morgen noch jung, unsere Phantasie bezüglich der Sehenswürdigkeiten Akaroas aber erschöpft. Anstatt noch weiter Zeit zu schinden, brachen wir also früher als geplant auf und nahmen die etwas weniger befahrene Route über die Summit Road. Das war es allemal wert.


Nachdem wir nun so viel Zeit in den Bergen zugebracht hatten, beschlossen wir uns wieder dem Meer zuzuwenden. Dank der Inselhaftigkeit dieses Staates stand diesem Vorhaben nicht viel im Weg. Es mussten nur einige Kilometer in irgendeine Richtung zurückgelegt werden und schon waren wir da. Diese Kilometer führten uns relativ zielgerichtet nach Akaroa, einem Örtchen auf der Banks Halbinsel.
Wenn man sich strikt an die Highways hält, ist es nur sehr schwierig sich in diesem kleinen Land zu verfahren. Wir allerdings wollten es vermeiden uns durch Christchurch oder dessen Vororte zu zwängen, weshalb wir vorher schon von dieser gerade gebügelten Straße abbogen und unser Glück auf einigen Nebenstraßen versuchten. Die Informationen auf der kleinen Landkarte mit Straßennetz waren allerdings nur mangelhaft, was zwangsläufig dazu führte, dass wir uns verfuhren. Als wir endlich auf eine Ortschaft stießen, fragten wir auch sofort nach dem Weg, um festzustellen, dass es gar nicht so schlimm um uns bestellt war. Es gab eben nicht allzu viele Straßen.
Auf diese Weise kamen wir durch den Ort Lincoln, der uns in mehrfacher Hinsicht überraschte. Zum einen war die Stadt viel größer als der Fleck auf der Landkarte es vermuten ließ. Wir staunten nicht schlecht, als wir an der Universität vorbeifuhren. Kurzentschlossen kürten wir diesen Ort zu unserer Lunchrast, da sowohl ein gutes Mittagessen als auch eine Rast lange überfällig waren. In der Innenstadt fand sich ein putziger Japaner, bei dem wir gerne einkehrten. Das Lokal war recht simpel gehalten, einige Plastiktische standen nebst Plastikstühlen im Raum, die Theke war mit Leckereien gedeckt und die Mitarbeiter überzeugten durch Freundlichkeit – ganz nach japanischer Art verbeugte der Chef sich sogar. Aus einer Laune heraus, die nur Leute verstehen, die mit „The Devil is a Part-Timer“ vertraut sind, bestellte ich Katsu Don. Es war vorzüglich und so sättigend, dass es zum Abendessen nur Toast gab. Nach unserem kurzen, aber durchaus amüsanten Aufenthalt ging es weiter – back on the road again. Wir kannten jetzt den Weg und folgten den Anweisungen der Einwohner.
Als wir uns Akaroa näherten, stellten wir fest, dass es wieder in ein Gebirge ging. Mittlerweile hatte das Wetter umgeschlagen, so dass wir uns tiefhängenden Wolken und vereinzelten Regenschauern gegenübersahen. Dies ist nur deshalb erwähnenswert, weil das Gesamtbild – Berge, Felsen, Weiden, Schafe, Regen – uns den Eindruck vermittelte in Schottland angekommen zu sein. Es ging weiter über gewundene Straßen, die mit so viel Rollsplitt übersät waren (es hatte einige Tage zuvor geschneit, doch der Schnee war wieder geschmolzen), dass man eher seinetwegen als wegen möglicher Eisbildung ins Schleudern hätte geraten können. An dieser Stelle möchte ich mich beim neuseeländischen Verkehrsministerium bedanken, da seine Schilder mich darüber aufklärten, dass kurvenreiche Straßen bei Frost rutschig sein können. Wer hätte das gedacht?
Auf der anderen Seite des Berges erbot sich uns mal wieder ein einmalig bezaubernder Anblick: Die Bucht der Banks Halbinsel mit ihren kleinen Siedlungen hier und da, eingekesselt von Bergen, wurde von einem Regenbogen gekrönt. Am Horizont sah man ganz deutlich, wie das eine Ende im Meer abtauchte, während das andere auf der Landspitze ruhte. Vielleicht waren wir doch in Irland gelandet. Jetzt galt es nur diesen verdammten Kobold mit seinem Eimer voll Gold zu finden.
Anhand der Namensgebung merkte man schnell, dass die Franzosen dieses Eiland unsicher gemacht hatten. Nicht nur Straßen- und Städtenamen hatten einen französischen Touch, auch die Geschäfte und Unterkünfte klangen fremd in dieser weit entfernten Umgebung. Auch unsere Herberge trug den pittoresk anmutenden Namen „Chez la Mer“ und war von außen rosa. Das waren auch die einzigen Hinweise, die uns dabei halfen sie zu finden. Unserem Hostel möchte ich einen etwas längeren Absatz widmen, nehme aber vorweg, dass ich kein gutes Haar an dieser überteuerten Absteige lassen werde.

Es begann damit, dass das Haus wahrscheinlich älter als das neuseeländische Parlament war und ebenso wahrscheinlich nicht ein einziges Mal vernünftig renoviert wurde. Die verschiedenen Farbschichten waren wohl der einzige Grund, warum diese Sperrholzbrettansammlung noch nicht in sich zusammengefallen war. Die letzten Modernisierungsmaßnahmen fanden womöglich in den 1960ern statt. Um das Törchen zum Vorgarten zu öffnen, setzt man sich der eminenten Gefahr aus, einen Finger im Schloss einzuklemmen.
Da wir – wie immer – ein Mehrbettzimmer gebucht hatten, bekamen wir überhaupt keinen Schlüssel. Man konnte ihn nicht einmal auf Anfrage dazu buchen. Nur Einzelzimmern war solch ein Luxus vorbehalten. Dies implizierte auch, dass die Haustür nicht abgeschlossen war, weshalb jedermann beliebig hinein- und wieder hinausgehen konnte, ohne dass eine Autoritätsperson es überwachen würde. Es gab auch keine Möglichkeit den Eingangsbereich vom Wohnzimmer aus einzusehen, obwohl das Personal dort die meiste Zeit zubrachte. Kein Schlüssel hieß auch, dass unser Raum nie abgeschlossen werden konnte. Man stellte uns allerdings Schließfächer zu Verfügung – die ich problemlos unterm Arm hätte wegtragen können. Ich verstehe nicht, warum sie auch nur versuchen den Anschein zu erwecken, als würden sie sich auch nur im geringsten Maß darum kümmern, was mit meinen Habseligkeiten passiert. Später las ich in einigen Kritiken zu dieser Herberge, dass schon mehrfach Wertgegenstände aus den Zimmern gestohlen worden waren.
Darüber hinaus war unser Raum ein Durchgangszimmer, da ein Schlafsaal für Angestellte direkt daran grenzte. Diese Leute scherten sich auch einen Schmarrn darum, ob die Tür zu unserem Zimmer offen stand oder nicht – für ihre eigenen Räumlichkeiten hatten sie ja einen Schlüssel. An dieser Stelle sei noch erwähnt, dass die Eingangstür zu unserem Zimmer auf den Hof ging, wir der Kälte also schutzlos ausgeliefert waren. Davon abgesehen, konnte jeder, der an dem Raum vorbeiging, sehen, dass unsere Sachen drin lagen.
Das hatte also zur Folge, dass es eiskalt in unserem Quartier war. Nicht, dass die dünnen Wände, von denen nur eine ans Haus grenzte, irgendeine Art von Isolierung hatten, weder gegen Wärmeverlust noch gegen Schall. Selbst das hätte wenig gebracht, da zwischen Tür und Rahmen stellenweise so große Spalten waren, dass meine Hand durch gepasst hätte.
Dies erklärt vermutlich auch die Mausefalle in der Küche. Bei einer solchen Bauart lud man die Nager im Winter doch nahezu ins Haus ein. Es sprach aber auch Bände über den Reinlichkeitszustand dieses Hostels. Wir hörten, wie einige Helfer sich darüber unterhielten, wie eine Maus der Falle entwischt war. Dieses kleine, schlaube Biest hatte es geschafft den Köder in Form von Erdnussbutter aus der Falle zu stehlen, ohne diese auszulösen. Man hätte ihr sogar zu Fuß besser folgen können, da sie ihre patzigen Pfotenabdrücke überall verteilte. Besonders deutlich waren die Spuren auf den Brötchenrohlingen, die offen in der Küche darauf warteten in den Backofen geschoben zu werden. Unsere Lebensmittel würden auf jeden Fall im Auto bleiben.

Zurück zu unseren Übernachtungsbedingungen. Wir hatten ein Badezimmer, das an unseren Raum grenzte. Das Fenster darin war nicht einmal dafür konzipiert jemals geschlossen zu werden. Es war ein Loch in der Wand, in das man schräg einige Glasplatten hineingelegt hatte. An Frischluft mangelte es uns mit Sicherheit nicht. Dessen ungeachtet schälte sich die Farbe über der Dusche bereits ab und darunter krochen pelzige Kolonien schwarzen Schimmels hervor.
Um all diesen rauen Witterungsbedingungen und den sinkenden Temperaturen Einhalt zu gebieten, stand uns ein kleiner, elektrischer Heizkörper zur Verfügung. Selbstverständlich durfte man dieses Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen, weil es dank des veralteten Stromnetzes jederzeit in Flammen aufgehen und das ganze Hostel in Schutt und Asche verwandeln könnte – immer noch eine bauliche Verbesserung, wenn man mich fragt. Damit war die Beheizung des Schlafgemachs doch recht schwierig. Zumal wir recht spät ankamen, dort drinnen schon lange nicht mehr geheizt worden war, wir uns noch etwas ansehen, dann noch kochen wollten, in der Küche und Wohnzimmer blieben, weil dort ein Feuer im Kamin brannte und es entschieden wärmer war und außerdem man nur dort Internetempfang hatte. Dass die Herberge kostenlos weitere Decken und Wärmflaschen zur Verfügung stellte, war wirklich das Mindeste. Trotzdem verlangte ich nach einem weiteren Heizkörper, der mir ohne Murren gebracht wurde.
Darüber hinaus bin ich mir noch nicht einmal sicher, ob sie die Betten nach den letzten Gästen neu bezogen haben. Entweder sie hatten eine nicht voll funktionsfähige Waschmaschine oder sie machten sich nicht die Mühe, wenn die Bezüge noch nicht gebraucht genug aussahen. Jedenfalls beschwerte sich Franziska, dass ihr Bett nicht einwandfrei war.
Ich weiß nicht, was für Ansprüche andere Backpacker haben, aber ich erwarte für mein Geld schon etwas Besseres, insbesondere weil 28 $ pro Nacht zur gehobenen Preiskategorie für Mehrbettzimmer zählen. Die freundliche Helferin, die uns an diesem Tag im Hostel begrüßte, machte uns darauf aufmerksam, dass wir das Zimmer zu einem Schnäppchenpreis ergattert hatten. Ja, es war ein Mehrbettzimmer, wie wir es buchen wollten, aber es waren nur vier Betten mit Ensiute, weil keine anderen Dorms derzeit frei waren. Normalerweise kostet solch ein Quartier 35 $ pro Nacht. Mir fehlten die Worte. Das war mehr als unverschämt. Die anderen Reisenden hingegen fanden diese Bedingungen normal – für neuseeländische Verhältnisse.
Hier muss ich betonen: Das ist es nicht. Es war mit Abstand das schlechteste Hostel, in dem ich in Neuseeland untergekommen bin, und es zählte zu den teuersten. Sogar in Tschechien gibt es bessere Lebensbedingungen! Ich kann nur davon abraten im „Chez la Mer“ ein Zimmer zu buchen. Besser man investiert ein bisschen mehr Geld, wenn man einen Ausflug nach Akaroa machen will, denn ich gehe dreist davon aus, dass die Hotels und Motels bessere Bedingungen anbieten.
Zur Buchung sollte ich auch noch einige Worte verlieren. „Chez la Mer“ ist nicht bei hostelworld.com eingetragen, so dass wir direkt über die Seite der Herberge buchten. Es war allerdings nicht möglich eine Buchung mit wenigen Klicks durchzuführen, nein, man musste seine Daten in ein Formular eingeben und eine Anfrage per Mail schicken. Anstatt einer Antwort, ob ein Zimmer frei war oder nicht, bekamen wir eine Buchungsbestätigung und das Geld wurde von der Kreditkarte abgebucht. Ob wir nun mit Karte oder bar bezahlen wollten, zusammen oder getrennt, fragte man uns gar nicht erst. Ich finde dies unverschämt. Darüber hinaus hatten wir nur eine Anfrage geschickt, keine Buchung. Es hätte genauso gut sein können, dass wir uns in der Zeit schon für ein anderes Zimmer entschieden.
Alles in allem nahm ich den Aufenthalt in „Chez la Mer“ mit Galgenhumor und lächelte bei jeder neu erkannten Katastrophe.
Es überraschte mich zu sehen, dass so viele Deutsche dort längerfristig eingekehrt waren. Tatsächlich waren die meisten Gäste und Helfer deutscher Herkunft. Aber dass ihre Ansprüche so niedrig waren und sie sich diese Lebensbedingungen zumuten ließen, verwirrte mich. Eine Nacht in dieser Absteige war, in meinen Augen, die Grenze des Erträglichen.
Kommen wir nun zu dem Städtchen Akaroa.
Eingekeilt zwischen Meer und Bergen genießt man in Akaroa immerzu beeindruckende Ansichten, wohin man die Augen auch richtet. Verschiedene Boote schwankten ruhig auf den Wellen, eine gepflegte Uferpromenade erlaubte den Besuchern gemütliches Flanieren und die englische Sprache verunstaltete die französische – oder umgekehrt –, wie man an dem Schild „The Brasserie“ unschwer ablesen konnte.

Obwohl das Städtchen schon seinen Winterschlaf angetreten hatte und viele Läden zwecks Urlaub geschlossen waren, genossen wir das doch arg französisch geprägte Ambiente der Haupttouristenroute. Wie es für Neuseeland typisch war, hatte man die Häuser aus Holz gezimmert, und dennoch besaßen die Fassaden einen nicht so typischen Einschlag, der an die Côte d'Azur erinnerte.

Bevor wir unsere obligatorische, kostenlose Straßenkarte holen konnten, mussten wir noch ein bisschen Zeit totschlagen, da die i-Site erst in diesem verschlafenen Örtchen später öffnete. Aber kaum dass wir richtig ausgestattet waren, machten wir einen Plan und zogen los, die Gegend unsicher zu machen.
Zielsicher flanierten wir die Strandpromenade entlang, die durch einen Sturm einige Tage zuvor mit Kieseln und Muscheln übersät war. Kaum ein Mensch war um diese Tages- oder Jahreszeit unterwegs, was uns nur wenig störte.
Zuerst wollten wir den alten Leuchtturm sehen. Da wir dort schneller als erwartet ankamen, gingen wir die Straße weiter zu einem Gedenkstein. Dort lernten wir ein bisschen über die englisch-französischen-maori Beziehungen in Akaroa. Danach wollten wir uns den nahe gelegenen Park ansehen; gesagt, getan, und wir waren viel zu schnell durch. Tatsächlich ist Akaroa eine von Franzosen gegründete Siedlung auf englischsprachigem Boden mit einem maori Namen. Es war alles vertreten und bunt ineinander gerührt.
Trotz all dieser Aktivitäten war der Morgen noch jung, unsere Phantasie bezüglich der Sehenswürdigkeiten Akaroas aber erschöpft. Anstatt noch weiter Zeit zu schinden, brachen wir also früher als geplant auf und nahmen die etwas weniger befahrene Route über die Summit Road. Das war es allemal wert.

... link (0 Kommentare) ... comment
Montag, 27. Juli 2015
Lake Tekapo – Mai 2015
atimos, 04:20h
Fern abseits der Hauptverkehrsstrecken und „großen“ Städte zeigt Neuseeland sein wahres Gesicht. Wild, gewaltig, ungezügelt und majestätisch.

Wir begriffen schnell, dass der schwierigste Teil vom Arthur’s Pass hinter uns lag. Hat man erst einmal die Ortschaft mit demselben Namen erreicht, hat man erst einmal das Wunderwerk neuseeländischer Ingenieurskunst hinter sich gelassen, geht es mit dem State Highway 73 stetig bergab – im wörtlichen Sinn. Aber die Aussicht von dieser Seite war schlichtweg atemberaubend.
Dank unseres fahrbaren Untersatzes nahmen wir mehrfach die Gelegenheit wahr, am Straßenrand anzuhalten, um diesen Teil Neuseelands fotografisch festzuhalten. Berge, Wälder, Täler, Flüsse, Seen, Sonne. Alles fügte sich in ein sich ständig wandelndes, aber immer aufs Neue herrliches Bild. Durch diese unglaubliche Landschaft zog sich der Highway, an dessen Seiten nur wenige Häuser, geschweige denn ganze Siedlungen standen.


Endlich erreichten wir die Stadt, die uns seit geraumer Zeit auf der Landkarte entgegen prangerte, ja, uns mit ihrer Anwesenheit fast schon zu verspotten schien! Springfield. Wer hier an die Simpsons denken muss, liegt gar nicht so falsch. Immerhin ist dieses Springfield eines von zweien weltweit, das einen riesigen Donut bekam und diesen im Zentrum der Öffentlichkeit zugänglich machte. Nicht genug der Parallelen: Das Café neben der riesigen Skulptur verkaufte „Delicious Homer Donuts“.


Selbstverständlich ließen wir es uns nicht nehmen, diese Leckerbissen zu probieren – sie waren wirklich deliziös und nicht zu süß. Ein bisschen Small Talk mit der Verkäuferin gehörte zum guten Ton, so dass wir auch erfuhren, dass dieser riesige Donut der zweite war, weil irgendein Spinner den ersten abgebrannt hatte und er durch einen aus Zement ersetzt worden war. Um diesem Tag die Krone aufzusetzen, befand sich unser Hostel, obwohl in Lake Tekapo gelegen, in der Simpson Lane. Wir waren äußerst amüsiert.
Es ging weite über die Inland Scenic Route 72, die uns recht nah am Gebirge gen Süden führte. Der Unterschied zwischen der West- und Ostküste könnte kaum größer sein. Während wir die letzten Monate in einem dichten, tropischen Regenwald an Steilhängen und zerklüfteten Berglandschaften durchwachsen von gewundenen Straßen verbrachten, lagen vor uns nun ordentlich getrimmte Hecken – einige Meter hoch –, kilometerweites Flachland und glatt gebügelte Highways, auf denen man wirklich 100 km/h fahren konnte. Ich fand es ernüchternd. Das war nicht Neuseeland, das war ein englischer Vorgarten!
Wir fuhren runter bis Timaru, weil Franziska gelesen hatte, dass die Innenstadt dort sehr schön sein soll. Bei der Gelegenheit kehrten wir in den nächsten Pak'n'Safe ein, um uns mit Lebensmitteln für die nächsten Tage einzudecken. So ein großes Geschäft hatten wir seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Da waren so viel Menschen auf einmal. Und Autos. Und Ampeln!
Wie dem auch sei. Als wir an einem Parkplatz nahe dem Strand ankamen, war bereits ein ziemlich stürmischer Wind aufgezogen, so dass wir nur einen kurzen Abstecher zum Meer machten, um dann gegen den Wind ankämpfend zurück zu stolpern.
Die Ankunft in Lake Tekapo versetzte mich in einen Zustand geballter Sprachlosigkeit. Unsere Herberge lag einen Steinwurf vom See entfernt und hatte in der Lounge riesige Fenster, durch die man den ganzen Tag über die Aussicht genießen konnte. Der türkisblaue See, der von schneebedeckten Bergen gerahmt wurde, bot sich in einer Pracht dar, die Ihresgleichen sucht. Einfach nur phänomenal.


Ja, das Wasser ist wirklich so blau; ich besitze keine Bildbearbeitungsprogramme und kann damit eh nicht umgehen.
Das Hostel hatte zwei Kamine, in denen gemütliche Feuer brannten, einen schottischen Manager namens Billy, überall kostenlosen Internetzugang und ein schwarzes Brett, auf das ich später noch zu sprechen komme. Einziges Manko war der Mangel an kostenlosem Tee und Kaffee. Es war unsere erste Herberge in Neuseeland, die diesen Service nicht anbot.
Am nächsten Tag wollten wir uns dieses Naturschauspiel vor unserer Tür ein bisschen intensiver zu Gemüte führen und suchten uns dafür einen der zahlreichen Wanderwege.
Als wir auszogen Mordor zu finden und in Sopot ankamen.
Es gab die Wege 2 und 3, die den gleichen Anfang nahmen und sich erst später voneinander trennten, weshalb wir uns spontan entscheiden konnten, ob wir uns den längeren von 3 Stunden zutrauten oder uns doch mit nur 2 Stunden Wanderzeit begnügten. Der Aufstieg war ein bisschen steil, doch nicht unangenehm. Das luftige Nadelwäldchen erinnerte mich stark an den polnischen Ferienort Sopot, dessen Boden auch immer mit vertrockneten Nadeln übersät ist.

Es war unglaublich, dass wir in Neuseeland waren, denn vieles hier erinnerte an Europa. Je näher wir dem Gipfel kamen, umso spärlicher wurde die Vegetation, obwohl es nicht so hoch war. Es wurde auch immer windiger. Auf dem Gipfel dieses Bergchens, Mt. John genannt, steht ein Observatorium, das dank des „Lichtreservates“ um Lake Tekapo hervorragende Bilder des südlichen Sternenhimmels liefert. Bei Tag ist die Aussicht von diesem Gipfel ebenfalls herrlich. Der See ist von allen Seiten von Bergen umgeben, manche sind näher, andere weiter weg. Alle sind sie schön anzusehen. Ich kann immer noch nicht glauben, wie intensiv die Farbe dieses Sees ist.

Während wir den zerklüfteten Gipfel hinter uns ließen und auf Weideland traten, entschieden wir uns für den langen Weg zurück, da wir eh noch nicht so lange unterwegs waren. Im Hintergrund verbrannten einige Orks irgendetwas, aber da die Rauchsäule fernab unserer Strecke lag, kümmerten wir uns nicht weiter um sie. Stattdessen genoss ich die Stille dieser malerischen Umgebung sowie die Freiheit des Wanderns. Es ging über Wiesen, zwischen Sträuchern hindurch, über Versorgungswege, hoch am See entlang.
Nach zweieinhalb Stunden kamen wir wieder am Parkplatz an und machten uns auf den Heimweg. Der beständige Wind hatte zumindest meine erste Hautschicht abgefroren.
Tags darauf zogen wir aus uns Mt. Cook, den höchsten Berg an diesem Ende der Welt, anzusehen. Die Strecke war nicht gesperrt, also konnte es nach einem guten Frühstück losgehen. Ich kann nicht einmal erahnen, wie oft wir Halt machten, um die allgegenwärtigen Postkartenmotive von unseren nichtswürdigen Kameras einzufangen – oder es zumindest zu versuchen. Die gesamte Farbpalette der Blautöne fing sich in den weit entlegenen Bergketten. Hinzu kam Lake Pukaki, dessen türkisblau mit dem von Lake Tekapo konkurrierte.

Die kahlen Ebenen vor Mt. Cook, die von trockenen Grasbüscheln bedeckt waren, ließen den Berg deplatziert wirken. Steppe, Flussbett, Steppe, Fluss, Steppe, pop!, Berg. Es war recht antiklimaktisch.

Die Siedlung, Aoraki, ist winzig, hat aber ein Luxushotel, das durch eine lange Geschichte mit der Region verwachsen ist – länger als das Parlament in Wellington steht. Im Informations- und Wissenschaftszentrum (es ist keine i-Site) gab es ein kleines Regionalmuseum, das aufschlussreicher als Te Papa war.

Nachdem wir uns diese unerwarteten Informationen zur Geschichte des Bergsteigens in der Gegend durchgelesen hatten, machten wir in einem Café Halt für Lunch. Es gab Scones und Wedges Danach unternahmen wir eine Wanderung vom Hooker Valley zum Kea Point, die insgesamt eine Stunde dauern sollte, allerdings nicht unsere zügige Gangart berücksichtigte. Zwar sahen wir keine Keas, hatten dafür aber eine spektakuläre Sicht auf Mt. Cook. Je näher wir den Bergen kamen, umso mehr entsprachen sie meinen Erwartungen. Grüne Büsche schmiegten sich an felsigen Flanken, dazwischen lagen Tonnen von Geröll, Zeugen vergangener Erdrutsche, doch je höher man blickte, umso rauer wurden die Kanten, bis die Flora von Schnee und Eis abgelöst wurde. Geht doch.

Bevor die Europäer Fuß in dieses Land gesetzt hatten, sah die gesamte Ebene so aus. Aber für die Schafzucht hatten die Bauern alle Büsche brandgerodet, so dass nur noch diese trübe Steppenlandschaft übrig blieb. Da mittlerweile Kaninchen den Schafen das Gras unter der Schnauze wegfraßen, konnten hier momentan auch keine Wolllieferanten gehalten werden, zumindest nicht bis das Problem mit den Langohren behoben war.
Am Ende der Strecke angekommen bot sich uns eine wirklich prächtige Sicht auf Mt Cook, der mit seiner ewigen Eiskuppel einsam in der Ferne emporragt. Es gab sogar eine hölzerne Plattform, von der aus man den perfekten Blick auf den Gipfel werfen konnte.

Alles in allem war es ein sehr schöner Ausflug mit hervorragendem Wanderwetter. Dann war es Zeit für den Aufbruch zurück nach Lake Tekapo.
Am eingangs erwähnten schwarzen Brett hing eine Karte des nächtlichen Sternenhimmels, ausgestellt und ausgeteilt vom Observatorium auf Mt. John. Darauf waren einige wichtige Sternenbilder, helle Sterne und die Milchstraße eingezeichnet, zusammen mit einer Anweisung, wie man die Karte halten muss, um alles zu finden. Ja, endlich, hier war Crux, das Kreuz des Südens, ganz deutlich vor mir – nicht nur auf dem Papier, das Billy mir freundlicherweise kopiert hatten, sondern auch über mir am nächtlichen Sternenhimmel. Ein schöner Abschluss dieses Tages. Endlich fand ich das Kreuz des Südens.
In Lake Tekapo gab es zudem eine kleine Kirche, die, wie könnte es anders sein, idyllisch am Flussufer stand. Die Kirche zum guten Hirten war ein aus Stein gebauter Touristenmagnet – ich bin mir nicht so ganz sicher, woran es lag. Wie dem auch sei, nicht weit von der Kirche entfernt baute man gerade eine neue Fußgängerbrücke. Welcher Grund für den Neubau sprach, blieb trotz intensiven Studiums der Informationstafel verborgen, aber die Grundpfeiler standen schon. Nun war die zuständige Organisation auf Spenden auf der Bevölkerung angewiesen, da die Kosten des Projekts – oh wundern, oh staunen – doch wesentlich höher ausfallen würden, als anfangs angenommen. Dass es bereits eine funktionierende Brücke für Autos und Fußgänger gleichermaßen gab, fand in dem Text nicht die geringste Erwähnung. Wahrscheinlich war das derzeit vorhandene, pragmatisch angelegte Bauwerk nicht würdig genug vor einem derart bezaubernden Hintergrund zu stehen. Anders kann ich mir den Bau einer neuen Brücke nicht erklären. Diese kurze Begebenheit erwähne ich nur, weil ich sie lustig fand.

Wir begriffen schnell, dass der schwierigste Teil vom Arthur’s Pass hinter uns lag. Hat man erst einmal die Ortschaft mit demselben Namen erreicht, hat man erst einmal das Wunderwerk neuseeländischer Ingenieurskunst hinter sich gelassen, geht es mit dem State Highway 73 stetig bergab – im wörtlichen Sinn. Aber die Aussicht von dieser Seite war schlichtweg atemberaubend.
Dank unseres fahrbaren Untersatzes nahmen wir mehrfach die Gelegenheit wahr, am Straßenrand anzuhalten, um diesen Teil Neuseelands fotografisch festzuhalten. Berge, Wälder, Täler, Flüsse, Seen, Sonne. Alles fügte sich in ein sich ständig wandelndes, aber immer aufs Neue herrliches Bild. Durch diese unglaubliche Landschaft zog sich der Highway, an dessen Seiten nur wenige Häuser, geschweige denn ganze Siedlungen standen.


Endlich erreichten wir die Stadt, die uns seit geraumer Zeit auf der Landkarte entgegen prangerte, ja, uns mit ihrer Anwesenheit fast schon zu verspotten schien! Springfield. Wer hier an die Simpsons denken muss, liegt gar nicht so falsch. Immerhin ist dieses Springfield eines von zweien weltweit, das einen riesigen Donut bekam und diesen im Zentrum der Öffentlichkeit zugänglich machte. Nicht genug der Parallelen: Das Café neben der riesigen Skulptur verkaufte „Delicious Homer Donuts“.


Selbstverständlich ließen wir es uns nicht nehmen, diese Leckerbissen zu probieren – sie waren wirklich deliziös und nicht zu süß. Ein bisschen Small Talk mit der Verkäuferin gehörte zum guten Ton, so dass wir auch erfuhren, dass dieser riesige Donut der zweite war, weil irgendein Spinner den ersten abgebrannt hatte und er durch einen aus Zement ersetzt worden war. Um diesem Tag die Krone aufzusetzen, befand sich unser Hostel, obwohl in Lake Tekapo gelegen, in der Simpson Lane. Wir waren äußerst amüsiert.
Es ging weite über die Inland Scenic Route 72, die uns recht nah am Gebirge gen Süden führte. Der Unterschied zwischen der West- und Ostküste könnte kaum größer sein. Während wir die letzten Monate in einem dichten, tropischen Regenwald an Steilhängen und zerklüfteten Berglandschaften durchwachsen von gewundenen Straßen verbrachten, lagen vor uns nun ordentlich getrimmte Hecken – einige Meter hoch –, kilometerweites Flachland und glatt gebügelte Highways, auf denen man wirklich 100 km/h fahren konnte. Ich fand es ernüchternd. Das war nicht Neuseeland, das war ein englischer Vorgarten!
Wir fuhren runter bis Timaru, weil Franziska gelesen hatte, dass die Innenstadt dort sehr schön sein soll. Bei der Gelegenheit kehrten wir in den nächsten Pak'n'Safe ein, um uns mit Lebensmitteln für die nächsten Tage einzudecken. So ein großes Geschäft hatten wir seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Da waren so viel Menschen auf einmal. Und Autos. Und Ampeln!
Wie dem auch sei. Als wir an einem Parkplatz nahe dem Strand ankamen, war bereits ein ziemlich stürmischer Wind aufgezogen, so dass wir nur einen kurzen Abstecher zum Meer machten, um dann gegen den Wind ankämpfend zurück zu stolpern.
Die Ankunft in Lake Tekapo versetzte mich in einen Zustand geballter Sprachlosigkeit. Unsere Herberge lag einen Steinwurf vom See entfernt und hatte in der Lounge riesige Fenster, durch die man den ganzen Tag über die Aussicht genießen konnte. Der türkisblaue See, der von schneebedeckten Bergen gerahmt wurde, bot sich in einer Pracht dar, die Ihresgleichen sucht. Einfach nur phänomenal.


Ja, das Wasser ist wirklich so blau; ich besitze keine Bildbearbeitungsprogramme und kann damit eh nicht umgehen.
Das Hostel hatte zwei Kamine, in denen gemütliche Feuer brannten, einen schottischen Manager namens Billy, überall kostenlosen Internetzugang und ein schwarzes Brett, auf das ich später noch zu sprechen komme. Einziges Manko war der Mangel an kostenlosem Tee und Kaffee. Es war unsere erste Herberge in Neuseeland, die diesen Service nicht anbot.
Am nächsten Tag wollten wir uns dieses Naturschauspiel vor unserer Tür ein bisschen intensiver zu Gemüte führen und suchten uns dafür einen der zahlreichen Wanderwege.
Als wir auszogen Mordor zu finden und in Sopot ankamen.
Es gab die Wege 2 und 3, die den gleichen Anfang nahmen und sich erst später voneinander trennten, weshalb wir uns spontan entscheiden konnten, ob wir uns den längeren von 3 Stunden zutrauten oder uns doch mit nur 2 Stunden Wanderzeit begnügten. Der Aufstieg war ein bisschen steil, doch nicht unangenehm. Das luftige Nadelwäldchen erinnerte mich stark an den polnischen Ferienort Sopot, dessen Boden auch immer mit vertrockneten Nadeln übersät ist.

Es war unglaublich, dass wir in Neuseeland waren, denn vieles hier erinnerte an Europa. Je näher wir dem Gipfel kamen, umso spärlicher wurde die Vegetation, obwohl es nicht so hoch war. Es wurde auch immer windiger. Auf dem Gipfel dieses Bergchens, Mt. John genannt, steht ein Observatorium, das dank des „Lichtreservates“ um Lake Tekapo hervorragende Bilder des südlichen Sternenhimmels liefert. Bei Tag ist die Aussicht von diesem Gipfel ebenfalls herrlich. Der See ist von allen Seiten von Bergen umgeben, manche sind näher, andere weiter weg. Alle sind sie schön anzusehen. Ich kann immer noch nicht glauben, wie intensiv die Farbe dieses Sees ist.

Während wir den zerklüfteten Gipfel hinter uns ließen und auf Weideland traten, entschieden wir uns für den langen Weg zurück, da wir eh noch nicht so lange unterwegs waren. Im Hintergrund verbrannten einige Orks irgendetwas, aber da die Rauchsäule fernab unserer Strecke lag, kümmerten wir uns nicht weiter um sie. Stattdessen genoss ich die Stille dieser malerischen Umgebung sowie die Freiheit des Wanderns. Es ging über Wiesen, zwischen Sträuchern hindurch, über Versorgungswege, hoch am See entlang.
Nach zweieinhalb Stunden kamen wir wieder am Parkplatz an und machten uns auf den Heimweg. Der beständige Wind hatte zumindest meine erste Hautschicht abgefroren.
Tags darauf zogen wir aus uns Mt. Cook, den höchsten Berg an diesem Ende der Welt, anzusehen. Die Strecke war nicht gesperrt, also konnte es nach einem guten Frühstück losgehen. Ich kann nicht einmal erahnen, wie oft wir Halt machten, um die allgegenwärtigen Postkartenmotive von unseren nichtswürdigen Kameras einzufangen – oder es zumindest zu versuchen. Die gesamte Farbpalette der Blautöne fing sich in den weit entlegenen Bergketten. Hinzu kam Lake Pukaki, dessen türkisblau mit dem von Lake Tekapo konkurrierte.

Die kahlen Ebenen vor Mt. Cook, die von trockenen Grasbüscheln bedeckt waren, ließen den Berg deplatziert wirken. Steppe, Flussbett, Steppe, Fluss, Steppe, pop!, Berg. Es war recht antiklimaktisch.

Die Siedlung, Aoraki, ist winzig, hat aber ein Luxushotel, das durch eine lange Geschichte mit der Region verwachsen ist – länger als das Parlament in Wellington steht. Im Informations- und Wissenschaftszentrum (es ist keine i-Site) gab es ein kleines Regionalmuseum, das aufschlussreicher als Te Papa war.

Nachdem wir uns diese unerwarteten Informationen zur Geschichte des Bergsteigens in der Gegend durchgelesen hatten, machten wir in einem Café Halt für Lunch. Es gab Scones und Wedges Danach unternahmen wir eine Wanderung vom Hooker Valley zum Kea Point, die insgesamt eine Stunde dauern sollte, allerdings nicht unsere zügige Gangart berücksichtigte. Zwar sahen wir keine Keas, hatten dafür aber eine spektakuläre Sicht auf Mt. Cook. Je näher wir den Bergen kamen, umso mehr entsprachen sie meinen Erwartungen. Grüne Büsche schmiegten sich an felsigen Flanken, dazwischen lagen Tonnen von Geröll, Zeugen vergangener Erdrutsche, doch je höher man blickte, umso rauer wurden die Kanten, bis die Flora von Schnee und Eis abgelöst wurde. Geht doch.

Bevor die Europäer Fuß in dieses Land gesetzt hatten, sah die gesamte Ebene so aus. Aber für die Schafzucht hatten die Bauern alle Büsche brandgerodet, so dass nur noch diese trübe Steppenlandschaft übrig blieb. Da mittlerweile Kaninchen den Schafen das Gras unter der Schnauze wegfraßen, konnten hier momentan auch keine Wolllieferanten gehalten werden, zumindest nicht bis das Problem mit den Langohren behoben war.
Am Ende der Strecke angekommen bot sich uns eine wirklich prächtige Sicht auf Mt Cook, der mit seiner ewigen Eiskuppel einsam in der Ferne emporragt. Es gab sogar eine hölzerne Plattform, von der aus man den perfekten Blick auf den Gipfel werfen konnte.

Alles in allem war es ein sehr schöner Ausflug mit hervorragendem Wanderwetter. Dann war es Zeit für den Aufbruch zurück nach Lake Tekapo.
Am eingangs erwähnten schwarzen Brett hing eine Karte des nächtlichen Sternenhimmels, ausgestellt und ausgeteilt vom Observatorium auf Mt. John. Darauf waren einige wichtige Sternenbilder, helle Sterne und die Milchstraße eingezeichnet, zusammen mit einer Anweisung, wie man die Karte halten muss, um alles zu finden. Ja, endlich, hier war Crux, das Kreuz des Südens, ganz deutlich vor mir – nicht nur auf dem Papier, das Billy mir freundlicherweise kopiert hatten, sondern auch über mir am nächtlichen Sternenhimmel. Ein schöner Abschluss dieses Tages. Endlich fand ich das Kreuz des Südens.
In Lake Tekapo gab es zudem eine kleine Kirche, die, wie könnte es anders sein, idyllisch am Flussufer stand. Die Kirche zum guten Hirten war ein aus Stein gebauter Touristenmagnet – ich bin mir nicht so ganz sicher, woran es lag. Wie dem auch sei, nicht weit von der Kirche entfernt baute man gerade eine neue Fußgängerbrücke. Welcher Grund für den Neubau sprach, blieb trotz intensiven Studiums der Informationstafel verborgen, aber die Grundpfeiler standen schon. Nun war die zuständige Organisation auf Spenden auf der Bevölkerung angewiesen, da die Kosten des Projekts – oh wundern, oh staunen – doch wesentlich höher ausfallen würden, als anfangs angenommen. Dass es bereits eine funktionierende Brücke für Autos und Fußgänger gleichermaßen gab, fand in dem Text nicht die geringste Erwähnung. Wahrscheinlich war das derzeit vorhandene, pragmatisch angelegte Bauwerk nicht würdig genug vor einem derart bezaubernden Hintergrund zu stehen. Anders kann ich mir den Bau einer neuen Brücke nicht erklären. Diese kurze Begebenheit erwähne ich nur, weil ich sie lustig fand.
... link (0 Kommentare) ... comment
Sonntag, 19. Juli 2015
Arthur’s Pass – Mai 2015
atimos, 11:40h
Als wir auszogen, das andere Ende der Welt zu sehen und Bayern vorfanden.

Die Fahrt nach Arthur’s Pass war mehr als abenteuerlich. Da wir nicht die ganze Strecke zurück nach Greymouth oder zu Kumara Junction fahren wollten, beschlossen wir eine frühere Abzweigung zu nehmen, die uns über eine Hauptverbindungsstraße auf den State Highway 73 bringen würde. Was vor uns lag, kam ganz unerwartet. Plötzlich kündigte ein Schild das Ende der asphaltierten Straße an und es ging über eine Geröllpiste weiter. Ich verstehe so etwas, wenn man auf einen Parkplatz fährt oder sich einer entlegenen, natürlichen Attraktion näher. Aber dass ein beliebiges Stück Straße, auf der man 100 km/h fahren darf, nicht befestig ist, sah ich zum ersten Mal.
Als wir dann endlich auf dem Highway waren, setzte ein so starker Regen ein, dass ich erst einmal eine Pause machte. Auch die Höchstgeschwindigkeit fand ich für die Beschaffenheit der Straße und ihren Verlauf viel zu hoch angebracht, so dass ich nur auf kurzen Abschnitten an ihr kratzte. Da gab es hier enge Kurven, dort einspurige Brücken (ich betone noch einmal: State Highway), gefolgt von Steigungen und Gefällen. Manchmal schaffte das Auto nicht mehr als 40 km/h. Alles in allem hatte ich wenig Gelegenheit diese bestimmt sehenswerte Strecke in Augenschein zu nehmen, was nicht nur an den schlechten Sichtverhältnissen und der Dunkelheit lag. Tatsächlich war ich froh, als wir in Arthur’s Pass ankamen und unsere Herberge auf mehr als 700 Metern über NN fanden.
Das… mir fehlt ein passender Begriff für diese Ansammlung von Gebäuden am Straßenrand … Die Siedlung Arthur’s Pass liegt im gleichnamigen Nationalpark Neuseelands, beherbergt – laut Wikipedia – 29 Einwohner und zwingt den Autofahrern eine Höchstgeschwindigkeit von gerade einmal 50 km/h auf, da das Ortszentrum sich direkt an den State Highway 73 schmiegt. Auch der Zug von Greymouth nach Christchurch findet hier einen schnuckeligen Bahnhof, an dem die Menschenmassen hinaus- und wieder hineinströmen können. Alles in allem liegt das Dörfchen sehr idyllisch und hat mit Sicherheit nicht die Probleme einer Großstadt. Leider fehlt es der Siedlung aber auch ein bisschen an Charme. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber wenn man schon in einem Nationalpark sein Heim erbaut, sollte es doch diesen Stolz und die Verbundenheit mit der Natur widerspiegeln – meiner Meinung nach jedenfalls. Arthur’s Pass hingegen schien seinen Frohmut aus Greymouth zu importieren. Ein grobschlächtiger Fehler, der noch korrigiert werden muss.
Es gibt wahrscheinlich keine Häuseransammlung in Neuseeland, die, wenn sie aus mindestens zwei Gebäuden besteht, nicht mindestens ein Hotel, Hostel oder Motel zu bieten hat. Sogar in Arthur’s Pass finden sich drei Unterkunftsmöglichkeiten (eine vierte Stand verlassen am Wegesrand; siehe Foto oben). Wir bezogen Quartier im Mountain House, einer Mischung aus Herberge und Motel. Im Gegensatz zur Behausung in Greymouth war es hier richtig warm, da Heizungen und Klimaanlagen ihr Möglichstes taten, um der nächtlichen Kälte dieser Gegend Einhalt zu gebieten. Tags darauf stellten wir fest, dass die Sonne in dieser Höhe auch nicht mehr so viel Wärme spendete, was wohl auch daran gelegen haben könnte, dass sie die meiste Zeit des Tages hinter Bergen her kroch.
Die Herberge war gemütlich, die Küche geräumig, der Manager freundlich sowie hilfsbereit und es gab nur gewisse Beanstandungen bezüglich der Reinlichkeit. Im oberen Stockwerk gab es eine gemütlich Lounge mit vielen Sofas, Sesseln, Kaffeetischen und einer kleinen Teeküche.
Allerdings möchte ich an einigen Dingen Kritik üben: Zwar haben die neuseeländischen Behörden den Sinn sanitärer Einrichtungen verstanden, aber in manchen Gegenden ist das Prinzip von Duschen und Waschbecken noch nicht ganz angekommen. Wenn ich mit meiner deutschen Durchschnittsgröße kaum Platz habe, um mich um die eigene Achse zu drehen und darauf achten muss, wie ich die Arme bewege, ohne mich an der nächsten Wand zu stoßen, möchte ich nicht wissen, wie zwei-Meter-Menschen in diesen engen Verhältnissen zurechtkommen. Darüber hinaus finde ich es im 21. Jahrhundert in einem Industrieland unangebracht separate Wasserhähne für kaltes und heißes Wasser zu haben, auch wenn es nur das Waschbecken ist. Es gibt ein Spektrum zwischen kochendheiß und eiskalt, das ich sehr gerne bei meiner täglichen Zahnpflege ausnutze. Ebenso sollte der Abstand der Wasserhähne zum Waschbecken so bemessen sein, dass beide Hände gemütlich Platz darunter finden, nicht nur die Fingerspitzen. Kein Wunder, dass das Bad jeden Tag unter Wasser stand. Man konnte sich nicht das Gesicht waschen, ohne zu kleckern.
Ein ganz anderes Thema ist das Wlan in diesem Hostel: Es ist unverschämt teuer. Da verlangte der Empfangsmensch doch tatsächlich 5 $ für einen halben Tag! Wir verzichteten dankend, zumal ich hervorragenden Empfang mit meinem Smartphone hatte.
In einem Achtbettzimmer nur eine Steckdose zu montieren ist aus meiner Perspektive hirnrissig. Selbst für eine Person ist eine Steckdose in einem Raum zu wenig, es sei denn, es handelt sich um eine winzige Abstellkammer. In Anbetracht der elektrischen Geräte, die ein Durchschnittsmensch heutzutage mit sich führt, war auch der Mehrfachstecker mit vier Plätzen nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Ein bisschen mehr Verständnis für junge Leute hätte ich in einem Land voller Backpacker erwartet.
An unserem ersten Tag in diesem Hostel legten wir eine Pause von all den Aufregungen der letzten Zeit ein. Wir spazierten durch den Ort, ohne eine richtige Wanderroute einzuschlagen, folgten dann einem historischen Pfad durch die Siedlung, aber es stellte sich heraus, dass dies einer Schnitzeljagd ohne ausreichende Hinweise gleichkam. Wir fanden die Plaketten 9, 10, 11, gefolgt von 8 und 1, dann fanden wir durch Zufall 4, 3, 2,7. Um den Highway 73 nicht noch einmal rauf und runter zu stolpern, fragten wir an der Rezeption, wo die Informationsschilder 5 und 6 waren. Vermutlich hätten wir sie ohne Hilfe nie aufgespürt. Als wir dann an einem frostigen Morgen den Beschreibungen des Hostelmitarbeiters folgten, fanden wir eine herrliche Landschaft vor, die selbst mit einfachen Schuhen und nicht-alpiner Ausrüstung hätte bewandert werden können. Leider drängte unser Zeitplan und wir mussten darauf verzichten. Trotzdem hatten wir alle Plaketten der historischen Stadtführung gefunden, womit wir sehr zufrieden waren.
Der „Millennium Walk“ war äußerst enttäuschend. Wir folgten den Schildern, entdeckten einen kleinen, schmalen Pfad zu einer Aussichtsplattform, von der aus man einen phantastischen Blick auf den kleinen Wasserfall hatte, gingen zurück, über die Brücke einen Pfad entlang, vorbei am Startpunkt zum Avalanche Peak, um dann wieder an einem Schild anzukommen, das uns zurückschickte, wenn wir den Millennium Walk machen wollten. Ein Blick auf die Karte im DOC-Gebäude ließ uns darauf schließen, dass der Aussichtspunkt am Wasserfall dieser Millennium Walk sein sollte. Er dauerte zwei Minuten.

Abenteuerlich war besonders die Polizeistation dieses Ortes.
Mehr muss ich dazu wohl nicht sagen.
An diesem Abend sah ich zum ersten Mal einen Kea. Der Vogel saß auf dem Dach des Arthur’s Pass Store / Café und krächzte munter vor sich hin. Leider waren die Lichtverhältnisse nicht mehr gut genug für ein Foto und das Tierchen wollte partout nicht näher kommen. Dennoch war ich von seiner Größe überrascht, weil ich erwartete hätte, dass er kleiner wäre. Meine zweite Begegnung mit diesen possierlichen Tierchen verlief ähnlich, so dass ich nicht viel zu der Gattung schreiben kann. Es kann sogar sein, dass es ein und derselbe Vogel war. Trotzdem bin ich froh, ihn mal live gesehen zu haben.
Franziska wünschte sich einen Ausflug nach Shantytown, einer Erlebnisstätte für die ganze Familie, die einem Freilichtmuseum wohl am nächsten kommt.
Shantytown liegt ca. 35 km nördlich von Hokitika, aber wir waren bereits in unserer Herberge am Arthur’s Pass, so dass wir ungefähr eineinhalb Stunden Fahrt über einen äußerst gewundenen und abenteuerlichen State Highway auf uns nehmen mussten. Dieses Mal fuhr Franziska und es amüsierte uns beide, dass sie diesen ach so viel befahrenen Highway zur perfekten Gelegenheit für erste Fahrversuche mit einem Automatikfahrzeug erklärte. Sie meisterte ihre Aufgabe gut, so dass sie nach kurzer Zeit nur die üblichen Problemchen mit Blinker und Scheibenwischer hatte. Verständlich, wie ich finde. Wir kamen jedenfalls sicher und ohne Zwischenfälle, aber auch zügig an unserem Ziel an. Zwischendurch bleiben wir noch zweimal stehen, um an ausgeschilderten Plätzen die wunderschöne Landschaft in uns aufzunehmen. Leider mussten wir feststellen, dass tiefhängende Wolken die Sicht doch beachtlich trübten. Auf dem Rückweg hingegen stellten wir fest, dass diese Aussichtspunkte weniger der Natur als viel mehr neuseeländischer Ingenieurskunst huldigten.

Von ihnen aus sollte man die technischen Wunderbauten bestaunen, die eine Fahrt durch den Arthur’s Pass überhaupt erst ermöglichten. Die Neuseeländer sollten mal von ihrer kleinen Insel runter kommen und quer durch Österreich und die Schweiz fahren, um zu lernen, wie man anderenorts mit einigen kleinen Bergen umgeht.
Zurück zu Shantytown.
Vorab: Shantytown ist in puncto Information und medialer Darstellung wesentlich besser als Te Papa. Auch wenn Franziska anfangs skeptisch war, weil der Flyer Entertainment und lebende Geschichte versprach, so überzeugte das Gesamtkonzept doch allemal. Die Mischung aus Wissen, Hintergrundinformationen, verschiedenen Medien und Spaßelementen war hervorragend abgestimmt. Ich entschuldige mich im Voraus dafür, dass ich immer wieder Bezug zu Te Papa nehmen werde, zumal dieser selten ein gutes Haar an dem Nationalmuseum lassen wird. Allerdings finde ich, dass man diese beiden Museen nicht separat betrachten kann, wenn man sie sah. Insbesondere dann nicht, wenn man mit hohen Erwartungen in Te Papa rein ging und Shantytown erst skeptisch betrachtete.
Aber ich sollte am Anfang anfangen.
An der Rezeption begrüßte uns eine freundliche Dame, die uns sogleich deutschsprachige Infoflyer mit Karten des Geländes aushändigte. Diese waren bewusst auf alt getrimmt, auf braunem Papier gedruckt und allgemein sehr schön gemacht. Die Dame sagte uns zudem, wann der nächste Zug abfahren würde und dass wir ihn so oft benutzen konnten, wie wir es nur wollten. (Da wir laut Flyer mindestens 90 Minuten für das Museum einplanen sollten, gingen wir davon aus, dass wir nur eine Gelegenheit für die Zugfahrt haben würden.) Unseren Rabattcoupon von 20% nahm die Dame auch freundlich entgegen. Dann ging es auch schon los.
Der erste Eindruck von Shantytown erinnerte ein bisschen an eine Wildweststadt.

Es verwundert kaum, da die Stadt das Leben zu Zeiten des neuseeländischen Goldrausches darstellen sollte, aber die Kulisse, also der Regenwald an der Westküste, war ganz anders. Von dem nicht sonderlich linearen, stilistisch aber besonders schönem Aufbau erst einmal erschlagen, beschlossen wir einfach bei 1 auf unserer Karte anzufangen und uns der Reihe nach bis 40 durchzuarbeiten. Einige Ausstellungsstücke nahmen nur wenige Augenblicke in Anspruch (das riesige Wasserrad beispielsweise); für andere brauchten wir allerdings geraume Zeit, weil so viele Informationen auf engem Raum präsentiert wurden (Chinatown zählte zu letzterem ). Te Papa verlor kein Wort über chinesische – oder allgemein nicht europäische – Einwanderer. Hier konnte man die Behausungen chinesischer Goldgräber betreten – Nachbauten versteht sich – und einige persönliche Schicksale nachverfolgen. Ebenso war ein Spaziergang durch eine Goldmine möglich. Beachtlich war, dass die meisten Chinesen nur nach Neuseeland kamen, um nach Jahren harter Arbeit als reiche Männer zurück ins Heimatland zu gehen. Selbstverständlich gelang es nicht allen, aber dies zeigte uns, wo von Anfang an die Prioritäten vieler Einwanderer lagen – damals wie heute. Dementsprechend sahen die Behausungen dieser Einwanderer auch aus: Sie waren funktional und spartanisch, bereit jeder Zeit abgerissen zu werden. Bis heute sehen viele Städte in Neuseeland, insbesondere an der Westküste, so aus, als ob die Einwohner nur auf ein Zeichen warten würden, um ihre Siebensachen zu packen und weiter zu ziehen, dem Glück hinterher. Manchmal scheint es, als wären sie nie richtig angekommen – wie die Unmengen an jährlichen Backpackern. Ein relativ kleiner Abschnitt dieses Freilichtmuseums vermochte die Mentalität der heutigen Neuseeländer tiefergreifend zu erklären als ihr gesamtes Nationalmuseum.
). Te Papa verlor kein Wort über chinesische – oder allgemein nicht europäische – Einwanderer. Hier konnte man die Behausungen chinesischer Goldgräber betreten – Nachbauten versteht sich – und einige persönliche Schicksale nachverfolgen. Ebenso war ein Spaziergang durch eine Goldmine möglich. Beachtlich war, dass die meisten Chinesen nur nach Neuseeland kamen, um nach Jahren harter Arbeit als reiche Männer zurück ins Heimatland zu gehen. Selbstverständlich gelang es nicht allen, aber dies zeigte uns, wo von Anfang an die Prioritäten vieler Einwanderer lagen – damals wie heute. Dementsprechend sahen die Behausungen dieser Einwanderer auch aus: Sie waren funktional und spartanisch, bereit jeder Zeit abgerissen zu werden. Bis heute sehen viele Städte in Neuseeland, insbesondere an der Westküste, so aus, als ob die Einwohner nur auf ein Zeichen warten würden, um ihre Siebensachen zu packen und weiter zu ziehen, dem Glück hinterher. Manchmal scheint es, als wären sie nie richtig angekommen – wie die Unmengen an jährlichen Backpackern. Ein relativ kleiner Abschnitt dieses Freilichtmuseums vermochte die Mentalität der heutigen Neuseeländer tiefergreifend zu erklären als ihr gesamtes Nationalmuseum.
Ich schweife ab. Entschuldigung.
Nach Chinatown war es Zeit für die Zugfahrt. Ich war ganz ergriffen von der Vorstellung mit einer historischen Dampflokomotive zu fahren. Natürlich standen wir wie für Deutsche üblich viel zu früh am Bahnhof und warteten ungeduldig auf den Zug. Als die Lok einfuhr, machte sie erst einmal eine große Show: Dampf quoll in dicken Schwaden aus dem Schornstein vorne und zwischen den Rädern hervor; die Lok blieb stehen, um von jedem bestaunt und fotografiert werden zu können; die Lokführerin betätigte die laute Pfeife, so dass man den Zug noch im nächsten Ort hörte. Perfekte Inszenierung. Als die Lok endlich an den Wagen angedockt hatte, durften wir Passagiere einsteigen.

Während der Fahrt gab es eine automatische Durchsage zu den verschiedenen Stationen, der Strecke und dem Zug, aber es war so laut im Wagon, dass ich kaum etwas verstand. Als die Lok den Wagon anschob, bildete sich eine enorme Dampfwolke um das Fahrzeug, so dass wir es gar nicht mehr sehen konnten. Ich verstand, warum die Lokomotive den Wagon anschob, anstatt ihn zu ziehen. Hinter uns war nur noch eine weiße Wand zu sehen.
Es ging quer durch den Regenwald an einigen Ausstellungshäusern (Sägemühle, Goldauswaschbecken) vorbei zum Ende der Strecke, wo wir eine kurze Rast einlegten, uns Informationen über die Arbeitsbedingungen der Arbeiter vor 150 Jahren durchlesen konnte, etwas über den hiesigen Regenwald erfuhren und uns die Lok aus der Nähe ansehen durften. Die Lokführerin beantwortete sogar freudig jede Frage und plauschte gerne mit ihren Fahrgästen.
Dann ging es wieder zurück, wobei der Großteil der Gruppe an der Sägemühle ausstieg, um von dort zu Fuß ins „Zentrum“ von Shantytown zurückzukehren, natürlich nicht ohne vorher ein bisschen Gold auszuwaschen. Wir fuhren einfach mit dem Zug weiter. Immerhin war es Zeit für Lunch und wir wollten kein Gold schürfen.

Zum Lunch begaben wir uns ins King Dick’s Café, das, da es sich auf dem Gelände befand und zu den Ausstellungsstücken gehörte, ebenfalls die damalige Atmosphäre durch eine stilistisch angeknackste Einrichtung widerspiegelte. Das meine ich mit einer großen Portion Humor, denn die Stilbrüche waren teilweise notwendig. Kaffeeautomaten und Energiesparglühbirnen waren nur zwei Beispiele davon. Außerdem versuchte man altes Dekor mit modernen Gesundheitsbestimmungen zu kombinieren, was nicht immer gelang.
Unser Gutschein über einen kostenlosen Kaffee / Tee konnten wir hier problemlos einlösen, auch wenn es sich um große Portionen handelte, die sonst 5 NZ$ oder mehr gekostet hätten. Dazu nahmen wir Pie. Es war schließlich Lunchtime und wir wollten auch unseren Hunger stillen. Nach der Pause ging es weiter.
Als wir erfuhren, dass man Postkarten mit dem Stempel von Shantytown verschicken konnte, kaufte Franziska sogleich eine. Briefmarken und Karten gab es an der Rezeption und im Café. Dafür hat Shantytown auch ein eigenes Postamt (nachgebautes Austellungsstück) und einen Briefkasten (aktueller Gebrauchsgegenstand).

Wir liefen der Reihe nach die weiteren Stationen ab, lasen uns Informationstafeln durch und bestaunten den gekonnten aufbau. Zu vielen Häusern gab es auch eine passende akustische Untermalung, was mir sehr gut gefiel. Im Saloon spielte jemand ein Klavier; entlang des alten Goldgräberpfades waren einige Figuren aufgestellt, die ihre Lebensgeschichten erzählten, wenn man an ihnen vorbeiging (leider funktionierten einige nicht); in der Gießerei erzählten drei Brüder, wie sie ihre Unternehmen gegründet hatten; in der Druckerei entstand gerade eine neue Ausgabe der Zeitung. Doch das Beeindruckendes war das Sägewerk. Es stellte deutlich dar, wie laut und unangenehm die Arbeitsbedingungen gewesen sein müssen. Ein Mann erzählte davon, wie er einen Finger verlor, während im Hintergrund eine Kreissäge einen zwei Meter dicken Baumstamm zerteilte. Es gab das Hacken von Äxten auf Holz, das Knirschen beim Fallen eins Baums, die riesigen Maschinen, die pochend und hämmernd das Holz durch die Mühle zogen, und, und, und. Einfach überwältigend – und sehr anschaulich.
Das Theater – oder in unserem Fall Kino mit holographischer Projektion – war phantastisch. Nicht nur, dass die Tapete opulent war und einen mit ihren ineinander gewundenen Mustern schon fast zu verschlingen drohte, die Stühle in den Reihen keiner anständigen Nummerierung folgten (da man keinen festen Sitzplatz zugewiesen bekam, war es auch nicht nötig), nein, der kurze Film über das Leben an der Westküste und den Entdecker George Dobson war einfach köstlich! Die zwei Schauspieler konnten mit wenigen Requisiten ein wirklich fesselndes Stück zaubern, das uns nicht nur laut auflachen ließ, sondern auch noch seinen didaktischen Charakter beibehielt. Es war humoristisch und lehrreich zugleich. So ein Kunstgriff gelang Te Papa nicht.
Im Saloon wurde den Besuchern die einzigartige Möglichkeit geboten, Kleidung im Stil des 19. Jahrhunderts anzulegen und ein Foto in Sepia-Optik zu schießen. Da für ein Foto 25 NZ$ berechnet wurden, verzichteten wir auf den Spaß. Auch so war der Saloon klasse.
Einige Gebäude – sie waren auf der Karte mit einem Stern versehen – hatten die Jahrzehnte überstanden und waren Originale aus der Zeit, als Shantytown noch eine blühende Goldgräberstadt darstellte. Damit waren sie älter als das Parlament! Aber das verraten wir den Neuseeländern besser nicht.
In der Edelstein- und Mineralienhalle gab es jede Menge Exemplare für Freunde der Geologie. Aber auch dem Laien wurde etwas Tolles geboten. Ein abgedunkelter Raum beinhaltet einen Schaukasten mit besonderen Steinen, die zuerst mit normalem Licht bestrahlt wurden, um dann Schwarzlicht ausgesetzt zu werden. Einige Steine fluoreszierten im Dunkeln, andere bekamen eine ganz andere Farbe – es war ein farbenprächtiges, kunterbuntes Spektakel. Ich kann mir vorstellen, dass ich wie ein Kleinkind aufquiekte, als die Steine ihr buntes Geheimnis preisgaben.
Nach fünf Stunden waren wir endlich mit Shantytown durch und durften unseren rauchenden Köpfen endlich ein bisschen Ruhe gönnen. Es gab viel, das erst einmal verarbeitet werden musste.
Fazit: Shantytown ist den Eintritt allemal wert. Es gibt für jede Altersgruppe etwas zu tun und es wird eine Vielzahl von Interessengebieten abgedeckt. Im Gegensatz zu Te Papa kombiniert es verschiedene Medien (begehbare Häuser, Audio- und Videomaterial, Holographietechnik, Schilder) gekonnt mit der Vermittlung von Wissen und grundlegenden Informationen. Es gibt eine schöne Balance aus allgemeinen Fakten und persönlichen Schicksalen. Darüber hinaus kommt der Event-Teil dank Lokfahrt, Goldschürfen und Kino nicht zu kurz.
Auf unserem Rückweg kamen wir an einer Jade-Werkstatt vorbei, die Franziska sich gerne näher ansehen wollte. Sie wünschte sich ein Armband mit einem Jade-Stein, war aus verschiedenen Gründen aber nicht von der Ware in Hokitika überzeugt. Da wir eh daran vorbeifuhren, war es nun wirklich kein Problem anzuhalten. Die Werkstatt wurde von einem Ehepaar betrieben, das nur neuseeländische Jade verarbeitete. Die Frau erzählte uns gerne etwas über diesen Stein, der härter als Stahl ist und mit einer Diamantfeile bearbeitet werden muss. Zwar interessierte ich mich nicht sonderlich für Schmuck, das war dann aber doch sehr lehrreich. Für Maori gehörte Jade früher zum Alltag und wurde zu Werkzeugen sowie Waffen verarbeitet – nebst Schmuckgegenständen. Verschiedene, weit verbreitete Formen hatten eine tiefere Symbolik für dieses Volk. Heutzutage haben nur zwei Stämme die Rechte für die Abbaugebiete, aber wenn man als Otto Normalverbraucher ein Stückchen Jade am Flussufer findet, darf man es behalten.
Franziska erklärte der Verkäuferin, was sie sich vorstellte, und beide kamen zu einer zufriedenstellenden Übereinkunft. Dann fuhren wir weiter. Immerhin wurde es langsam spät, der Weg war noch weit und wir mussten noch tanken.
Die Tankstelle in Kumara war ein weiteres Abenteuer, das wir zu bewältigen hatten, wenn wir nicht in Arthur’s Pass zu überhöhten Preisen tanken wollten. Es handelte sich hierbei um eine automatische Tankstelle mit Kartenzahlung. Leider musste man vorher wissen, für wie viel man tanken wollte, den Betrag eingeben, Kreditkarte durchziehen, dann tanken. Wir konnten nicht mit Sicherheit sagen, wie groß der Tank unseres Mietwagens war, geschweige denn, wie viel noch hinein passte, also schätzten wir grob. Es sollte ja nur genug sein, um durch den Pass zu kommen. Nach einigem hin und her und kurzem Argumentieren mit der Tanksäule klappte dann auch alles.

Die Fahrt nach Arthur’s Pass war mehr als abenteuerlich. Da wir nicht die ganze Strecke zurück nach Greymouth oder zu Kumara Junction fahren wollten, beschlossen wir eine frühere Abzweigung zu nehmen, die uns über eine Hauptverbindungsstraße auf den State Highway 73 bringen würde. Was vor uns lag, kam ganz unerwartet. Plötzlich kündigte ein Schild das Ende der asphaltierten Straße an und es ging über eine Geröllpiste weiter. Ich verstehe so etwas, wenn man auf einen Parkplatz fährt oder sich einer entlegenen, natürlichen Attraktion näher. Aber dass ein beliebiges Stück Straße, auf der man 100 km/h fahren darf, nicht befestig ist, sah ich zum ersten Mal.
Als wir dann endlich auf dem Highway waren, setzte ein so starker Regen ein, dass ich erst einmal eine Pause machte. Auch die Höchstgeschwindigkeit fand ich für die Beschaffenheit der Straße und ihren Verlauf viel zu hoch angebracht, so dass ich nur auf kurzen Abschnitten an ihr kratzte. Da gab es hier enge Kurven, dort einspurige Brücken (ich betone noch einmal: State Highway), gefolgt von Steigungen und Gefällen. Manchmal schaffte das Auto nicht mehr als 40 km/h. Alles in allem hatte ich wenig Gelegenheit diese bestimmt sehenswerte Strecke in Augenschein zu nehmen, was nicht nur an den schlechten Sichtverhältnissen und der Dunkelheit lag. Tatsächlich war ich froh, als wir in Arthur’s Pass ankamen und unsere Herberge auf mehr als 700 Metern über NN fanden.
Das… mir fehlt ein passender Begriff für diese Ansammlung von Gebäuden am Straßenrand … Die Siedlung Arthur’s Pass liegt im gleichnamigen Nationalpark Neuseelands, beherbergt – laut Wikipedia – 29 Einwohner und zwingt den Autofahrern eine Höchstgeschwindigkeit von gerade einmal 50 km/h auf, da das Ortszentrum sich direkt an den State Highway 73 schmiegt. Auch der Zug von Greymouth nach Christchurch findet hier einen schnuckeligen Bahnhof, an dem die Menschenmassen hinaus- und wieder hineinströmen können. Alles in allem liegt das Dörfchen sehr idyllisch und hat mit Sicherheit nicht die Probleme einer Großstadt. Leider fehlt es der Siedlung aber auch ein bisschen an Charme. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber wenn man schon in einem Nationalpark sein Heim erbaut, sollte es doch diesen Stolz und die Verbundenheit mit der Natur widerspiegeln – meiner Meinung nach jedenfalls. Arthur’s Pass hingegen schien seinen Frohmut aus Greymouth zu importieren. Ein grobschlächtiger Fehler, der noch korrigiert werden muss.
Es gibt wahrscheinlich keine Häuseransammlung in Neuseeland, die, wenn sie aus mindestens zwei Gebäuden besteht, nicht mindestens ein Hotel, Hostel oder Motel zu bieten hat. Sogar in Arthur’s Pass finden sich drei Unterkunftsmöglichkeiten (eine vierte Stand verlassen am Wegesrand; siehe Foto oben). Wir bezogen Quartier im Mountain House, einer Mischung aus Herberge und Motel. Im Gegensatz zur Behausung in Greymouth war es hier richtig warm, da Heizungen und Klimaanlagen ihr Möglichstes taten, um der nächtlichen Kälte dieser Gegend Einhalt zu gebieten. Tags darauf stellten wir fest, dass die Sonne in dieser Höhe auch nicht mehr so viel Wärme spendete, was wohl auch daran gelegen haben könnte, dass sie die meiste Zeit des Tages hinter Bergen her kroch.
Die Herberge war gemütlich, die Küche geräumig, der Manager freundlich sowie hilfsbereit und es gab nur gewisse Beanstandungen bezüglich der Reinlichkeit. Im oberen Stockwerk gab es eine gemütlich Lounge mit vielen Sofas, Sesseln, Kaffeetischen und einer kleinen Teeküche.
Allerdings möchte ich an einigen Dingen Kritik üben: Zwar haben die neuseeländischen Behörden den Sinn sanitärer Einrichtungen verstanden, aber in manchen Gegenden ist das Prinzip von Duschen und Waschbecken noch nicht ganz angekommen. Wenn ich mit meiner deutschen Durchschnittsgröße kaum Platz habe, um mich um die eigene Achse zu drehen und darauf achten muss, wie ich die Arme bewege, ohne mich an der nächsten Wand zu stoßen, möchte ich nicht wissen, wie zwei-Meter-Menschen in diesen engen Verhältnissen zurechtkommen. Darüber hinaus finde ich es im 21. Jahrhundert in einem Industrieland unangebracht separate Wasserhähne für kaltes und heißes Wasser zu haben, auch wenn es nur das Waschbecken ist. Es gibt ein Spektrum zwischen kochendheiß und eiskalt, das ich sehr gerne bei meiner täglichen Zahnpflege ausnutze. Ebenso sollte der Abstand der Wasserhähne zum Waschbecken so bemessen sein, dass beide Hände gemütlich Platz darunter finden, nicht nur die Fingerspitzen. Kein Wunder, dass das Bad jeden Tag unter Wasser stand. Man konnte sich nicht das Gesicht waschen, ohne zu kleckern.
Ein ganz anderes Thema ist das Wlan in diesem Hostel: Es ist unverschämt teuer. Da verlangte der Empfangsmensch doch tatsächlich 5 $ für einen halben Tag! Wir verzichteten dankend, zumal ich hervorragenden Empfang mit meinem Smartphone hatte.
In einem Achtbettzimmer nur eine Steckdose zu montieren ist aus meiner Perspektive hirnrissig. Selbst für eine Person ist eine Steckdose in einem Raum zu wenig, es sei denn, es handelt sich um eine winzige Abstellkammer. In Anbetracht der elektrischen Geräte, die ein Durchschnittsmensch heutzutage mit sich führt, war auch der Mehrfachstecker mit vier Plätzen nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Ein bisschen mehr Verständnis für junge Leute hätte ich in einem Land voller Backpacker erwartet.
An unserem ersten Tag in diesem Hostel legten wir eine Pause von all den Aufregungen der letzten Zeit ein. Wir spazierten durch den Ort, ohne eine richtige Wanderroute einzuschlagen, folgten dann einem historischen Pfad durch die Siedlung, aber es stellte sich heraus, dass dies einer Schnitzeljagd ohne ausreichende Hinweise gleichkam. Wir fanden die Plaketten 9, 10, 11, gefolgt von 8 und 1, dann fanden wir durch Zufall 4, 3, 2,7. Um den Highway 73 nicht noch einmal rauf und runter zu stolpern, fragten wir an der Rezeption, wo die Informationsschilder 5 und 6 waren. Vermutlich hätten wir sie ohne Hilfe nie aufgespürt. Als wir dann an einem frostigen Morgen den Beschreibungen des Hostelmitarbeiters folgten, fanden wir eine herrliche Landschaft vor, die selbst mit einfachen Schuhen und nicht-alpiner Ausrüstung hätte bewandert werden können. Leider drängte unser Zeitplan und wir mussten darauf verzichten. Trotzdem hatten wir alle Plaketten der historischen Stadtführung gefunden, womit wir sehr zufrieden waren.
Der „Millennium Walk“ war äußerst enttäuschend. Wir folgten den Schildern, entdeckten einen kleinen, schmalen Pfad zu einer Aussichtsplattform, von der aus man einen phantastischen Blick auf den kleinen Wasserfall hatte, gingen zurück, über die Brücke einen Pfad entlang, vorbei am Startpunkt zum Avalanche Peak, um dann wieder an einem Schild anzukommen, das uns zurückschickte, wenn wir den Millennium Walk machen wollten. Ein Blick auf die Karte im DOC-Gebäude ließ uns darauf schließen, dass der Aussichtspunkt am Wasserfall dieser Millennium Walk sein sollte. Er dauerte zwei Minuten.

Abenteuerlich war besonders die Polizeistation dieses Ortes.

Mehr muss ich dazu wohl nicht sagen.
An diesem Abend sah ich zum ersten Mal einen Kea. Der Vogel saß auf dem Dach des Arthur’s Pass Store / Café und krächzte munter vor sich hin. Leider waren die Lichtverhältnisse nicht mehr gut genug für ein Foto und das Tierchen wollte partout nicht näher kommen. Dennoch war ich von seiner Größe überrascht, weil ich erwartete hätte, dass er kleiner wäre. Meine zweite Begegnung mit diesen possierlichen Tierchen verlief ähnlich, so dass ich nicht viel zu der Gattung schreiben kann. Es kann sogar sein, dass es ein und derselbe Vogel war. Trotzdem bin ich froh, ihn mal live gesehen zu haben.
Franziska wünschte sich einen Ausflug nach Shantytown, einer Erlebnisstätte für die ganze Familie, die einem Freilichtmuseum wohl am nächsten kommt.
Shantytown liegt ca. 35 km nördlich von Hokitika, aber wir waren bereits in unserer Herberge am Arthur’s Pass, so dass wir ungefähr eineinhalb Stunden Fahrt über einen äußerst gewundenen und abenteuerlichen State Highway auf uns nehmen mussten. Dieses Mal fuhr Franziska und es amüsierte uns beide, dass sie diesen ach so viel befahrenen Highway zur perfekten Gelegenheit für erste Fahrversuche mit einem Automatikfahrzeug erklärte. Sie meisterte ihre Aufgabe gut, so dass sie nach kurzer Zeit nur die üblichen Problemchen mit Blinker und Scheibenwischer hatte. Verständlich, wie ich finde. Wir kamen jedenfalls sicher und ohne Zwischenfälle, aber auch zügig an unserem Ziel an. Zwischendurch bleiben wir noch zweimal stehen, um an ausgeschilderten Plätzen die wunderschöne Landschaft in uns aufzunehmen. Leider mussten wir feststellen, dass tiefhängende Wolken die Sicht doch beachtlich trübten. Auf dem Rückweg hingegen stellten wir fest, dass diese Aussichtspunkte weniger der Natur als viel mehr neuseeländischer Ingenieurskunst huldigten.

Von ihnen aus sollte man die technischen Wunderbauten bestaunen, die eine Fahrt durch den Arthur’s Pass überhaupt erst ermöglichten. Die Neuseeländer sollten mal von ihrer kleinen Insel runter kommen und quer durch Österreich und die Schweiz fahren, um zu lernen, wie man anderenorts mit einigen kleinen Bergen umgeht.
Zurück zu Shantytown.
Vorab: Shantytown ist in puncto Information und medialer Darstellung wesentlich besser als Te Papa. Auch wenn Franziska anfangs skeptisch war, weil der Flyer Entertainment und lebende Geschichte versprach, so überzeugte das Gesamtkonzept doch allemal. Die Mischung aus Wissen, Hintergrundinformationen, verschiedenen Medien und Spaßelementen war hervorragend abgestimmt. Ich entschuldige mich im Voraus dafür, dass ich immer wieder Bezug zu Te Papa nehmen werde, zumal dieser selten ein gutes Haar an dem Nationalmuseum lassen wird. Allerdings finde ich, dass man diese beiden Museen nicht separat betrachten kann, wenn man sie sah. Insbesondere dann nicht, wenn man mit hohen Erwartungen in Te Papa rein ging und Shantytown erst skeptisch betrachtete.
Aber ich sollte am Anfang anfangen.
An der Rezeption begrüßte uns eine freundliche Dame, die uns sogleich deutschsprachige Infoflyer mit Karten des Geländes aushändigte. Diese waren bewusst auf alt getrimmt, auf braunem Papier gedruckt und allgemein sehr schön gemacht. Die Dame sagte uns zudem, wann der nächste Zug abfahren würde und dass wir ihn so oft benutzen konnten, wie wir es nur wollten. (Da wir laut Flyer mindestens 90 Minuten für das Museum einplanen sollten, gingen wir davon aus, dass wir nur eine Gelegenheit für die Zugfahrt haben würden.) Unseren Rabattcoupon von 20% nahm die Dame auch freundlich entgegen. Dann ging es auch schon los.
Der erste Eindruck von Shantytown erinnerte ein bisschen an eine Wildweststadt.

Es verwundert kaum, da die Stadt das Leben zu Zeiten des neuseeländischen Goldrausches darstellen sollte, aber die Kulisse, also der Regenwald an der Westküste, war ganz anders. Von dem nicht sonderlich linearen, stilistisch aber besonders schönem Aufbau erst einmal erschlagen, beschlossen wir einfach bei 1 auf unserer Karte anzufangen und uns der Reihe nach bis 40 durchzuarbeiten. Einige Ausstellungsstücke nahmen nur wenige Augenblicke in Anspruch (das riesige Wasserrad beispielsweise); für andere brauchten wir allerdings geraume Zeit, weil so viele Informationen auf engem Raum präsentiert wurden (Chinatown zählte zu letzterem
 ). Te Papa verlor kein Wort über chinesische – oder allgemein nicht europäische – Einwanderer. Hier konnte man die Behausungen chinesischer Goldgräber betreten – Nachbauten versteht sich – und einige persönliche Schicksale nachverfolgen. Ebenso war ein Spaziergang durch eine Goldmine möglich. Beachtlich war, dass die meisten Chinesen nur nach Neuseeland kamen, um nach Jahren harter Arbeit als reiche Männer zurück ins Heimatland zu gehen. Selbstverständlich gelang es nicht allen, aber dies zeigte uns, wo von Anfang an die Prioritäten vieler Einwanderer lagen – damals wie heute. Dementsprechend sahen die Behausungen dieser Einwanderer auch aus: Sie waren funktional und spartanisch, bereit jeder Zeit abgerissen zu werden. Bis heute sehen viele Städte in Neuseeland, insbesondere an der Westküste, so aus, als ob die Einwohner nur auf ein Zeichen warten würden, um ihre Siebensachen zu packen und weiter zu ziehen, dem Glück hinterher. Manchmal scheint es, als wären sie nie richtig angekommen – wie die Unmengen an jährlichen Backpackern. Ein relativ kleiner Abschnitt dieses Freilichtmuseums vermochte die Mentalität der heutigen Neuseeländer tiefergreifend zu erklären als ihr gesamtes Nationalmuseum.
). Te Papa verlor kein Wort über chinesische – oder allgemein nicht europäische – Einwanderer. Hier konnte man die Behausungen chinesischer Goldgräber betreten – Nachbauten versteht sich – und einige persönliche Schicksale nachverfolgen. Ebenso war ein Spaziergang durch eine Goldmine möglich. Beachtlich war, dass die meisten Chinesen nur nach Neuseeland kamen, um nach Jahren harter Arbeit als reiche Männer zurück ins Heimatland zu gehen. Selbstverständlich gelang es nicht allen, aber dies zeigte uns, wo von Anfang an die Prioritäten vieler Einwanderer lagen – damals wie heute. Dementsprechend sahen die Behausungen dieser Einwanderer auch aus: Sie waren funktional und spartanisch, bereit jeder Zeit abgerissen zu werden. Bis heute sehen viele Städte in Neuseeland, insbesondere an der Westküste, so aus, als ob die Einwohner nur auf ein Zeichen warten würden, um ihre Siebensachen zu packen und weiter zu ziehen, dem Glück hinterher. Manchmal scheint es, als wären sie nie richtig angekommen – wie die Unmengen an jährlichen Backpackern. Ein relativ kleiner Abschnitt dieses Freilichtmuseums vermochte die Mentalität der heutigen Neuseeländer tiefergreifend zu erklären als ihr gesamtes Nationalmuseum.Ich schweife ab. Entschuldigung.
Nach Chinatown war es Zeit für die Zugfahrt. Ich war ganz ergriffen von der Vorstellung mit einer historischen Dampflokomotive zu fahren. Natürlich standen wir wie für Deutsche üblich viel zu früh am Bahnhof und warteten ungeduldig auf den Zug. Als die Lok einfuhr, machte sie erst einmal eine große Show: Dampf quoll in dicken Schwaden aus dem Schornstein vorne und zwischen den Rädern hervor; die Lok blieb stehen, um von jedem bestaunt und fotografiert werden zu können; die Lokführerin betätigte die laute Pfeife, so dass man den Zug noch im nächsten Ort hörte. Perfekte Inszenierung. Als die Lok endlich an den Wagen angedockt hatte, durften wir Passagiere einsteigen.

Während der Fahrt gab es eine automatische Durchsage zu den verschiedenen Stationen, der Strecke und dem Zug, aber es war so laut im Wagon, dass ich kaum etwas verstand. Als die Lok den Wagon anschob, bildete sich eine enorme Dampfwolke um das Fahrzeug, so dass wir es gar nicht mehr sehen konnten. Ich verstand, warum die Lokomotive den Wagon anschob, anstatt ihn zu ziehen. Hinter uns war nur noch eine weiße Wand zu sehen.
Es ging quer durch den Regenwald an einigen Ausstellungshäusern (Sägemühle, Goldauswaschbecken) vorbei zum Ende der Strecke, wo wir eine kurze Rast einlegten, uns Informationen über die Arbeitsbedingungen der Arbeiter vor 150 Jahren durchlesen konnte, etwas über den hiesigen Regenwald erfuhren und uns die Lok aus der Nähe ansehen durften. Die Lokführerin beantwortete sogar freudig jede Frage und plauschte gerne mit ihren Fahrgästen.
Dann ging es wieder zurück, wobei der Großteil der Gruppe an der Sägemühle ausstieg, um von dort zu Fuß ins „Zentrum“ von Shantytown zurückzukehren, natürlich nicht ohne vorher ein bisschen Gold auszuwaschen. Wir fuhren einfach mit dem Zug weiter. Immerhin war es Zeit für Lunch und wir wollten kein Gold schürfen.

Zum Lunch begaben wir uns ins King Dick’s Café, das, da es sich auf dem Gelände befand und zu den Ausstellungsstücken gehörte, ebenfalls die damalige Atmosphäre durch eine stilistisch angeknackste Einrichtung widerspiegelte. Das meine ich mit einer großen Portion Humor, denn die Stilbrüche waren teilweise notwendig. Kaffeeautomaten und Energiesparglühbirnen waren nur zwei Beispiele davon. Außerdem versuchte man altes Dekor mit modernen Gesundheitsbestimmungen zu kombinieren, was nicht immer gelang.
Unser Gutschein über einen kostenlosen Kaffee / Tee konnten wir hier problemlos einlösen, auch wenn es sich um große Portionen handelte, die sonst 5 NZ$ oder mehr gekostet hätten. Dazu nahmen wir Pie. Es war schließlich Lunchtime und wir wollten auch unseren Hunger stillen. Nach der Pause ging es weiter.
Als wir erfuhren, dass man Postkarten mit dem Stempel von Shantytown verschicken konnte, kaufte Franziska sogleich eine. Briefmarken und Karten gab es an der Rezeption und im Café. Dafür hat Shantytown auch ein eigenes Postamt (nachgebautes Austellungsstück) und einen Briefkasten (aktueller Gebrauchsgegenstand).

Wir liefen der Reihe nach die weiteren Stationen ab, lasen uns Informationstafeln durch und bestaunten den gekonnten aufbau. Zu vielen Häusern gab es auch eine passende akustische Untermalung, was mir sehr gut gefiel. Im Saloon spielte jemand ein Klavier; entlang des alten Goldgräberpfades waren einige Figuren aufgestellt, die ihre Lebensgeschichten erzählten, wenn man an ihnen vorbeiging (leider funktionierten einige nicht); in der Gießerei erzählten drei Brüder, wie sie ihre Unternehmen gegründet hatten; in der Druckerei entstand gerade eine neue Ausgabe der Zeitung. Doch das Beeindruckendes war das Sägewerk. Es stellte deutlich dar, wie laut und unangenehm die Arbeitsbedingungen gewesen sein müssen. Ein Mann erzählte davon, wie er einen Finger verlor, während im Hintergrund eine Kreissäge einen zwei Meter dicken Baumstamm zerteilte. Es gab das Hacken von Äxten auf Holz, das Knirschen beim Fallen eins Baums, die riesigen Maschinen, die pochend und hämmernd das Holz durch die Mühle zogen, und, und, und. Einfach überwältigend – und sehr anschaulich.
Das Theater – oder in unserem Fall Kino mit holographischer Projektion – war phantastisch. Nicht nur, dass die Tapete opulent war und einen mit ihren ineinander gewundenen Mustern schon fast zu verschlingen drohte, die Stühle in den Reihen keiner anständigen Nummerierung folgten (da man keinen festen Sitzplatz zugewiesen bekam, war es auch nicht nötig), nein, der kurze Film über das Leben an der Westküste und den Entdecker George Dobson war einfach köstlich! Die zwei Schauspieler konnten mit wenigen Requisiten ein wirklich fesselndes Stück zaubern, das uns nicht nur laut auflachen ließ, sondern auch noch seinen didaktischen Charakter beibehielt. Es war humoristisch und lehrreich zugleich. So ein Kunstgriff gelang Te Papa nicht.
Im Saloon wurde den Besuchern die einzigartige Möglichkeit geboten, Kleidung im Stil des 19. Jahrhunderts anzulegen und ein Foto in Sepia-Optik zu schießen. Da für ein Foto 25 NZ$ berechnet wurden, verzichteten wir auf den Spaß. Auch so war der Saloon klasse.
Einige Gebäude – sie waren auf der Karte mit einem Stern versehen – hatten die Jahrzehnte überstanden und waren Originale aus der Zeit, als Shantytown noch eine blühende Goldgräberstadt darstellte. Damit waren sie älter als das Parlament! Aber das verraten wir den Neuseeländern besser nicht.
In der Edelstein- und Mineralienhalle gab es jede Menge Exemplare für Freunde der Geologie. Aber auch dem Laien wurde etwas Tolles geboten. Ein abgedunkelter Raum beinhaltet einen Schaukasten mit besonderen Steinen, die zuerst mit normalem Licht bestrahlt wurden, um dann Schwarzlicht ausgesetzt zu werden. Einige Steine fluoreszierten im Dunkeln, andere bekamen eine ganz andere Farbe – es war ein farbenprächtiges, kunterbuntes Spektakel. Ich kann mir vorstellen, dass ich wie ein Kleinkind aufquiekte, als die Steine ihr buntes Geheimnis preisgaben.
Nach fünf Stunden waren wir endlich mit Shantytown durch und durften unseren rauchenden Köpfen endlich ein bisschen Ruhe gönnen. Es gab viel, das erst einmal verarbeitet werden musste.
Fazit: Shantytown ist den Eintritt allemal wert. Es gibt für jede Altersgruppe etwas zu tun und es wird eine Vielzahl von Interessengebieten abgedeckt. Im Gegensatz zu Te Papa kombiniert es verschiedene Medien (begehbare Häuser, Audio- und Videomaterial, Holographietechnik, Schilder) gekonnt mit der Vermittlung von Wissen und grundlegenden Informationen. Es gibt eine schöne Balance aus allgemeinen Fakten und persönlichen Schicksalen. Darüber hinaus kommt der Event-Teil dank Lokfahrt, Goldschürfen und Kino nicht zu kurz.
Auf unserem Rückweg kamen wir an einer Jade-Werkstatt vorbei, die Franziska sich gerne näher ansehen wollte. Sie wünschte sich ein Armband mit einem Jade-Stein, war aus verschiedenen Gründen aber nicht von der Ware in Hokitika überzeugt. Da wir eh daran vorbeifuhren, war es nun wirklich kein Problem anzuhalten. Die Werkstatt wurde von einem Ehepaar betrieben, das nur neuseeländische Jade verarbeitete. Die Frau erzählte uns gerne etwas über diesen Stein, der härter als Stahl ist und mit einer Diamantfeile bearbeitet werden muss. Zwar interessierte ich mich nicht sonderlich für Schmuck, das war dann aber doch sehr lehrreich. Für Maori gehörte Jade früher zum Alltag und wurde zu Werkzeugen sowie Waffen verarbeitet – nebst Schmuckgegenständen. Verschiedene, weit verbreitete Formen hatten eine tiefere Symbolik für dieses Volk. Heutzutage haben nur zwei Stämme die Rechte für die Abbaugebiete, aber wenn man als Otto Normalverbraucher ein Stückchen Jade am Flussufer findet, darf man es behalten.
Franziska erklärte der Verkäuferin, was sie sich vorstellte, und beide kamen zu einer zufriedenstellenden Übereinkunft. Dann fuhren wir weiter. Immerhin wurde es langsam spät, der Weg war noch weit und wir mussten noch tanken.
Die Tankstelle in Kumara war ein weiteres Abenteuer, das wir zu bewältigen hatten, wenn wir nicht in Arthur’s Pass zu überhöhten Preisen tanken wollten. Es handelte sich hierbei um eine automatische Tankstelle mit Kartenzahlung. Leider musste man vorher wissen, für wie viel man tanken wollte, den Betrag eingeben, Kreditkarte durchziehen, dann tanken. Wir konnten nicht mit Sicherheit sagen, wie groß der Tank unseres Mietwagens war, geschweige denn, wie viel noch hinein passte, also schätzten wir grob. Es sollte ja nur genug sein, um durch den Pass zu kommen. Nach einigem hin und her und kurzem Argumentieren mit der Tanksäule klappte dann auch alles.
... link (0 Kommentare) ... comment
... older stories